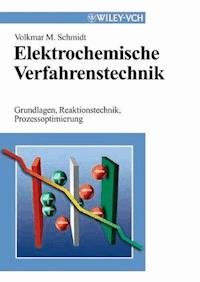
239,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch bringt dem Leser das Themengebiet der elektrochemischen Verfahrenstechnik in präziser und aktueller Form nahe: mit Beispielen und Aufgaben mit Lösungen werden sowohl dem Einsteiger die theoretischen Grundlagen der Elektrochemie vermittelt, als auch der Fortgeschrittene von der Verfahrensentwicklung zur modernen elektrochemischen Verfahrenstechnik in Anwendung und Praxis geleitet. Der dargebotene Themenbereich umfasst Galvanotechnik, organische und anorganische elektrochemische Produktionsverfahren, wichtige Elektrolyseverfahren sowie Batterien und Brennstoffzellen, und wendet sich damit an Studierende und Berufseinsteiger in Forschung, Entwicklung und Produktion, die einen guten und schnellen Überblick über die Materie gewinnen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Liste der verwendeten Einheiten und Symbole
Abkürzungen
Konstanten
1 Einführung
1.1 Definitionen
1.2 Arbeitsweise in der Elektrochemischen Verfahrenstechnik
1.3 Elektrochemische Verfahren in Chemie und Technik
1.4 Grundbegriffe
2 Elektrochemische Grundlagen
2.1 Ionische Leitfähigkeit und Elektrolyte
2.2 Elektrochemische Thermodynamik
2.3 Elektrolytische Doppelschicht
2.4 Elektrochemische Kinetik
3 Transportprozesse in der elektrochemischen Verfahrenstechnik
3.1 Massen- und Energiebilanz elektrochemischer Reaktoren
3.2 Wärmetransport
3.3 Stofftransport
3.4 Stromverteilung
4 Elektrochemische Reaktionstechnik
4.1 Elektrolyte
4.2 Elektroden
4.3 Separatoren
4.4 Elektrochemische Reaktoren
4.5 Modellierung von elektrochemischen Reaktoren
5 Verfahrenstechnik
5.1 Integration des elektrochemischen Reaktors in ein Verfahren
5.2 Verfahrensentwicklung
5.3 Qualitätsmanagement
6 Elektrolyseverfahren
6.1 Technische Elektrochemie der Metalle
6.2 Chloralkalielektrolyse
6.3 Weitere anorganische Elektrolyseverfahren
6.4 Organische Elektrosynthesen
6.5 Elektrokinetische Techniken
6.6 Umwelttechnische Verfahren
7 Elektrochemische Energietechnik
7.1 Energieumwandlung und elektrochemische Reaktoren
7.2 Batterien
7.3 Elektrochemische Doppelschichtkondensatoren
7.4 Brennstoffzellen
Register
Weitere empfehlenswerte Bücher
Reichwein, J., Hochheimer, G., Simic, D.
Messen, Regeln und Steuern
2003
ISBN 3-527-30572-6
Helmus, F. P.
Anlagenplanung Von der Anfrage bis zur Abnahme
2003
ISBN 3-527-30439-8
Bard, A. J., et al.
Encyclopedia of Electrochemistry
2003
(11 vols.)
ISBN 3-527-30250-6 (Set)
Prof. Dr. Volkmar M. Schmidt
Fachhochschule Mannheim - Hochschule für
Technik und Gestaltung
Institut für Elektrochemische Verfahrenstechnik
Fachbereich Verfahrens- und Chemietechnik
Windeckstr. 110
68163 Mannheim
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2003 WILEY-VCH Verlag GmbH & KGaA, Weinheim
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527299584
Epdf ISBN 978-3-527-62362-4
Epub ISBN 978-3-527-66064-3
Mobi ISBN 978-3-527-66063-6
Vorwort
Elektrochemische Verfahren sind nicht neu und werden seit über 150 Jahren in vielen Bereichen der chemischen Industrie angewendet. Zu nennen sind insbesondere die Chloralkalielektrolyse – bis heute konkurrenzlos für die Produktion der wichtigen Grundchemikalien Chlor und Natronlauge. Die Schmelzflusselektrolyse von Aluminium, Magnesium, Natrium und Kalium sowie die wässrigen Elektrolysen zur Gewinnung von Kupfer und Zink bilden Ausgangspunkte für die Herstellung metallischer Werkstoffe und chemischer Verbindungen. Weitere Beispiele sind die Galvanotechnik sowie anorganische und organische Elektrosynthesen zur Produktion von Fein- und Spezialchemikalien.
Die Erfindung der Brennstoffzelle zur Direktumwandlung von chemischer Energie in Elektrizität ist älter als der Erfindung des elektrodynamischen Prinzips und des Verbrennungsmotors. In den letzten Jahren sind auf diesem Gebiet große Fortschritte gemacht worden und mit einer Markteinführung der Brennstoffzellen-Technik für stationäre Einheiten und für Fahrzeugantriebe ist in den nächsten Jahren zu rechnen. In Verbindung mit der Wasser-Elektrolyse zur Wasserstoff-Produktion können damit mittel- bis langfristig Konzepte für eine nachhaltige Energiewirtschaft realisiert werden. Batterien in ihren verschiedenen Bauformen und Größen – ebenso galvanische Elemente wie die Brennstoffzellen – die Chloralkalielektrolysesind heute bereits nicht mehr aus dem täglichen Leben wegzudenken und liefern elektrische Energie für eine Vielzahl von elektronischen Geräten.
Die zentrale Einheit eines elektrochemischen Verfahrens ist der Reaktor, in dem chemische Stoffumwandlungen unter Beteiligung von elektrischer Energie durchgeführt werden. Neben der Massen- und Energiebilanz muß hierbei zusätzlich die Ladungsbilanz beachtet werden. Je nach der Arbeitsbilanz steht in der elektrochemischen Reaktionstechnik daher entweder die Minimierung des Energieverbrauchs eines Elektrolyse-Reaktors oder die Maximierung der Leistungs- und Energiedichte eines galvanischen Elements im Vordergrund.
Die Aufgaben in der elektrochemischen Verfahrenstechnik sind unterschiedlicher Herkunft und können nur interdisziplinär gelöst werden. Sie reichen von den naturwissenschaftlichen Grundlagen bis zu den ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Ohne die letzteren ist die Realisierung einer im Labor optimierten elektrochemischen Reaktion in einem industriellen Verfahren nicht möglich. Entsprechend ist dieses Buch in die folgenden Kapitel gegliedert:
Nach einer Einführung (Kapitel 1) werden Grundlagen der Elektrochemie mit den wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik und Kinetik behandelt (Kapitel 2), gefolgt von einer Einführung in den Wärme- und Stofftransport (Kapitel 3). Im Kapitel über die elektrochemische Reaktionstechnik (Kapitel 4) werden die zentralen Komponenten eines elektrochemischen Reaktors diskutiert. Nach einigen einführenden Überlegungen zur Verfahrenstechnik und -entwicklung (Kapitel 5) schließen sich zwei Kapitel mit Verfahrensbeispielen an (Elektrolyse-Verfahren, Kapitel 6, und elektrochemische Energietechnik, Kapitel 7).
Die Intention dieses Buches besteht nicht in einer enzyklopädischen Auflistung bestehender Verfahren. Vielmehr sollen die in den vorangestellten Kapiteln eins bis fünf dargestellten physikalisch-chemischen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen anhand von Beispielen aus der industriellen Praxis vertieft werden. Da der Schwerpunkt auf Stoff- und Energieumwandlungen gelegt wurde, fehlen deshalb die elektrochemische Analytik und die Behandlung von elektrochemischen Sensoren.
Dieses Buch richtet sich an Studierende in den Studiengängen Chemie, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik und angrenzende Fächer im Hauptstudium sowie an Berufsanfänger und Praktiker, die sich mit den Prinzipien elektrochemischer Verfahren vertraut machen wollen. Grundkenntnisse in Chemie, Physikalischer Chemie, Stoff- und Wärmeübertragung und Reaktionstechnik sind deshalb von Vorteil, aber keine Bedingung. Der Stoff wird, wenn möglich, mit Graphiken veranschaulicht und mit im Text integrierten Beispielrechnungen vertieft. Am Ende eines jeden Kapitels finden sich Verweise auf weiterführende Monographien oder Artikel über aktuelle Forschungsergebnisse.
Mein Dank gilt allen, die mich bei der Fertigstellung dieses Buches tatkräftig unterstützt haben.
Meinen Mitarbeitern Dominik P.J. Barz, Jean-François Drillet, Boris Frumkin und Natascha Heß-Mohr verdanke ich den Aufbau des elektrochemischen Labors, die Durchführung von Messungen und Korrekturen am Manuskript. Den Herren T. Schmid, M. Mohrdieck, F. Wittmann und Frau K. Lauer danke ich ganz besonders für die vielen Anregungen, für ihre Mühe und Sorgfalt bei der Anfertigung der Zeichnungen und Diagramme. Für die Überlassung von technischen Informationen danke ich Herrn Dr. Nikola Anastascijevic von Outokumpu/Lurgi Metallurgie in Oberursel, Herrn Dr. H. Pütter von der BASF AG in Ludwigshafen/Rhein, Herrn Dr. Andreas Küver und Frau U. Müller-Eisen von der Bayer AG in Dormagen und Leverkusen, Herrn J. Großfeld, Krupp Uhde GmbH in Dortmund, Herrn Dr. K.-A. Starz von OMG AG & Co. KG in Hanau-Wolfgang. Wertvolle Anregungen und Diskussionen stammen von Herrn Dr. T. Lehmann, Degussa im Industriepark Wolfgang und schließlich von meinem Kollegen, Herrn Prof. Dr. Ulrich K. Trägner, Mannheim. Für das Korrekturlesen von Teilen des Manuskriptes und Diskussionsbeiträgen danke ich ganz besonders den Herren Dr. Thomas Hartung, Sven Horn und Dr. Michael Krausa. Finanzielle Unterstützung erfolgte von der Daimler- Chrysler AG und für die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Kompetenzcenter für emissionsarme Nutzfahrzeuge im Werk Mannheim danke ich Herrn Prof. Dr. C. Bader. Schließlich gilt mein Dank dem Lektor von Wiley-VCH in Weinheim, Herrn Dr. M. Ottmar, für sein Interesse und seine Geduld bei der Anfertigung des Manuskriptes.
Viernheim, Juni 2003
Volkmar M. Schmidt
… und auch für R. M.,denn Elektrochemie macht Spaß!
Liste der verwendeten Einheiten und Symbole
Akkürzungen
AAM
Anionenaustauschermembran
AC
a
lternating
c
urrent
(Wechselstrom)
ACN
Acrylnitril
ADN
Acryldinitril
ADS
Adipinsäure
AFC
a
lkaline
f
uel
c
ell
(alkalische Brennstoffzelle)
AHM
äußere Helmholtzschicht
AM
aktive Masse
AN
Acetonitril
BE
Bezugselektrode
BET
Brunauer-Emmet-Teller
BDD
bordotierte Diamantelektrode
BHKW
Blockheizkraftwerk
BZ
Brennstoffzelle
CSB
chemischer Sauerstoffbedarf
CSTR
c
ontinuous
s
tirred
t
ank
r
eactor
(kontinuierlich betriebener Durchflußreaktor)
CV
c
yclic
v
oltammogram
(Zyklisches Voltammogramm)
Da
Damköhler-Zahl
DC
d
irect
c
urrent
(Gleichstrom)
DCP
Dichlorphenol
DHPA
Dihydrophthalsäure
DIN
Deutsche Industrienorm
DMF
Dimethylformamid
DMFC
d
irect
m
ethanol
f
uel
c
ell
(Direkt-Methanol-Brennstoffzelle)
DMSO
Dimethylsulfoxid
DOC
d
issolved
o
rganic
c
arbon
(gelöster organischer Kohelenstoff)
DOD
d
epth
o
f
d
ischarge
(Entladetiefe)
DSA
dimensionsstabile Anode
E
Edukt
EC
Ethylencarbonat
ECVT
Elektrochemische Verfahrenstechnik
ED
Elektrodialyse
EDSK
Elektrochemischer Doppelschicht-Kondensator
EIS
Elektrochemische Impedanzspektroskopie
EMD
Elektrolytisch (hergestelltes) Mangandioxid
EMST
Elektrochemische Mikrosystemtechnologie
EOI
e
lectrochemical
o
xygen
i
ndex
(elektrochemischer Sauerstoffindex)
EtOH
Ethanol
EVU
Energieversorgungsunternehmen
EZ
Elektrolytzahl
FEP
Polyfluorethenpropen
FHTG
Fachhochschule für Technik und Gestaltung (Mannheim)
FMEA
f
ailure
m
ode
a
nd
e
ffects
a
nalysis
(Fehlermöglichkeits- und Einflußanalyse)
FTA
f
ault
t
ree
a
nalysis
(Fehlerbaumanalyse)
(g)
Stoff im gasförmigen Aggregatzustand
GDE
Gasdiffusionselektrode
GDS
Gasdiffusionsschicht
GE
Gegenelektrode
Gr
Grashoff-Zahl
Γ
Geometriezahl
HDH
Hydrodehalogenierung
HMD
Hexamethylendiamin
HTBZ
Hochtemperaturbrennstoffzelle
ICE
instationäre Stromausbeute(von engl.: i
nstantaneous
c
urrent
e
fficiency
)
IHM
innere Helmholtzschicht
ITIES
i
nterface
b
etween
t
wo
i
mmiscible
e
lectrolyte
s
olutions
(Grenzschicht zwischen zwei nicht mischbaren Elektrolyte)
jato
Jahrestonnen
KAM
Kationenaustauschermembran
KTL
kathodische Tauchlackierung
KWK
Kraftwärmekopplung
(l)
Stoff im flüssigen Aggregatzustand(von engl.: l
iquid
)
LIGA
Lithographie, Galvanoformung und Abformung
MCFC
m
olten
c
arbonate
f
uel
c
ell
(Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle)
MeOH
Methanol
ME
Meßelektrode
MEE
Membran-Elektroden-Einheit
MTBZ
Mitteltemperaturbrennstoffzelle
NHE
n
ormal
h
ydrogen
e
lectrode
(Normalwasserstoffelektrode)
NTBZ
Niedertemperaturbrennstoffzelle
Nu
Nußelt-Zahl
Ox
oxidierte Spezies
P
Produkt
PAAG
Prognose-Auffinden-Abschätzen der Auswirkungen-Gegenmaßnahmen
PA
Polyamid
PAFC
p
hosphoric
a
cid
f
uel
c
ell
(Phosphorsäure-Brennstoffzelle)
PANI
Polyanilin
PBI
Polybenzimidazol
PC
Propylencarbonat
PCB
p
rinted
c
ircuit
b
oard
(gedruckte Leiterplatten)
PCP
Pentachlorphenol
PFR
p
lug
f
low
r
eactor
(Durchflußreaktor)
PE
Polyethen
PEEK
Polyetherehterketon
PEFC
p
olymer
e
lectrolyte
f
uel
c
ell
(Membran-Brennstoffzelle)
PMMA
Polymethylmethacrylat
PP
Polypropen
PR
Prandtl-Zahl
PTFE
Polytetrafluorethen
PVA
Polyvinylalkohol
PVC
Polyvinylchlorid
QM
Qualitätsmanagement
Re
Reynolds-Zahl
Red
reduzierte Spezies
RHE
r
eversible
h
ydrogen
e
lectrode
(reversible Wasserstoffelektrode)
RPZ
Risikoprioritätszahl
(s)
Stoff im festen Aggregatzustand(von engl.: s
olid
)
Sc
Schmidt-Zahl
SCE
s
aturated
c
alomel
e
lectrode
(gesättigte Kalomelelektrode)
Sh
Sherwood-Zahl
SOFC
s
olid
o
xid
f
uel
c
ell
(keramische Brennstoffzelle)
SPE
solid polymer electrolyte
TBA
4-tert-Butylbenzaldehyd
TEM
Transmissionselektronenmikroskopie
TOC
t
otal
o
rganic
c
arbon
(chemisch gebundener organischer Kohlenstoff)
THF
Tetrahydrofuran
Wa
Wagner-Zahl
WT
Wärmetauscher
YSZ
yttriumstabilisiertes Zirkondioxid
ZAFC
z
inc
a
ir
f
uel
c
ell
(Zink/Luft-Zelle)
ZEBRA
z
ero
e
mission
b
attery
r
esearch
a
ctivities
(-Batterie)
(NiCl
2
/Na -Batterie)
Konstanten
1
Einführung
1.1 Definitionen
Die Aufgaben der Elektrochemischen Verfahrenstechnik (ECVT) sind die Beschreibung und Entwicklung von Verfahren für die Stoff- und Energieumwandlung mit Hilfe von elektrochemischen Reaktionen. Die ECVT stellt damit einen Zweig der chemischen Verfahrenstechnik dar, in der die Stoffumwandlungen in chemischen Reaktoren im Mittelpunkt stehen. Die Optimierung eines Verfahrens beinhaltet die Analyse der physikalisch-chemischen Prozesse in einem elektrochemischen Reaktor, die Beachtung des Stoff- und Energieeinsatzes sowie die Quantifizierung der Kosten für Bau, Betrieb und Instandsetzung der Anlage.
Die wissenschaftlich-technische Grundlage für die verfahrenstechnische Analyse liefert die Elektrochemie, in der die physikalisch-chemischen Phänomene an der Phasengrenze zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten als Ort des chemischen Umsatzes behandelt werden. Die Anwendung dieser Gesetzmäßigkeiten führt zur elektrochemischen Reaktionstechnik, die zum Ziel hat die entsprechenden Reaktoren mit ihren Komponenten auszulegen, zu konstruieren und den Betrieb mit Hilfe von mathematischen Modellen zu beschreiben.
Das Charakteristische der Elektrochemie ist, daß chemische Reaktionen unter Beteiligung von Elektronen ablaufen, die durch einen äußeren Leiterkreis fließen. Ein Reaktionspartner in einer elektrochemischen Reaktion ist stets eine Elektrode, die Elektronen entweder aufnimmt oder abgibt. Das hat für die ECVT zur Folge, daß neben der Masse und Energie zusätzlich die Ladung bzw. der Stromfluß bilanziert werden muß. In Abb. 1.1 sind die Ströme dieser drei Bilanzgrößen beim Betrieb eines elektrochemischen Reaktors schematisch dargestellt.
Durch Zufuhr von elektrischer Energie werden chemische Stoffumwandlungen im elektrochemischen Reaktor durchgeführt. Die Schnittstelle zwischen dem wechselstromführenden Netz des Energieversorgungsunternehmens und dem Reaktor in einem Betrieb ist ein sogenannter AC/DC-Wandler, der die hohe Wechselspannung heruntertransformiert und den Reaktor mit Gleichstrom versorgt.
Andererseits kann in einem elektrochemischen Reaktor auch chemische in elektrische Energie umgewandelt werden. In diesem Fall liegt ein galvanisches Element (eine Batterie oder eine Brennstoffzelle) vor und elektrische Energie kann in Form von Gleichstrom über eine angepaßte Leistungselektronik (DC/AC-Wandler) in das Wechselstromnetz eingespeist werden (siehe Abb. 1.1).
Abb. 1.1 Edukt- und Produktströme, Wärme und elektrische Energie als die wichtigsten Bilanzgrößen in einem elektrochemischen Reaktor
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























