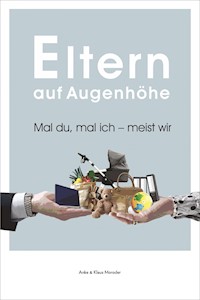
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gleichberechtigung bei jungen Eltern – nur Theorie? Was passiert mit einem Paar, wenn Kinder kommen? Von der ersten Zeit nach der Geburt bis zur Schulzeit der Kinder benennen die Autoren systematisch die typischen Herausforderungen für junge Eltern in Deutschland und zeigen, wie man vermeidet, unbeabsichtigt in die typischen Rollenmuster zu verfallen. Es gibt viele Fallstricke zu umgehen, aber es ist möglich, das alles zu beider Zufriedenheit hinzubekommen, ohne sich dabei aufzureiben und die Beziehung zu riskieren. Es kann gelingen, in dem man sich sowohl die Verantwortung für die Kinder als auch die Möglichkeit, berufliche Chancen wahrzunehmen, teilt. Dieses Buch ist kein Ergebnis täglicher Diskussionen und klein karierten Aufrechnens, sondern die Darstellung bewusster Aufgabenverteilung. Es geht darum, Automatismen zu vermeiden und stattdessen mit klarem Blick zu planen und sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Jeder soll Chancen wahrnehmen können und mit 60 nicht bereuen, zögerlich gewesen zu sein – oder seine Familie zu wenig gesehen zu haben. Und jeder soll den familiären Fahrersitz kennen, aber auch mal verlassen dürfen und den anderen machen lassen. Die Autoren lassen ihre persönliche Erfahrung einfließen und verdeutlichen ihre Gedanken und Vorschläge mit zahlreichen Beispielen aus dem persönlichen Umfeld. – "Auch aus Sicht eines Personalers ein ganz wertvoller Beitrag! Das Buch ist in keinem Fall eines der vielen ›quick fix / easy solution‹-Bücher, sondern vielmehr eine inspirierende Geschichte, die den Leser einlädt, in aller Unvorhersehbarkeit das Elternwerden und vor allem das Elternsein zu planen, zu diskutieren und gemeinsam zu meistern. Das gehört in jede (werdende) Familie." (Dr. Simon Haug, Leiter Zentralbereich Personal, Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anke MoroderKlaus Moroder
Eltern auf Augenhöhe
Mal du, mal ich – meist wir
Eltern auf Augenhöhe Anke und Klaus Moroder
Copyright: © 2021 Anke und Klaus Moroder
Lektorat: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung: Anneke Bieger
published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die über den Rahmen des Zitatrechtes bei korrekter vollständiger Quellenangabe hinausgeht, ist honorarpflichtig und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.
Für Carlotta und Isabella
Über die Autoren
Dr. jur. Anke Moroder
geboren 1984 in München, Rechtsanwältin,
verheiratet, zwei Töchter, ein und vier Jahre alt,
Studium in Würzburg, Promotionsstudium in Köln, Referendariat in Hamburg,
diverse Anwaltsstationen in Hamburg und München; zuletzt in einer Kanzlei für Medizinrecht in München,
arbeitet als Syndikusanwältin in der deutschen Rechtsabteilung eines amerikanischen Konzerns.
Anke Moroder hat in der ersten Schwangerschaft einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und nach dem Mutterschutz Anfang 2017 wieder in Vollzeit gearbeitet, von 01/2018–11/2019 mit vorübergehender Reduktion auf 80 Prozent, von 11/2019–06/2020 Mutterschutz und Elternzeit für die zweite Tochter. Seit Juni 2020 ist sie wieder in Vollzeit tätig.
Dipl.-Ing. Dott. Arch. Klaus Moroder (M. Eng.)
geboren 1982 in Bozen (Italien), Architekt,
verheiratet, zwei Töchter, ein und vier Jahre alt,
Studium der Architektur in München und Venedig,
berufsbegleitendes Masterstudium für Projektmanagement in Augsburg,
Mitarbeit in international tätigen Architekturbüros in Hamburg und München,
Arbeitet als Architekt bei einem Münchner Immobilien-Projektentwickler.
Klaus Moroder hat nach der Geburt seiner ersten Tochter ein ganzes Jahr Elternzeit genommen sowie ein halbes Jahr Elternzeit für seine zweite Tochter.
1. Einführung
»Willst Du wirklich Elternzeit machen? Ich hab’ das beim ersten Kind gemacht, aber meine Frau wusste eigentlich schnell Bescheid, wie es geht. Beim zweiten Kind war es dann nicht mehr nötig, dass ich zu Hause bleibe.« Mit derartigen Vorstellungen von Familienleben waren wir plötzlich konfrontiert, als wir im Freundes- und Bekanntenkreis sowie in den Büros die erste Schwangerschaft und die geplante längere Elternzeit von Klaus bekannt gaben. Wir waren erstaunt – und naiv! –, welch starke Auffassungen von richtig und falsch herrschten, welche Rollen wir spielen sollten, sobald wir nicht mehr nur ein Paar waren, sondern eine Familie wurden. Plötzlich hatte jeder eine Meinung und beurteilte unsere bis dahin erst grob skizzierte Planung – insbesondere im Hinblick auf unsere Jobs und die angeblich fehlende beziehungsweise mögliche Vereinbarkeit mit der Familie. Und zugegeben: Wie so viele andere junge Eltern wussten wir nicht so recht, was mit Kindern wirklich auf uns zukam.
Wer also gerade überlegt, ob er oder sie Kinder möchte, lege dieses Buch bitte sofort aus den Händen, denn es könnte sein, dass der Alltag von berufstätigen Eltern etwas abschreckend wirkt, auch wenn wir schwören, dass es herrlich ist. Herrlich auch deshalb, weil beide Welten – sowohl der Job als auch die Familie beziehungsweise die Kinder – ihre Ernsthaftigkeit verlieren können und sich die Chance bietet, beides zu relativieren: das trotzende Kind genauso wie den nervigen Kollegen. Man fängt an, Parallelen zu sehen. Man stellt fest, dass Konflikte manchmal auf die exakt gleiche Art lösbar sind. Selten kann man die Zeit an einem gewöhnlichen Montagmorgen (05:30 Uhr) so sehr genießen wie beim Schnellstart durch einen dreijährigen Finger in der eigenen Nase – und das in dem Wissen, dass drei Stunden später in einem gekühlten Meeting-Raum ernsthafte Gesichter eine gut vorbereitete, diplomatisch formulierte Antwort auf eine möglicherweise aktienkursrelevante Frage erwarten. Wenn man überlegt, wie man den dreijährigen Finger aus der Nase argumentiert hat, hilft die Antwort vielleicht auch im Job, Chancen und Risiken aufzuzeigen und dabei nicht allzu vehement den Kopf zu schütteln.
Im Jahre 2016, als unsere erste Tochter geboren wurde, waren in Deutschland die Möglichkeiten für die Verwirklichung individueller Familienkonstellationen längst geschaffen. Dass Mütter die Kinder betreuenmüssen und Väter das Geld nach Hause bringen müssen ist heutzutage nicht mehr der einzige gangbare Weg: Weder die Regelungen zum Elterngeld (bzw. zur Elternzeit) noch zur Teilzeit gelten nur für eines der Geschlechter. Bis auf Ausnahmesituationen ist es also jedem Paar und jeder Familie möglich, persönliche Vorlieben (wer möchte denn länger zu Hause bleiben oder eben nicht, wer braucht eine Auszeit vom Job, will sich vielleicht selbstständig machen etc.?), wirtschaftliche Vorteile (können wir uns leisten, dass beide Elternzeit nehmen, oder ist das Gehalt eines Ehepartners unverzichtbar, ist einer gar aus verschiedenen Gründen Alleinverdiener?) und andere Faktoren (beispielsweise gesundheitlicher Art) zu berücksichtigen, um den täglichen Kampf gegen Trotzanfälle, rote Beete an der Wand und Knoten in den Haaren zu fechten.
Eines dürfte bei aller Jongliererei klar sein: Kinder sind wunderbar. Auf sie zu verzichten, nur weil die Rahmenbedingungen, insbesondere die beruflichen, zu herausfordernd erscheinen, wäre unglaublich schade. Wir sind uns sicher, dass man eine solche Entscheidung irgendwann bereut und als Verlust empfindet. Es wäre auch volkswirtschaftlich schlimm, wie man in anderen Ländern beobachten kann. Nicht nur, dass in Ländern wie Italien oder Griechenland insgesamt wenig Kinder geboren werden, es gibt – besonders im Vergleich zu den nordischen und osteuropäischen Ländern wie Schweden, Dänemark oder Slowenien – auch sehr geringe Quoten an erwerbstätigen Müttern (zum Vergleich: 85 % aller Mütter in Schweden arbeiten, während dies in Italien und Griechenland nur 56 % tun). In Krisenzeiten fehlt dann gegebenenfalls ein Einkommen.
Die zentrale Herausforderung von Eltern ist unseres Erachtens, jegliche Verbissenheit an die so viel beschworene Vereinbarkeit von Beruf- und Familienleben abzuschütteln und mutig ein individuelles Modell zu entwickeln, das echten Teamgeist bedeutet. Wir leben in Zeiten, in denen wir uns den Luxus leisten können, die eigenen Lebensprioritäten im Verlauf der Familiengründung und der ersten Jahre mit Kindern immer wieder nachzujustieren. Warum tun wir es nicht? Warum hinterfragen wir unsere jeweilige Situation nicht ab und zu, schonungslos ehrlich? Stehe ich um 14 Uhr auf dem Spielplatz an der Wasserpumpe im Matsch, weil ich genau das wollte und richtig finde, oder hat sich das irgendwie so ergeben? Erst wenn man derartige Fragen ehrlich beantwortet, kann man gemeinsam definieren, welche Aufgaben wie übernommen, wo und wie lange Kinder fremdbetreut und welche Kompromisse geschlossen werden müssen.
Seitdem wir uns erstmals mit diesem Thema auseinanderzusetzen hatten, sind wir erstaunt, wie häufig – trotz der weitgehenden Freiheit des Systems, das Familienleben zu organisieren – immer noch so oft Mütter hauptsächlich die Verantwortung für die Kinder und plötzlich auch vollständig den Haushalt übernehmen und Väter sich um das wirtschaftliche Wohl der Familie kümmern. – Und das unabhängig von der persönlichen Entwicklungsmöglichkeit sowie der wirtschaftlichen Perspektive der jeweiligen Jobs und ohne andere Optionen durchgespielt zu haben. Die Aufgabenverteilung wird selten so benannt und entstammt selten einem klar getroffenen Einverständnis … sie ergibt sich einfach im Verlauf der ersten Lebensmonate des Kindes. Fragt man die Paare während der (ersten) Schwangerschaft der Frau, ob sie die bislang ernsthaft vorgenommene und meist auch gelebte Gleichberechtigung aufgeben wollen, zugunsten einer klassischen Rollenverteilung, wird man Lachen und Kopfschütteln ernten. Natürlich teilt man sich auch weiterhin die Verantwortung, auch wenn am Anfang das Kind ein bisschen mehr bei der Mama sein wird. – Und aus dem Anfang wird der familiäre Alltag.
Zugespitzt hat sich diese mangelnde Entschlossenheit, sich bewusst für ein individuell passendes Modell zu entscheiden, während der im Jahr 2020/2021 Corona-bedingt geschlossenen Schulen und Kindergärten beziehungsweise Kitas. Haben viele Familien entschieden, ob beziehungsweise wie sich die Eltern die Aufgabe Kinderbetreuung teilen? Oder haben die Väter sich wie selbstverständlich zurückgezogene Arbeitsplätze eingerichtet, während die Mütter die Kinder versorgt haben, mit oder ohne beruflicher Nebentätigkeit? Wie auch immer improvisiert wurde – viel zu oft wurde gar nicht groß besprochen, wo und wie beispielsweise ein Bereich für Mama geschaffen werden muss, an dem sie sich zumindest ab und zu konzentrieren kann. Denn eines ist den heutigen Müttern gemein: Fast alle arbeiten irgendwie. Aber Priorität räumt man dem (noch) nicht ein. Dienstreisen der Mütter werden zu verhindern versucht, sie stören, sie führen zu Familienchaos. Aber Papa ist Vielflieger.
Es ist zwar schön, zu sehen, dass mittlerweile viele Jungpapas die zwei Vätermonate Elternzeit nehmen, die Kinder morgens in den Kindergarten oder in die Schule bringen; Väter wechseln mittlerweile auch selbstverständlich Windeln und lesen Gutenachtgeschichten vor. Aber dass Mütter mit kleinen Kindern beruflich erfolgreich sind, weil Väter ihnen den Rücken freihalten, ist dennoch die absolute Ausnahme. Es ist in Deutschland immer noch genauso ungewöhnlich, dass Mütter und Väter mehr oder weniger zu gleichen Teilen die Kinder versorgen und beide zu gleichen Teilen arbeiten. Wir meinen, dass viele Väter sich Familienzeit entgehen lassen und Mütter wiederum berufliche Chancen nicht verwirklichen, weil der Einsatz für die Kinder vermeintlich keine Freiräume lässt oder man zu zögerlich an die Frage herangeht, wie viel berufliche Tätigkeit man der Familie zumuten kann. Angeblich kann man ja in der Zukunft noch den Fokus auf den Beruf legen, aber macht man das dann und geht es dann so einfach?
Haben wir ein Patentrezept für die Aufteilung zwischen Frau und Mann, wenn sie Mutter und Vater werden? Nein.
Ist 50:50 schon die Lösung? Wenn es in spitzfindigem Aufrechnen und täglichen Diskussionen endet, wird es anstrengend.
Glauben wir, dass andere unser individuelles Modell kopieren sollten? Bestimmt nicht! Erstens passt es nicht für jede Familie, sondern vielleicht nur für uns mit unseren zwei kleinen Wirbelwinden und unseren zwei Jobs, von denen wir ein ganzes Buch lang behaupten werden, dass wir nicht auf sie verzichten wollen. Zweitens haben wir auch gelegentliche Planänderungen vorgenommen – vornehmen müssen. Es wird auch zu weiteren Anpassungen kommen, wenn die Kinder älter werden und die Bedürfnisse sich ändern; weg von der Glitzereinhorntapete hin zu regelmäßigem Irgendwas-Training. Weg von ein bisschen Zeit zum abendlichen Toben mit Papa hin zu Antworten auf Fragen in der Pubertät (das globale Warum von Vierjährigen wird mit Sicherheit spezifischer).
Schlussendlich muss es jedes Paar selbst wissen und niemandem steht es zu, zu beurteilen, wer es richtig macht und wer falsch. So ist vor allem der Vorwurf an Frauen, die die Familie (zeitweise) über die Karriere beziehungsweise den Beruf stellen, ungerechtfertigt, denn viele Frauen – und Männer – sind mit dieser Prioritätensetzung zufrieden. Mütter unserer Zeit organisieren oft hauptsächlich den Haushalt und die Kinder; man möchte meinen, der Alltag ist nicht anders als damals derjenige der eigenen Mutter. Allerdings kommt heutzutage die berufliche Tätigkeit hinzu, denn natürlich will man zurück in den Job. Das ist hoch anerkennenswert – aber auch sehr kräftezehrend.
Wir beobachten, dass die Zufriedenheit mit diesen vielfältig geschulterten Aufgaben im Verlauf der Monate beziehungsweise Jahre in der heutigen Zeit bei erstaunlich vielen arbeitenden Müttern schwindet. Frust, Erschöpfung oder gegenseitiges Aufrechnen ersetzen die Euphorie und Erleichterung, alles gleichzeitig hinzubekommen. Dies vor allem dann, wenn man die beruflichen beziehungsweise wirtschaftlichen Konsequenzen einer Priorisierung der Familie eigentlich nie in Kauf nehmen wollte und plötzlich Tatsachen geschaffen werden: Aus Leitungsebene wird Zuarbeit und aus der Karriereleiter wird eine nicht gleichermaßen wertgeschätzte und bezahlte berufliche Position. Plötzlich merkt man, dass man in die Rolle der Hauptverantwortlichen für die Kinder und den Haushalt reingeschlittert ist und die körperliche und psychische Erschöpfung eine ernsthafte berufliche Tätigkeit gar nicht mehr zulässt. Man kriegt im Job zu spüren, was es heißt, wenn einem der volle berufliche Einsatz nicht mehr zugetraut wird.
Eine derartige Prioritätensetzung entspringt häufig keiner bewussten Entscheidung für längere Zeiträume, keiner Absprache zwischen Ehepartnern, sondern sie ergibt sich: Es kommen viele Faktoren zusammen, die dazu führen, dass die einst gelebte Gleichberechtigung sich nicht mehr nach Augenhöhe anfühlt, und das ist sehr schade.
Wir wollen daher dazu ermuntern, dass Väter und Mütter nicht zulassen, in Rollen zu rutschen, ohne das wirklich zu wollen und ohne, dass die jeweiligen Kräfte einigermaßen eingeteilt werden. Frauen, die sich in der Verantwortung für die Familie und Kinder sehen, müssen deswegen nicht sämtliche eigenen Bedürfnisse hintanstellen, auch wenn sie meinen, dass es der falsche Zeitpunkt dafür ist, eigene Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen.
Funktionieren kann das aber nur, wenn Männer zuverlässig Zeit in den familiären Alltag investieren und Aufgaben übernehmen, ohne dass dies immer wieder zur Disposition steht. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Projekte zu übernehmen als bisher, denn zum familiären Glück trägt es selten bei, wenn mit weiteren Karriereschritten mehr Abwesenheit von zu Hause einhergeht.
Das erfordert die klare Kommunikation zwischen Ehepartnern, aber auch an Chefs und Vorgesetzte beziehungsweise Kollegen oder Kunden. Manchmal sind es nur kleine Stellschrauben wie zum Beispiel der Start in den Arbeitstag um 09:15 Uhr statt wie früher um 08:30 Uhr. Dass das (von speziellen Berufen abgesehen) den nächsten Karriereschritten entgegensteht, ist meist mehr Befürchtung als Realität.
Wenn die Familienplanung ansteht, wäre also wünschenswert, wenn gemeinsam und ehrlich definiert wird, wie die Rollenverteilung aussehen könnte, sobald das Kind oder die Kinder da sind: Soll die bislang gelebte Aufgabenverteilung beibehalten werden oder soll sich etwas ändern? Was würde das eine oder andere Lebensmodell bedeuten, welche Konsequenzen entstünden für die Mutter beziehungsweise für den Vater? Wie viel externe Unterstützung würde benötigt; wäre vielleicht ein Au-pair, eine Putzhilfe oder ein Babysitter eine Lösung, um enge Zeitpläne zu entzerren? Schön wären bewusstere Entscheidungen über die eigenen und gemeinsamen Lebenswege mit Kindern, gerade am Anfang der Familienzeit und gerade in den Jahren, in denen Kinder klein sind: Wir wollen andere Mütter und Väter zu individuellen Lösungen und ehrlichen Diskussionen ermutigen. In der Konsequenz wäre schön zu beobachten, wenn das mehr Männer in aktiven Familienrollen, weniger Oktopusgefühle für Mütter und nicht zuletzt mehr Elternzeit im wortwörtlichen Sinne für Kinder bedeuten könnte. Wer dieses Buch als Aufforderung zum Ehekrach sieht, sei herzlich eingeladen, fröhlich zu streiten, aber wir sind natürlich nicht schuld daran.
Allerdings würde es uns freuen, wenn die berufliche und private Aufgabenverteilung nicht immer noch so oft aus gesellschaftlichem Druck entsteht beziehungsweise einem Automatismus, den Arbeitgeber, Kollegen, Familien und Freunde fördern. Ich habe erst mal ein Jahr Elternzeit beantragt, dann mal sehen ist ein Standardsatz von Frauen, den wir schade finden; er zeigt, dass man keine Vorstellung davon hat, wann vielleicht Papa dran ist oder man selbst wieder in den Job zurückgeht, wenn man denn will. Es bedeutet in der Konsequenz auch, dass Arbeitgeber nicht planen können und eine bislang aussichtsreiche berufliche Position sich verändert, Beförderungen nicht stattfinden, Hobbys brach liegen. Wenn man im Job aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein will, dann bedarf es einer klaren Zusage – und es bedarf der Unterstützung des Partners, auch wenn das dessen Verzicht auf die Kalenderhoheit bedeuten kann. Das Privileg, beruflich in sicherem Sattel zu sitzen, darf nicht nur für einen bestehen oder vom Zufall abhängen – so hätte jeder von uns eine faire Partnerschaft vor den Kindern beschrieben. Fast alle von uns hätten auch betont, dass man darauf Wert lege und sich selbstverständlich gegenseitig Chancen ermöglichen und entsprechend damit einhergehende Entlastung an anderer Stelle gewähren will.
Dass nach wie vor so viele Frauen einen Weg in dauerhafte Teilzeit beziehungsweise weniger fordernde Jobs gehen, ist eine Tatsache. Viele werden sagen, dass es eine positive Entwicklung ist, dass es mittlerweile gute Teilzeitjobs gibt, Modelle wie Jobsharing nicht mehr zu erstaunten Nachfragen führen und dadurch Frauen nicht mehr nur die Wahl zwischen Beruf und Familie haben. Diese Flexibilität bedeutet leider in der Konsequenz auch, dass ein anderer Weg für Frauen mit Kindern nicht wirklich ernst genommen wird. Gut meinende Chefs stellen offen infrage, ob die angekündigte Planung nicht eine Überforderung darstellt. Mehrere Freundinnen von uns haben freundschaftliche Aufforderungen erdulden müssen, noch mal in sich zu gehen und zu überlegen, ob die diskutierte Position nicht etwas viel mit kleinen Kindern sei. Man wolle ja nicht zum familiären Unglück beitragen. Sich dann zu rechtfertigen ist schwierig, denn natürlich ist man mit kleinen Kindern nicht so flexibel wie ohne – und man möchte ja schließlich auch für die Kinder da sein. Diejenigen Frauen, die trotz ihrer Kinder ernsthafte berufliche Tätigkeiten verfolgen wollen, geraten nicht nur an ihre Belastungsgrenzen, sondern auch an eine gläserne Decke im Job. Gesellschaftlich müssen sie zudem oft den Vorwurf einer Rabenmutter ertragen, denn noch immer ordnet man kleine Kinder Müttern zu und nicht Eltern.
Die Statistik gibt zurückhaltenden Arbeitgebern dann auch recht, da sie zeigt, dass die beruflichen Ambitionen von Müttern schwinden: Noch jede Mutter hat den Beruf der Kinder wegen letztlich depriorisiert; so das Misstrauen, das den freundschaftlichen Nachfragen zugrunde liegt.
Fast alle Industriestaaten setzen mittlerweile finanzielle Anreize, um Eltern nahezulegen beziehungsweise zu ermöglichen, sich die Erziehungsarbeit untereinander aufzuteilen. Wir sind dennoch immer wieder erstaunt, wie wenig die gegebenen Möglichkeiten zu gegenseitiger Entlastung führen und wie viele Paare letztlich eine klassische Rollenaufteilung leben, denn die Frau arbeitet nicht auch, sondern zusätzlich zu Kindern und Haushalt.
Es fällt Männern wie Frauen schwer, sich das Jahr mit Baby und insbesondere die Jahre mit Kind oder Kindern während der (ersten) Schwangerschaft auszumalen – man kennt ja auch weder den Charakter des Kindes noch sich selbst in Momenten elterlicher Verantwortung. Man sucht – ganz gleichberechtigt und schön gemeinsam – den passenden Namen aus und absolviert auch den unsäglichen Geburtsvorbereitungskurs zusammen. Werdende Väter wissen oft erstaunlich detailliert, welche Kaiserschnittraten es an welchem Krankenhaus gibt und ob die Chance auf ein Familienzimmer nach der Geburt realistisch ist. Man richtet das heimische Kinderzimmer ein und achtet auf die Bio-Qualität des Holzes. Der Wandanstrich in Pastellfarben ist laut Stiftung Warentest für die Gesundheit des Babys völlig unbedenklich, hatte aber ja auch seinen Preis. Elterliche Themen sind: Hellblau oder Rosa, Ella oder Ferdinand und Cybex, Bugaboo (Haben aber alle!) oder gleich ein Doppelsitzer, denn man will schließlich mehrere Kinder. Die Fahrradfahrer zermürben sich den Kopf, ob ein Anhänger den Ansprüchen genügt oder lieber gleich ein Elektro-Lastenfahrrad angeschafft wird. Für die kleinen Helden werden keine Kosten gescheut. Und natürlich wird auch für den sicheren motorisierten Transport der Thronfolger gesorgt, indem eine Armada an Kindersitzen samt Isofix-Basisstationen fürs Auto schon im Keller steht, um je nach Gewicht und Größe der Sprösslinge nahezu quartalsweise durchtauschen zu können. Vorbereitung ist eben alles! Was so oft fehlt, ist die Vorbereitung auf die Elternrolle und auf die Herausforderung, sich den neuen Alltag aufzuteilen.
Oft kommt die Notwendigkeit derartiger Überlegungen zum ersten Mal auf, sobald der Kitaplatz zugewiesen ist und der entsprechende Vertragsentwurf für die Betreuung ins Haus flattert. Wann soll das Kind gebracht und wann abgeholt werden? Ad hoc wird der familiäre Tagesablauf abgefragt. Die ersten vagen Überlegungen, wie viel wieder gearbeitet werden soll, müssen nun konkret werden und mit der Struktur, den Bring- und Holzeiten koordiniert werden.
Neben dem überaus ernst gemeinten Rat, spätestens jetzt eine industrietaugliche Großtrommel-Waschmaschine anzuschaffen, sollte die To-do-Liste der Familienplanung insbesondere eine Diskussion über das individuelle Familienmodell enthalten. Es geht nicht nur um die Anzahl an Stunden ihrer Teilzeittätigkeit, sondern viel wichtiger ist die Definition der eigene Rolle und der jeweiligen Verantwortlichkeiten in der Partnerschaft: Im Alltag wird es zu Fragen kommen wie derjenigen, wer bei gleichzeitigen Dienstreisen oder Abendterminen eine andere Lösung finden muss, auch wenn der Chef nicht begeistert sein wird – Juhu, ein Kollege muss ran haben wir jedenfalls selten gehört). Es wird darum gehen, wer zu Hause bleibt, wenn das Kind krank ist, die Kita geschlossen hat oder dergleichen.
Das heißt aber unseres Erachtens nicht, dass man immer mindestens die Großeltern in Hab-Acht-Stellung benötigt oder besser gleich in Panik verfällt. Es heißt vielmehr, dass beide Eltern für die Familie da sein können, wenn es nötig ist. Wenn Mama immer als Fall back Option zur Verfügung steht, wird es ihre Jobchancen kosten beziehungsweise nach außen offenbaren, dass das der Job ist, den man der Familie wegen belastet. Dass es jedes Mal Streit um die Befüllung der Brotzeitbox gibt und Organisatorisches fast jedes Gespräch zwischen den Eltern bestimmt, kann langfristig die Ehe kosten (oder auch kurzfristig, je nach Hitzköpfigkeit). Dass spontan irgendein noch nie gesehener Babysitter engagiert wird, kostet gegebenenfalls die Unbeschwertheit der Kinder – wenn das Kind diesen Babysitter nicht ohnehin zum sofortigen Verlassen der Wohnung auffordert. Wir wissen, wovon wir reden.
Es ist nicht immer einfach, trotz und mit (kleinen) Kindern die Augenhöhe als Paar beizubehalten. Plötzlich droht klein kariertes Aufrechnen, denn dass man grundsätzlich gemeinsam verantwortlich für das Familienleben ist, stellen in der jetzigen Elterngeneration kaum mehr Paare infrage. Die Beiträge der Eltern sollten aber dann, wenn’s drauf ankommt, so gerecht verteilt sein, dass nicht langfristig einer zu kurz kommt oder viel schlimmer: das Gefühl hat, zu kurz zu kommen – sei es die Frau oder der Mann. Denn es kann eine gefährliche Entfremdung voneinander drohen: Zu unterschiedliche Lebensmittelpunkte, fehlendes Verständnis für den anderen oder der geheime Gedanke, man selbst trüge mehr zum Gelingen der Familie bei, sind giftige Zutaten. Etwa: Warum ist der Elterngeldantrag noch nicht fertig ausgefüllt, sie hätte doch den ganzen Tag Zeit dazu gehabt! oder Warum muss denn jetzt der Keller aufgeräumt werden? Das hat doch keine Priorität.





























