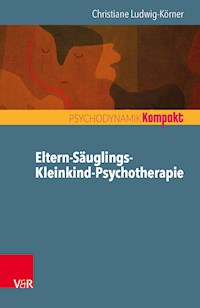
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Ergebnisse der Säuglings- und Bindungsforschung belegen den großen Einfluss der frühen Kindheit auf die Entwicklung. Für Familien sind der Übergang zur Elternschaft und die ersten Lebensjahre des Kindes sehr sensible und krisenanfällige Phasen, so dass unterstützende Angebote hilfreich und oft notwendig sind. Das breite Spektrum im Bereich Früher Hilfen reicht von Prävention über Beratung, Krisenintervention bis zu Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie. Zahlreiche Beispiele illustrieren die vielfältigen Störungsbilder, die sich in der Beziehung zwischen Säugling/Kleinkind und Eltern entwickeln können, und stellen die verschiedenen psychoanalytischen Behandlungsmethoden vor. Die Beratung und Therapie von Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern trägt dazu bei, die vorhandenen kindlichen und elterlichen Kompetenzen zu nutzen und eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. So kann verhindert werden, dass sich frühe Störungen verfestigen und die weitere Entwicklung beeinträchtigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben vonFranz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Christiane Ludwig-Körner
Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99807-7
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: Paul Klee, Siesta der Sphinx, 1932/akg-images
© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen EPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1Vorbemerkungen
2Historische Entwicklung und gegenwärtiger Stand
3Die Bedeutung der frühen Zeit
3.1Die aktuellen Herausforderungen für Eltern
3.2Erkenntnisse aus der Stressforschung und Entwicklungsaufgaben nach der Geburt
3.3Frühe Störungsbilder
3.4Psychische Erkrankungen der Eltern und ihre Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
4Wurzeln der psychoanalytischen Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
4.1Einflüsse von Selma Fraiberg
4.2Einflüsse der Bindungstheorie
4.3Ein langer Weg zur Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
5Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie im Spannungsfeld der Frühen Hilfen
6Weiterbildung in Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
7Methoden der Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
7.1Veränderte Behandlungsbedingungen in der Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
7.2Gemeinsamkeiten der psychoanalytischen Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapien
7.3Weitere methodische Herangehensweisen in der analytischen Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
7.4Traumatherapie
7.5Beispiel einer Kurzzeitpsychotherapie
8Anwendungsfelder von Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
8.1Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapien in eigener Praxis
8.2Arbeitsfeld Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
9Wirksamkeit von Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie
10Ausblick
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 60 bis 70 Seiten je Band kann sich der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Christiane Ludwig-Körner hat ein Buch über die Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie vorgelegt, das in verständlicher und übersichtlicher Form den ganzen Kosmos dieser Therapieform erschließen lässt. Ausgehend von der historischen Entwicklung wird die Frage erörtert, warum das Angebot von Psychotherapie gerade in der frühen Kindheit von so enormer Bedeutung ist. Erkenntnisse der Stressforschung und zu frühen Entwicklungsaufgaben werden dabei ebenso herangezogen wie die Erkenntnisse zu frühen Störungsbildern und der Problematik von Eltern-Kind-Interaktionen bei psychischen Störungen der wichtigen Bezugspersonen. Die Entwicklung, die diese neue Therapieform in den letzten Jahren gemacht hat, ist enorm, und die Vernetzung der Ansätze auch auf internationaler Ebene belegt die große Relevanz der Intervention in den frühesten Entwicklungsphasen der Babys und Kleinkinder, die enge Verzahnung zwischen kindlicher und elterlicher Problematik. Insbesondere für die Prävention und Therapie in Hochrisikofamilien ist dieser Ansatz hervorragend geeignet.
Die Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie (ESKP) stellt im Spannungsfeld der Frühen Hilfen eine eigenständige Methode dar, die komplex ist und sehr verschiedene Techniken und Methoden umfasst, deren Einzelheiten und Vorgehensweisen explizit gemacht werden. Die Arbeit an Übertragungen und Repräsentanzen sowie korrigierende emotionale Erfahrungen für die Eltern stellen eine Gemeinsamkeit unterschiedlicher Arten von psychodynamisch orientierten Methoden der Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie dar. Auch verhaltensorientierte und traumazentrierte Vorgehensweisen werden angesprochen sowie familienorientierte Verfahren und die Arbeit mit Videorückmeldung. Dadurch entsteht ein Klima der Interdisziplinarität, das dieser innovativen Therapieform auch angemessen ist.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
1Vorbemerkungen
Meine Beschäftigung mit der frühen Kindheit begann, als ich Ende der Siebzigerjahre als teilnehmende Beobachterin bei Geburten dabei sein konnte. Mich schockierte nicht nur, dass viele Frauen gleichzeitig in einem großen Kreißsaal, lediglich durch einen Wandschirm von den anderen kreißenden Frau getrennt, ihre Kinder mehr oder weniger allein zur Welt bringen mussten, wie eine nicht deutsch sprechende Migrantin, die wohl ihr Kind in der Hockstellung zur Welt bringen wollte und immer wieder gezwungen wurde, sich hinzulegen. Mich schockierte auch, dass Kinder damals noch sofort von der Mutter getrennt und versorgt wurden, und nur selten wurde es den Müttern erlaubt, ihren Säugling bei sich im Zimmer rund um die Uhr zu behalten. Später begann man, ambulante Geburten durchzuführen, und es war beeindruckend zu sehen, wie diese nach der Leboyer-Methode geborenen Kinder selten schreiend zur Welt kamen bzw. sich schnell beruhigten, wenn sie der Mutter (meist in Anwesenheit des Vaters oder einer anderen nahen Begleitperson) auf den Bauch gelegt wurden. Ich habe in Vorträgen auf gynäkologischen Kongressen für eine veränderte Geburtspraxis plädiert und musste erleben, wie nicht nur Chefärzte, sondern auch Hebammen sich vehement gegen eine Veränderung im Klinikalltag stellten.
Es waren die Säuglingsforschungen, die mir dann die theoretischen Erklärungen gaben für das, was ich bei den Geburten erlebt hatte. Das Studium der Werke und Begegnungen mit Daniel Stern, Josef Lichtenberg, Robert Emde, Paul und Anna Ornstein, Anni Bergmann und Mechthild Papoušek waren die Wegbereiter, um 1997 in Potsdam an der Fachhochschule eine Beratungsstelle »Vom Säugling zum Kleinkind« (gestartet mit der Kollegin Eva Hédervári-Heller) aufzubauen, die später zu einem Familienzentrum ausgebaut wurde. Forschungsprojekte mit Beratungen von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern folgten, und 2004 begannen wir im Rahmen unserer Beratungsstelle an der Fachhochschule Potsdam mit einer curricularen eineinhalbjährigen analytischen Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie-Weiterbildung, die seit 2010 zusammen mit der Berliner Psychotherapeutenkammer an der International Psychoanalytic University Berlin (IPU) angeboten wird. Sie richtet sich an bereits approbierte Erwachsenen- oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die sich zusätzlich in der Behandlung von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern weiterbilden möchten. Da der Zugang beider Berufsgruppen möglich ist, gibt es weltweit unterschiedliche Namensgebungen: Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie (ESKP) oder Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie (SKEPT), wie es im Kapitel 5 näher erläutert wird.
Diese Therapieform ist gekennzeichnet durch die gemeinsame Arbeit mit der Mutter/dem Vater und dem Säugling/Kleinkind. Im Zentrum der Behandlung steht die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung. Durch die Geburt und das Sich-intensiv-um-den-Säugling-kümmern-Müssen werden die elterlichen eigenen verinnerlichten frühen Erfahrungen, die dem Bewusstsein nicht zugänglich sind, wiederbelebt und können zu verzerrten Vorstellungen, Einstellungen und Handlungen führen, die die kindliche Entwicklung zum Teil schwer belasten. Die auftretenden Symptome können vielfältig sein, sich in Wochenbettdepressionen, Zwängen (z. B. Zwangsgedanken, das Kind töten zu wollen), Ängsten u. a. äußern und sich im kindlichen Verhalten als exzessives Schreien, Ein-, Durchschlafstörungen, Schwierigkeiten beim Essen (Fütter-, Gedeihstörungen), Trotzen, Selbstverletzungen u. a. ausdrücken, worauf im Kapitel 3 genauer eingegangen wird. Da in dieser frühen Zeit nicht nur Bindungsmuster aufgebaut werden und damit einhergehende Einstellungen und Erwartungen an die Welt, sondern auch grundlegende Persönlichkeitsmuster sowie Fähigkeiten zum Lernen und Denken, handelt es sich um eine hochsensible, vermutlich sogar die wichtigste Lebenszeit, in der leider die häufigsten Kindesmisshandlungen stattfinden. Inzwischen gibt es viele Initiativen, wie das Nationale Zentrum Frühe Hilfen, die sich um den Frühbereich kümmern. Die Arbeitsfelder haben sich sehr differenziert, wie ich noch zeigen werde.
2Historische Entwicklung und gegenwärtiger Stand
Es dauerte lange, bis die Bedeutung der frühen Kindheit nicht nur innerhalb der Fachwelt, sondern auch bei aufgeklärten Bürgern ihre Anerkennung fand. Vor allem frühe entwicklungspsychologische Arbeiten mit Säuglingen und Kleinkindern führten ein eher stiefmütterliches Dasein und wurden erst in jüngerer Zeit – mit dem zunehmenden Interesse an der psychoanalytischen Säuglingsforschung – »wiederentdeckt«.
In der psychoanalytischen Bewegung gab es bereits früh Ansätze, psychoanalytische Erkenntnisse nicht nur Fachkräften, sondern auch Eltern zu vermitteln oder in der Arbeit mit kleinen Kindern umzusetzen (in Kindergärten, Kinderheimen, speziellen Beratungsstellen) (Ludwig-Körner, 1999). Bereits 1925 veröffentlichte Siegfried Bernfeld sein Buch »Psychologie des Säuglings«, in dem er die Beobachtungen an seinen Töchtern niederlegte, ein erster psychoanalytischer Versuch, die Entwicklung des Säuglings systematisch zu beschreiben. In den 1930er Jahren untersuchte der Psychoanalytiker René Spitz in seinen Hospitalismusforschungen die Auswirkungen mütterlicher Trennung auf kleine Kinder und begründete damit die psychoanalytische Säuglingsforschung, in dessen unmittelbarer Tradition Robert Emde steht sowie anerkannte Psychoanalytiker und -analytikerinnen wie zum Beispiel Serge Lebovici, Bertram Cramer, Daniel Stern, Louis Sander, Alicia Lieberman, Allen Schore, Beatrice Beebe, Inge Bretherton, Joy Osofsky, Karlen Lyons-Ruth, Edward Tronick, Peter Fonagy, Mary Target, Daniel Schechter, Arietta Slade und viele andere, die sich dieser Sichtweise seither anschlossen. Es waren vor allem Psychoanalytikerinnen, die Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapien





























