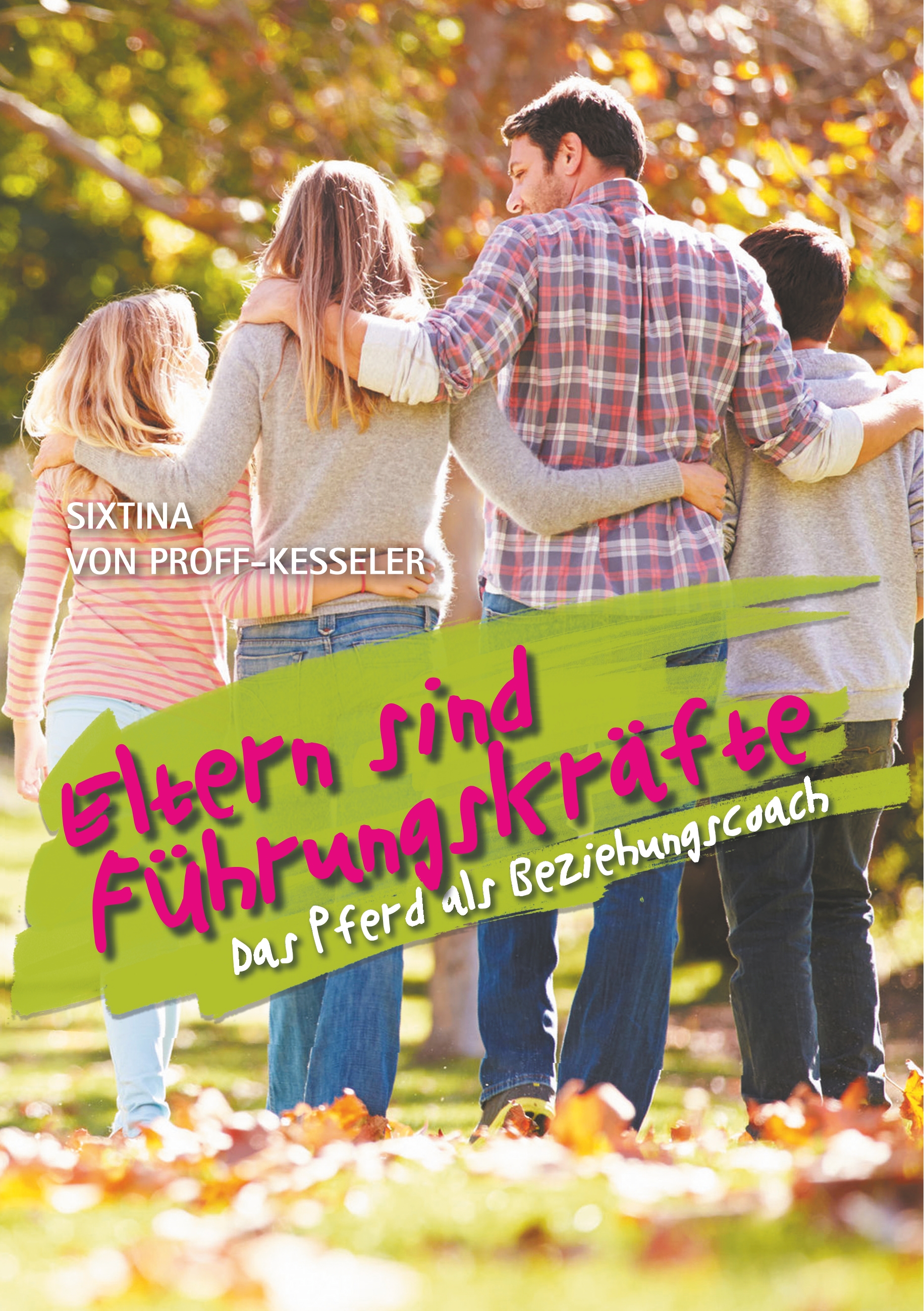
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Erziehung ist eine lebendige Herausforderung für Eltern. Ebenso lebendig ist die Art und Weise, wie die Pferde den Eltern vermitteln, worauf es eigentlich ankommt. Eltern suchen nach Orientierung für die schwierige Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Damit sind sie heute so gut wie auf sich allein gestellt, denn einheitliche Vorstellungen von Erziehung, so wie sie noch vor 50 Jahren vorhanden waren, gibt es nicht mehr. Pferde als wahre Meister der sozialen Kompetenzen und der Körpersprache bieten hier eine ganze Palette an Möglichkeiten, genau diese Orientierung zu finden und zu vermitteln. Pferde sind unbestechlich, absichtslos und authentisch. Somit durchschauen sie die Taktik und die Mechanismen unserer Handlungen und können uns unsere inneren Wirkmechanismen erfahrbar und bewusst machen. Das ist eine Chance, sich selbst besser kennen zu lernen. Pferde spiegeln den Menschen. Das nutze ich heute für meine vielfältige Arbeit mit Eltern, Erziehern und Lehrern, um nach Lösungen zu suchen, wie sie mit den ihnen anvertrauten Kindern vertrauensvoll und kompetent umgehen können. Meine Arbeit beschäftigt sich mit den "Glaubenssätzen". Die Pferde schaffen es, unsere Glaubenssätze und Lebensphilosophien, die seit der Kindheit tief in uns eingeprägt sind, wieder an die Oberfläche zu holen. So werden die eigenen Ängste und ungelebten Wünsche erfahrbar und auch spürbar und können von den Personen bearbeitet und verändert werden. Ich freue mich auf jede Stunde dieser schönen Arbeit, denn ich bin in der hier die Moderatorin, die eigentliche Arbeit machen die Pferde. Und Pferde sind wundervolle Trainer. Auch wenn Sie kein Pferd "zur Hand" haben, werden Sie vieles in dem Buch "Eltern sind Führungskräfte" entdecken, was Sie gern schon viel früher gewusst hätten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meine Tochter Maike
Inhalt
Vorwort
Hinführung
Sinnvoller Ansatz des Persönlichkeitstrainings mit Pferden
Das Sozialverhalten der Pferde
Wie alles beginnt
Kinder wollen von Anfang an am Leben teilnehmen
Das Feedback – Die Rückmeldung
Der Einfluss der Eltern auf ihr Kind
Der Einfluss der Erziehung aus der Sicht des Pferdes
Persönlichkeitsstrukturen
Persönlichkeitstraining mit Pferden
Kinder haben ein ganz klares Entwicklungsprogramm.
Der Umgang mit Aggression und Gewalt
Soziale Kompetenzen
Wie erwerben Menschen ihre soziale Kompetenz?
Beziehungsfähigkeit oder Beziehungskompetenz
Das Thema Schuld und ihre Auswirkungen
Macht und der Umgang damit
Machtspiele oder „Wenn du nicht, dann…!“
Wie sozial sind wir eigentlich?
Training für alleinerziehende Mütter und Väter
Training zur Verbesserung der Sozialen Kompetenzen
Die Pubertät, Chance oder Schreckgespenst?
Literaturliste
Danksagung
Schlusswort
Die Autorin
Sixtina von Proff-Kesseler
VORWORT
von Mathias Voelchert
Mein Bezug zu Pferden war nur kurz in meiner Jugend. Damals gingen wir Kinder in unserer ‚elternfreien Zeit’ (die eigentlich den ganzen Nachmittag dauerte) auf die Koppel und versuchten die beiden Kaltblüter zu reiten, indem wir auf den Baum kletterten, in dessen Schatten die beiden Pferde standen. Das gelang manchmal und dann saßen wir drauf und das Pferd blieb weiter stehen. Manchmal lief es weiter, mit mir drauf. Reiten im Sinne von Steuern des Pferdes war das eher nicht. Aber wir hatten viel Freude mit den riesigen, gutmütigen Pferden.
Meine nächste Begegnung begann mit dem Pferd unserer Tochter. Ihre Tierliebe hat zu ihrer Katze, zu ihrem Pferd und zu Ihrem Beruf als Tierärztin geführt. Ihre Liebe zu Pferden bescherte mir viele, manchmal aufregende Erlebnisse. Einmal brach ihr Pferd spätabends, im Schneetreiben, aus und wir beide mussten es einfangen. Auch damals wurde mir klar, dass du als Mensch das Tier nur erreichen kannst, wenn du es verstehst, klar in dir selbst bist, und mit natürlicher Autorität dem Pferd entgegen trittst. Es war eine spannende Situation: Das Pferd floh immer weiter Richtung eines Abhangs zum Flusslauf der Loisach hin, es lagen ca. 30 cm Schnee, mit jeder Menge Tiefen bis ca. 60 cm und je weiter ich dem Pferd folgte, um so weiter floh es. Schließlich schaffte ich es, mich in einem großen Bogen zwischen Pferd und Abhang zu bringen. Und mich langsam, mit einem Bund Mohrrüben in der Hand, zu nähern. Das Tier zu beruhigen, und an der Mähne in den Stall zu führen. Bis heute empfinde ich es als Geschenk, dass das Pferd letztlich mitgemacht hat. Mir wurde auch klar, dass es Persönlichkeit braucht, um mit Pferden zu arbeiten. Ähnliche Wachstumsschritte stehen Eltern bevor, wenn sie Kinder bekommen. Familie ist eine Wachstumsveranstaltung, keine Harmonieveranstaltung. Es braucht gute Führung und echte Beziehungen, damit Kinder vertrauensvoll mitmachen können.
Als mich Sixtina gefragt hat, ob ich ein Vorwort für ihr Buch schreibe habe ich sofort, und ohne es gelesen zu haben, zugesagt. Wir haben uns in der familylab-Trainerinnen-Weiterbildung kennen gelernt. Damals schon haben wir darüber gesprochen, wie man die Ansätze von familylab (Gleichwürdigkeit, Integrität, persönliche Verantwortung, Authentizität) mit ihrer Arbeit mit Pferden, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verbinden könnte. Ein Buch schien mir damals, wie heute, genau die richtige Ausdrucksform für ihre wertvolle Arbeit.
Jetzt habe ich das Buch gelesen, und ich freue mich sehr, wie professionell, mit wichtigen Zitaten aus der Wissenschaft versehen, zugewandt und persönlich Sixtina der Leserin/dem Leser ihre Erfahrungen vermittelt.
Mit klaren Worten und unterschiedlichsten Praxisbeispielen drückt sie komplizierte Beziehungszusammenhänge, leicht verständlich, aus. Immer nah am Erleben ihrer Arbeit mit Pferden und Menschen. Das tut mir als Leser gut, das erleichtert das Verstehen. Das gibt Kraft!
„Pferde sehen uns wie wir wirklich sind“ schreibt Sixtina, ich kann hinzufügen: Kinder auch. Das macht es nicht leichter, wenn wir der Meinung sind, uns verstellen zu müssen. Es macht es wesentliche einfacher, wenn wir uns entschließen, mit Aufrichtigkeit miteinander umzugehen und bereit sind dazu zu lernen.
Was es bedeutet die Führung in der Familie zu übernehmen, wird in diesem Buch deutlich. Es zeigt an vielen praktischen Beispielen, wie gute Führung – durch die Erwachsenen – gelingen kann.
Durch die deutlichen, klaren Situationsbeschreibungen, fühle ich mich fast wie ein Mitbeteiligter der Situation, der selbst mitlernt. »Eltern sind Führungskräfte« hilft dabei eigene, ausweglos erscheinende Situationen im Familienleben zu erkennen, zu reflektieren, und so Ideen zu entwickeln, was wir statt dem tun können, das bisher nicht geklappt hat.
„Die Grundlage für eine gute Führung ist die Fähigkeit, Beziehungen eingehen und sie gestalten zu können.“ schreibt die Autorin. Genau um dieses Gestalten dreht sich dieses Buch. Wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben, meine Werte zu leben, diese Werte weiter zu geben in meiner Familie. Und dabei im guten Austausch mit meiner Partnerin/meinem Partner, sowie meinen Kindern, zu bleiben. Wie das geht, lesen Sie auf den nächsten 200 Seiten bis ins Detail beschrieben.
Ja, Eltern können zu Führungskräften werden. Wie, das beschreibt Sixtina von Proff-Kessler eindrücklich in diesem Buch. Ich wünsche dem Buch und Sitxtina ganz viele Leserinnen und Leser die den größtmöglichen Gewinn aus diesem Buch ziehen können.
Ich bin überzeugt das Buch hilft, es ist eine Quelle der Inspiration!
Mathias Voelchert
Gründer und Leiter familylab.de – die Familienwerkstatt
HINFÜHRUNG
Seit ich denken kann, ist mein Leben mit Pferden verbunden.
Schon als Kind wollte ich immer reiten. Mein Vater wollte das nicht: „Das ist nichts für ein Mädchen und außerdem riecht das unangenehm!“ Daraufhin bin ich jede freie Minute zu dem benachbarten Reitstall gegangen.
Dort standen drei oder vier Pferde auf einer Koppel. Meine Freundin und ich hatten beschlossen, die zu reiten. Also eine von uns hatte ein Möhre in der Hand und lockte eines der Pferde an den Zaun, die andere hüpfte vom Zaun aus auf den Rücken des Pferdes und dann ging die Post ab. Wer es am weitesten in die Koppel hinein schaffte, hatte gewonnen. Was wir nicht wussten – das waren junge Pferde, zwei- oder dreijährig, auf denen noch nie jemand geritten ist. Irgendwann wurden wir natürlich von dem Reitlehrer erwischt. Er lachte zwar, hat uns aber das „Spiel“ verboten. Auf mein Bitten hin, dass ich doch unbedingt reiten lernen möchte, hat er mir angeboten, wenn ich jeden Tag eine Box ausmiste, dann darf ich am Sonntag eine viertel oder halbe Stunde im Schritt eines der älteren Pferde bewegen. Das habe ich bestimmt ein halbes Jahr lang gemacht. Trotz meiner logistischen Probleme – mit meinem ordentlichen „Dirndl“ aus dem Haus gehen, mich im Reitstall umziehen, ausmisten, wieder umziehen – hat es super geklappt. Mein Vater hat nichts gemerkt.
Eines Tages ritt ich (mit Erlaubnis) ein älteres Schulpferd; es hatte eine Verletzung am Bein und durfte nur im Schritt gehen: genau das Richtige für mich – dachte der Reitlehrer. Irgendwann kam der super Springreiter des Vereins mit seinem Pferd Sherif auf den Platz, galoppierte elegant an mir vorbei und als er vorbei war, galoppierte mein Pferd unaufgefordert an und hängte sich hinter ihn. Schulpferd eben. Mein Vorreiter steuerte auf die Mauer zu und sprang darüber, meine „Blume“ tapfer hinterher – sie sprang sauber über die Mauer. Ich flog gefühlte zwei Meter hoch aus dem Sattel und landete nach dem Sprung unsanft wieder in demselben.
Der Reitlehrer kam angerannt und schrie: „Du sollst Schritt reiten und doch nicht springen!“ Er rannte auf das Pferd zu, das fürchterlich erschrak, auf der Hinterhand kehrt machte und auch noch mit mir obendrauf über den Wassergraben sprang. Mir machte das nicht so viel aus, wegen meinen Reitübungen auf der Koppel war ich ja Bocksprünge der Pferde aller Art gewohnt. Irgendwie konnte ich das Pferd wieder beruhigen und jemand packte es am Zügel.
Zuerst schimpfte der Reitlehrer, musste dann aber doch anerkennen, dass ich mich doch ganz gut auf dem Pferd gehalten hatte.
Seit dem Tag durfte ich ab und zu sein Turnierpferd reiten – dieses Pferd war sein ein und alles und er band einen dünnen Bindfaden zwischen Zügel und Gebiss, das das Pferd im Maul hatte, damit ich dem Pferd nicht im Maul ziehen konnte.
Das Gefühl, auf diesem Pferd zu sitzen, war genauso schön wie Fliegen. Es machte alles, was ich ihm mit kleinen Körperbewegungen vorgab. Zu Anfang konnte ich noch nicht einmal geradeaus reiten, weil ich nicht ruhig genug oben drauf saß. Mit der Zeit habe ich das gelernt und dieses Gefühl der Harmonie begleitet mich heute noch.
Für mich bedeutet es das höchste Glück, wenn ich es schaffe, dass das Pferd mir freiwillig seine Muskelkraft zur Verfügung stellt und ich es mit feinen, fast unsichtbaren Hilfen bewegen kann.
So begann meine Arbeit mit den Pferden.
SINNVOLLER ANSATZ DES PERSÖNLICHKEITSTRAININGS MIT PFERDEN
Das Persönlichkeitstraining oder das Erfahren von sozialen Kompetenzen mit dem Pferd als Trainer erweitert alle bisher dagewesenen Persönlichkeitstrainings und Therapiemöglichkeiten.
Hier können wir Menschen nur bescheiden in den Hintergrund treten und die gewaltigen Beziehungskompetenzen und die Fähigkeiten, sofort Veränderungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren, bei den Pferden bewundern.
Wenn wir sie nutzen und von ihnen lernen wollen, brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Eine davon ist, dass die Teilnehmer bereit sind, an sich zu arbeiten. Das heißt nicht unbedingt, dass sie freiwillig kommen, aber das erleichtert den Einstieg.
Die Personen, die das Training durchführen, müssen viel „Pferdeverstand“ und vor allen Dingen „gesunden Menschenverstand“ mitbringen. Eine pädagogische Ausbildung ist nicht so wichtig, denn hier sind fast keine pädagogischen Probleme zu bearbeiten, sondern es geht fast ausschließlich um Beziehungsprobleme und um das Erkennen der eigenen Persönlichkeit und deren „Haken und Ösen“.
Das Training ist nicht für Gewaltbereite, psychisch Kranke und Menschen mit Suchtproblematik geeignet. Da bedarf es anderer Konzepte.
Die Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist hier der Motor, der das Ganze voranbringt.
Begonnen habe ich das Persönlichkeitstraining mit Pferden mit dem Training für Führungskräfte. Das kam vor ca. 25 Jahren auf den Markt. Und wie das oft bei solchen Projekten ist, war der Markt ziemlich schnell von sogenannten Manager-Trainern überschwemmt. Das Training war noch nicht sehr ausgereift und hatte oft Showcharakter; es machte zwar viel Spaß, aber erfüllte so seinen Zweck nicht.
Mit diesen Erkenntnissen habe ich die Zielgruppen verändert und ein für mich schlüssiges Konzept entwickelt. Was für Manager gut ist, kann ja für Jugendliche, Eltern, Sozialpädagogen und normale Sterbliche nicht verkehrt sein.
Es entstanden die „Sozialen Pferdestärken“. Das Konzept wurde so umgearbeitet, dass Jugendliche, die nach der Schule trotz mehrerer Bewerbungen keine Anstellung bekommen haben, hier ihre sozialen Kompetenzen erlernen und erweitern konnten.
Weiterhin entstand die „Erziehungsarena“: Hier können sich Eltern ausprobieren und selbst erfahren, wie ihr Erziehungsmodell auf die Kinder wirkt. Besonders für Eltern, die Probleme mit den Kindern haben, oder für Alleinerziehende oder getrennt lebende Väter und Mütter ist das Training sehr hilfreich.
Viel gelernt habe ich durch das Arbeiten mit Jugendlichen, denn da erlebe ich ja Menschen, die berichten können, was die Erziehung aus ihnen und mit ihnen gemacht hat. Das gab mir wertvolle Hinweise für die Arbeit mit Eltern, deren Kinder noch kleiner sind. Durch dieses Training und die vielen Gespräche wurde mir klar, dass diesen Jugendlichen oft die einfachsten Grundlagen fehlen, um eine positive Persönlichkeitsstruktur bilden zu können. Es ist meiner Meinung nach viel zu spät, erst mit 16 Jahren zu beginnen, soziale Kompetenzen zu trainieren. Um wirklich in unserer Gesellschaft etwas verändern zu können, müssen wir spätestens in der Grundschule mit den Kindern anders umgehen.
Alle diese jungen Menschen, die an dem sozialen Kompetenztraining teilgenommen haben, erzählten mir auf meine Nachfragen, dass sie sich als Kind zurückgesetzt oder nicht gut genug oder nicht gesehen oder nicht anerkannt fühlten. Sie hatten oft das Gefühl, klein und hilflos oder sogar unerwünscht zu sein. Viele der Jugendlichen hatten Gewalt innerhalb der Familie erlebt. Einige bekamen fast alles, was sie wollten, nur nicht das, was sie sich sehnlichst gewünscht hätten–Wärme und Geborgenheit. Sie hatten das Gefühl, mit großen Geschenken ruhiggestellt zu werden. Die Familien vieler Jugendlicher, die an dem Training teilnahmen, wurden lange Zeit vom Jugendamt betreut. Jedoch konnte diese Betreuung durch das Jugendamt das Leben für die Jugendlichen nicht wesentlich verändern. Dazu war die Betreuung in der Regel zu lückenhaft und war mehr darauf ausgerichtet, den Haushalt zu organisieren, das Geld zu verwalten und rechtliche Fragen zu klären, als die Erziehung der Kinder zu unterstützen. Und es fehlte eine tragfähige Beziehung des betreuenden Sozialarbeiters zu der Familie.
Heute heißt es zwar überall „Sozialarbeit ist Beziehungsarbeit“. Aber um tatsächlich eine Beziehung herstellen zu können, ist die Zeit meist zu kurz, in der der Sozialpädagoge die Familie betreut; auch die Abstände der Betreuungsstunden ist i.d.R. zu groß. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der zu betreuenden Familien pro Sozialarbeiter einfach zu hoch ist.
Sozialarbeit – wie wir sie kennen – beginnt ja erst, wenn die Kinder auffällig sind. Das heißt für mich, Sozialarbeit hat den Charakter einer „Reparaturwerkstatt“. Statt Prävention – durch gute Angebote und gute Trainingsmöglichkeiten vorzubeugen – wird lieber noch eine neue Beratungsstelle eröffnet, wenn das Kind buchstäblich in den Brunnen gefallen ist.
Nein, für mich bedeutet Prävention, Aufklärung und Information möglichst in Form von Workshops bereitzustellen, und zwar nicht unbedingt kostenlos, sondern evtl. im Rahmen der VHS oder auch beim Jugendamt etc. Und bei der Ausbildung der Erzieher und Lehrer sollten neue Themen hinzukommen. Da wird noch überwiegend im pädagogischen Bereich gearbeitet. Hier sind jedoch die Eltern den meisten Lehrern weit voraus. Es sind oft die Beziehungsprobleme, die hier zu Auffälligkeiten bei den Kindern führen. Damit tritt ein wichtiges Thema in den Vordergrund: Wo spielt die eigene Persönlichkeitsstruktur eine Rolle, wo habe ich meinen blinden Fleck?
Die Schuld bei den Eltern zu suchen führt ebenfalls in eine Sackgasse. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Die Eltern versorgen die Kinder so gut sie eben dazu in der Lage sind.
Interessant war für mich zu erfahren, dass die Fähigkeit, Kinder zu erziehen, offenbar keine angeborene, sondern eine erlernte Fähigkeit ist.
[Dies bestätigt Gerald Hüter in seinem Buch „Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn“, S. →, 5. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht 2005, in dem er einen Versuch mit Ratten beschreibt.]
Es gibt Rattenmütter, die sich gut, also sozial um ihre Jungtiere bemühen, und andere, die sich wenig um die Jungen kümmern; Letztere überlassen ihre Jungen überwiegend sich selbst.
Wenn nun direkt nach der Geburt die Hälfte der weiblichen Jungtiere vertauscht wird, so werden die Jungtiere von der sozialeren Rattenmutter deren Fähigkeiten übernehmen, die anderen werden zu schlechten Müttern.
Stellt man nun eine Gruppe zusammen, die aus gleich vielen guten und schlechten Müttern besteht, so überwiegen bald die schlechteren Mütter, da das Gehirn der Tiere einfacher aufgebaut ist und diese mehr Aggressivität an den Tag legen. Somit pflanzen sich diese Tiere mit dem unsozialen Verhalten auch mehr fort und die „guten“ Mütter verschwinden von der Bildfläche. So sitzen die Ratten in ihrer eigenen Falle und werden sich auf diesem Gebiet nicht weiterentwickeln. Dazu braucht es dann Veränderungen von außen, so dass die sozialeren Mütter im Vorteil wären.
Da das Gehirn der Menschen ja die gleichen Ursprünge hat wie das der Ratten, verhält es sich bei den Menschen nicht anders. Ebenso ist es bei den Pferden, auch diese erlernen den Umgang miteinander nur im sozialen Kontext.
Bei den Pferden spielt die Evolution nicht ganz so eine große Rolle, da ja der Mensch die Eltern aussucht. Aber auch hier hat sich gezeigt, so lange die Menschen bei der Zucht nur auf größtmögliche Bewegungsmöglichkeit und Schönheit der Pferde geachtet haben, wurden Pferde gezüchtet, die so schwierig im Umgang waren, dass sie keiner mehr reiten konnte. Auch Pferde sind ganzheitlich zu betrachten.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen: Die Pferde, die ich zur Korrektur bekommen habe, die nicht in einem sozialen Verband aufgewachsen waren, denen fehlte ebenfalls die soziale Kompetenz. Das hatte zur Folge, sie konnten nicht einfach in eine Pferdeherde integriert werden, sondern mussten erst mit einem sehr friedfertigen Pferd zusammen erlernen, wie Pferde miteinander umgehen.
Solche Pferde eignen sich z.B. nicht für das Persönlichkeitstraining.
Persönlichkeitstraining mit Pferden ermöglicht eine ganzheitliche Erfahrung. Deswegen brauche ich oft nur ein oder zwei Trainingseinheiten, um zu vermitteln, was eine Änderung des Verhaltens ermöglicht. Denn das Pferd berührt uns da, wo die Veränderungen stattfinden – unser Unterbewusstsein oder eben unsere Seele.
Das, was wir praktisch und am eigenen Leibe erfahren, hinterlässt ganz andere Spuren als das, was wir lesen, hören oder sehen und vielleicht nicht wahrhaben oder glauben möchten.
Das ist so, als ob ich Ihnen erzähle, wie eine gebratene Banane schmeckt. Sie haben so etwas noch nie gegessen und es klingt für Sie nicht sehr verlockend. Wenn Sie jetzt sagen: „Gut, ich probiere mal!“, dann können Sie selbst entscheiden, ob Ihnen das schmeckt oder ob nicht.
Jetzt haben Sie eine Erfahrung mehr und Ihr Leben hat sich verändert, ob Sie wollen oder nicht.
DAS SOZIALVERHALTEN DER PFERDE
Wer führt wen?
Zuerst erzähle ich Ihnen jetzt etwas vom Pferd:
Pferde leben in einem Herdenverband; die Gruppe bietet ihnen Schutz gegen Raubtiere und ermöglicht das Aufziehen der Fohlen. Grundsätzlich wird ihr Zusammenleben von ehrlichen, authentischen und vor allem durch möglichst reibungsarme Auseinandersetzungen geprägt.
Die Evolution hat das schlau eingefädelt: Ein Teil der zum Überleben wichtigen Informationen ist schon in den Genen fest verankert, der andere Teil, dazu gehört überwiegend das Sozialverhalten, wird erlernt, abgeschaut und nachgemacht. Das haben Pferde und Menschen gemeinsam: Das Sozialverhalten wird in den Familien weitergegeben. Soziale Vererbung wird das auch oft genannt, obwohl es nicht vererbt, sondern erlernt und dann an die Nachkommen weitergegeben wird.
Pferde brauchen sich gegenseitig. Ein Pferd allein fühlt sich unwohl und sucht den Kontakt zu den anderen. Damit Verletzungen bei Streitigkeiten möglichst vermieden werden, haben die Pferde eine ganz klare Körpersprache entwickelt, mit der sie sich verständigen.
Wenn sich z.B. zwei fremde Pferde begegnen, dann haben sie vorher schon abgecheckt, wie sie den anderen einschätzen müssen. Das erkennen sie sofort an der Haltung des anderen, an dessen Körperspannung und an der Atmung. Zur Begrüßung werden die Nüstern aneinandergedrückt, wenn sie sich mögen, dann geht jeder seines Weges. Wenn sie erst noch diskutieren, wer das Sagen hat, wird erst einmal gequiekt und mit dem Vorderbein ausgeschlagen. Dann scheinen sie immer größer zu werden und dann gehen sie entweder auseinander oder es gibt eine Rangelei.
Oder wenn das Pferd noch weiter entfernt ist, dann legt es die Ohren an; und wenn das den anderen nicht zu einer Reaktion veranlasst, dann wird der Kopf gehoben, dann der Hals in Richtung des anderen geschlenkert. Wenn das alles auch nichts hilft, dann dreht sich das Pferd um und hebt das Hinterbein, oder es schlägt deutlich aus. Meistens reicht das Halsschlenkern schon aus, um die Situation zu klären.
Bei den Pferden wird wenig um die ersten und die letzten Ränge gekämpft. Die sind meistens klar. Rangeleien gibt es mehr in der Mitte, da ändern sich die Plätze auch gelegentlich.
Pferde gehen Freundschaften ein; genauso gibt es Feinde unter den Pferden, die sich einfach nicht leiden können.
Pferde haben ihr gut funktionierendes Sozialverhalten trotz der langen Domestikation nicht verlernt. Wenn wir sie auf die Wiese stellen und sich selbst überlassen, kommen sie bei ausreichend Futter und Wasser wunderbar ohne den Menschen zurecht.
Was macht die Pferde denn jetzt zu so guten Persönlichkeitstrainern?
Ganz einfach:
Pferde sind authentisch, ehrlich, frei von Vorurteilen und absichtslos in ihrem Urteil. Sie schätzen den anderen aufgrund der jahrtausendelang weitervererbten und erlernten Einschätzung der Körpersprache ein.
Das heißt, sie halten uns einen Spiegel vor.
Pferde leben in kleinen familienähnlichen Herdenverbänden mit einer klar geregelten Organisation.
Es gibt eine Leitstute – sie hat die Führung –, dann Pferde verschiedenen Alters und einen Leithengst; der ist für die Sicherheit nach außen zuständig. Also eine klare Rollenverteilung.
Damit in der Herde Ruhe und Ordnung herrscht, gibt es eine klare Rangordnung.
Diese wird durch Gesten oder auch mal kurze heftige Rangeleien ausgetragen. Dann wird sie akzeptiert und durch kleine Rituale immer wieder überprüft.
Diese Rituale können sein, den Rangniederen von der Fressstelle wegzujagen oder – wenn er sich hingelegt hat – ihn wieder aufzuscheuchen.
Oder aber der eine „nervt“ ganz einfach und bekommt kurz und bündig Bescheid gesagt.
Es gibt auch ganz simple Gesten: z.B. der Rangniedere dreht den Kopf weg oder er kreuzt die Vorderbeine. Dies zeigt dem anderen an, dass er noch als ranghöher gilt.
Solche Rituale haben wir in unseren Familien auch. Es gibt einen Chefsessel beim Fernsehen für den Chef – ohne Diskussion. Und es gibt jemanden, der bestimmt, was und wie viel ferngesehen wird. Wer bekommt das größte Stück Kuchen? Wer sagt, wohin die Urlaubsreise geht? Wer bestimmt über das Geld – ein ganz wichtiger Punkt.
Pferde brauchen kein Geld, sie brauchen Futter und Wasser zum Überleben. Die Führung in der Herde sorgt dafür, dass diese Grundlage allen möglichst ausreichend zur Verfügung steht.
Soziales Zusammenleben macht zwar den Anschein, als ob alle gleichberechtigt sind, aber das ist nicht so. Es benötigt immer eine Führung, denn ohne Führung entsteht Chaos. In einem harmonischen Herdenverband sind alle gleichwürdig, aber nicht gleichberechtigt.
Wer über das Geld oder über das Futter bestimmt, der hat also die Führung. Aber wir können daran nicht erkennen, ob es eine gute Führung ist. Was bedeutet denn Führung?
In dem Falle die der Leitstute:
Sie ist ständig auf der Suche nach guten Futterplätzen.
Sie hält ständig Ausschau, ob sich Feinde nähern.
Sie muss den Tag so einteilen, dass möglichst morgens und abends Wasserstellen in der Nähe sind.
Sie achtet darauf, dass die rangniederen Pferde im Schutz ihrer Nähe fressen und saufen können.
Sie schlichtet Streitereien in der Herde, indem sie sich zwischen die Streithähne stellt. Sie muss sich oft auch Auseinandersetzungen mit anderen Stuten stellen, die ihren Platz einnehmen wollen.
Sie kann nur schlafen, wenn ein anderes geeignetes Pferd die Wache übernimmt.
Die Führung ist gut, wenn es allen Herdenmitgliedern gut geht. So einfach ist das! Führen heißt also in erster Linie dienen. Führung ist anstrengend. Was hat jetzt die Führung mit Beziehung und sozialer Kompetenz zu tun?
Sehr viel, denn jeder von uns ist eine Führungskraft, denn er oder sie führt ja zumindest sich selbst. Wie diese „Selbstführung“ aussieht, wird hauptsächlich über das Unterbewusstsein bestimmt. Denn wir führen uns so, wie wir uns selbst sehen, und das hängt auch davon ab, was wir uns zutrauen.
Wenn ich mich klein und hilflos fühle, dann wird auch meine eigene Führungskraft dementsprechend sein. Fühle ich mich stark und vertraue auf meine Fähigkeiten, dann wird meine Führung auch davon profitieren.
Es läuft also alles auf den einen Punkt hinaus, auf dem alles andere aufbaut – unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst.
Hier kommen die Pferde ins Spiel, sie sind quasi unser Spiegel. Jeder von uns hat ja mindestens drei Persönlichkeiten:
so, wie wir wirklich sind
so, wie die anderen uns sehen
so, wie wir gern sein möchten
Wie sieht uns jetzt das Pferd? Das sieht uns so, wie wir wirklich sind.
Pferde achten auf ganz andere Dinge als wir Menschen.
Das Pferd interessiert nicht, welches Auto wir fahren oder wie wir gekleidet sind; auch nicht, ob wir dick oder dünn, hübsch oder hässlich sind. Pferde interessieren sich zuerst einmal dafür, in welcher Beziehung sie zu uns stehen. Also schätzt das Pferd sein Gegenüber als ranghöher oder als rangniedriger ein. Da das Pferd sofort die Haltung, die Muskelspannung und auch die Atmung beachtet, hat es schon einen ersten Eindruck.
Folgendes ist mir passiert: Ich ritt mit meinem Pferd in einer fremden Reithalle. Am Rand liefen viele Leute hin und her. Plötzlich nahm mein Pferd Haltung an: Es bekam eine andere Körperspannung und beobachtete einen Herrn, der gerade die Halle betreten hatte. Das war der Reitmeister persönlich, der nur durch sein Auftreten, also seine Haltung und seine „Aura“, sofort klarstellte, dass er ernst zu nehmen ist.
Pferde testen die Rangfolge immer wieder.
Ich führe z.B. mein Pferd auf die Weide: Es geht dann immer hinter mir – ich führe, denn ich weiß ja, wohin wir wollen, und das Pferd folgt mir. Ab und zu schleicht es sich immer mehr nach vorn und probiert auch mal die Richtung zu wechseln. Dann schicke ich es freundlich wieder auf seinen Platz. Es dauert nicht lange, dann versucht das Pferd es wieder.
Das machen unsere Kinder auch so. Sie fragen immer wieder: „Mama, darf ich Fernsehen?“ Die Antwort kennen sie schon. Oder sie lassen immer wieder die Schuhe direkt hinter der Türe liegen, obwohl sie natürlich genau wissen, dass sie weggeräumt werden müssen. Aber vielleicht wendet sich ja mal das Blatt und sie können das an die Eltern oder älteren Geschwister delegieren. Damit wären sie in der Rangordnung aufgestiegen.
Das ist ja das Bestreben eines jeden sozialen Wesens. Den Letzten beißen die Hunde, auf dem letzten Platz möchte keiner ewig bleiben. Außerdem versprechen höhere Ränge bessere Nahrung und ein einfacheres Leben. Ob das tatsächlich so ist, ist eine ganz andere Frage – es ist so in unserer Vorstellung.
Unsere Vorstellung bestimmt, was richtig und was falsch ist, und nicht die Tatsachen.
Die Verbindung zwischen Führung und Erziehung.
Wenn ich mich selbst nicht kenne, dann kenne ich auch meine Stärken und Schwächen nicht. Das ist aber die Voraussetzung, um eine gute Selbstführung zu haben. Und ohne die kann ich niemand anderen führen oder erziehen.
Das, was Pferde für das Erziehungstraining mit Eltern, Sozialpädagogen so wertvoll macht, ist gerade diese Eigenschaft, sich nicht auf die Spielchen einzulassen, die wir Menschen so gern spielen.
Mit den (unbewussten) Spielchen meine ich Folgendes:
Sich schwach zeigen, um an die Hilfsbereitschaft des anderen zu appellieren.
Sich hilflos stellen, um den anderen in seiner Stärke zu bestätigen und um dann umsorgt zu werden.
Sich groß und stark präsentieren, damit die anderen gar nicht erst aufmucken.
Sich selbst beweihräuchern und loben, weil es sonst kein anderer tut.
Machen Sie das mal bei einem Pferd, z.B. sich schwach und hilflos anstellen – das Pferd nutzt das sofort aus und übernimmt die Führung.
Oder tun Sie so, als ob Sie groß und stark sind, das Pferd testet das erst einmal aus.
Sie sind ja nicht wirklich hilflos und schwach, aber sie sehen sich so. Sie sind ja nicht wirklich groß und stark – aber Sie haben gelernt, dass es dann Aufmerksamkeit und vielleicht etwas Macht gibt.
Das Pferd sieht hinter die Kulisse – so wie es wirklich in Ihnen aussieht. Hier ein Beispiel:
Ein Vater kommt zu mir und sagt, er komme mit seinem Sohn nicht mehr zurecht. Auf meine Frage, wie alt denn der Sohn sei, sagt er 9 Jahre. Er erzählt mir, dass er versuche, dem Sohn eine gute Erziehung angedeihen zu lassen, aber das klappe nicht. Er erzählt weiter, dass er das Gefühl hat, seine Frau sabotiere seine Erziehung und der Sohn könne bei ihr machen, was er wolle. Als Beispiel nennt er Freunde besuchen und über Nacht bleiben. Wenn er sage, der Sohn darf das nicht, dann geht der zur Mama und fragt die. Sie erlaube ihm das Übernachten dort sofort.
„Was passiert dann“, frage ich. „Dann streite ich mit meiner Frau, und meistens geht es dann nach ihrem Willen.“
„Gibt es noch andere Punkte, in denen ihr euch uneinig seid, oder ist „das Auswärts-Übernachten“ der einzige?“ frage ich nach.
„Nein, sonst haben wir eigentlich keine Probleme, da können wir uns gut absprechen, bloß in diesem Punkt, da können wir uns nicht einigen.“
„Habt ihr darüber schon gesprochen, warum deine Frau denn das sofort erlaubt?“, frage ich weiter. „Ja, sie findet, dass ich zu streng bin und dass ihm das Woanders-Übernachten doch guttut. Wir wohnen ja etwas außerhalb, so dass alles mit den Spielkameraden organisiert werden muss. Und er ist ein Einzelkind.“ „Findest du das Übernachten bei Freunden grundsätzlich schlecht, oder sind das spezielle Freunde, zu denen er nicht gehen soll?“, frage ich ihn.
„Es geht mir grundsätzlich darum, dass er noch zu Hause bleibt, da ich ja nicht weiß, was in den anderen Familien üblich ist“, antwortet Hans.
Woran liegt es denn jetzt eigentlich? Ist der Vater da zu streng oder die Mutter zu großzügig? Oder gibt es einen ganz anderen Hintergrund?
Jetzt muss das Pferd in den Ring. Zuerst absolviert Hans das übliche Kennenlerntraining und bekommt eine Einweisung in das Verhalten des Pferdes.
Hans ist sehr klar im Umgang mit dem Pferd. Er bleibt aber trotzdem distanziert und ist sehr bemüht immer die Kontrolle zu behalten. Das Pferd folgt ihm, bleibt sofort stehen, wenn Hans anhält. Es entsteht keine Beziehung, deutlich daran zu erkennen, in welche Richtung sich die Pferdeohren drehen – die sind immer woanders, aber nicht bei Hans. Es sieht so aus, als ob das Pferd auf eine Möglichkeit wartet, sich aus dem Bereich von Hans zu entfernen.
„Wie ist denn deine Beziehung zu deinem Sohn und deiner Frau?”, frage ich ihn.
„Die ist gut, wir unternehmen viel zusammen und wir sprechen über alles“, antwortet Hans.
„Findest du, dass das Pferd seine Sache bis jetzt gut gemacht hat?”, frage ich ihn. „Ja, der ist ja ganz artig“, antwortet Hans. „Magst du das Pferd streicheln und ihm sagen, dass es seine Sache bis jetzt gut gemacht hat“, bitte ich ihn.
Er dreht sich zu dem Pferd und streichelt ihn so mit den Fingern am Hals, sieht ihn aber dabei nicht an und er tut es sichtlich ungern.
„Meinst du, das Pferd genießt dein Steicheln?”, frage ich ihn. Hans guckt mich verständnislos an. Er nickt dann: „Klar, streicheln genießt doch jeder“, sagt er dann. „Guck das Pferd mal an, was macht er für einen Eindruck auf dich?” Hans guckt das Pferd an. „Ja, er bleibt doch stehen und er genießt das.“ „Guck mal, das Pferd hat den Hals ganz hart gemacht, es hat den Kopf so weit wie möglich oben und ist überhaupt nicht entspannt. Jetzt streichele ihn mal so, dass er sich entspannt und dass es ihm guttut. Das heißt, du tust da alles an Liebe und Zuwendung, die du für ihn hast, in dein Streicheln hinein!“ „Ich versuch es“, meint Hans.
Er streichelt, steht aber immer noch einen Meter weit weg vom Pferd und guckt dabei fast nur auf den Boden. „Wie möchtest du gestreichelt werden, damit du dich entspannen kannst?“, frage ich ihn. „Entspanne dich selbst, mach deine Hände ganz weich und stell dir vor, du würdest das Pferd mit etwas Öl einreiben.“ Hans weiß nicht so recht, wie er sich entspannen soll. Ich lasse ihn eine Weile und dann beginnen wir noch einmal mit dem Führen. Jetzt kommen weitere Aufgaben dazu, z.B. über eine Plane gehen etc. Es fällt auf, dass die Situation immer angespannter wird. Hans wird immer genauer, das Pferd soll genau dorthin treten, wo er sich das vorstellt, bis das Pferd stehenbleibt. Hans zieht energisch am Strick, das Pferd bewegt sich nicht.
Die Anspannung steigt und ich breche das Training erst einmal ab. „Machst du das Pferd mal vom Strick ab“, bitte ich ihn. Er tut es und das Pferd flieht in die hinterste Ecke der Halle. Hans geht ihm nach und möchte ihn wieder einfangen, aber das Pferd flüchtet wieder vor ihm.
Jetzt haben wir einen Anhaltspunkt gefunden, der aufzeigt, woher das Problem mit dem Auswärts-Übernachten kommen könnte.
Hans ist entsetzt, so hat er seine Korrektheit noch gar nicht betrachtet. „Ich möchte doch nur, dass aus meinem Sohn etwas wird, deswegen verlange ich schon, dass er alle Sachen korrekt macht. Dass das der Grund dafür sein könnte, dass er so gern woanders übernachtet, daran habe ich noch gar nicht gedacht.“ Er grübelt und geht in Gedanken nach Hause.





























