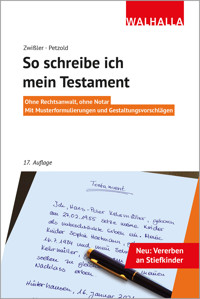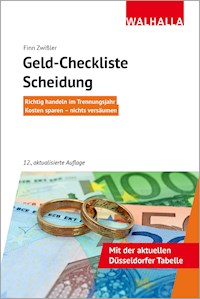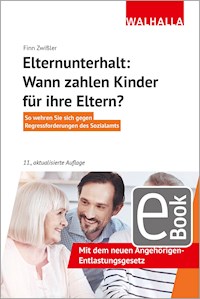
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sozialhilferegress vermeiden
Immer häufiger nimmt das Sozialamt gut verdienende Kinder in die Pflicht, wenn Eltern Sozialhilfe erhalten. Der Fachratgeber Elternunterhalt: Wann zahlen Kinder für ihre Eltern? klärt auf:
- Unterhaltsansprüche von Eltern gegenüber Kindern
- Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten
- Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten
- Unterhaltsumfang
- Regressforderungen des Sozialamts
- Sozialhilferegress bei Schenkungen unter Lebenden und bei erbrechtlichen Ansprüchen
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung des Sozialhilferegresses
- Düsseldorfer Tabelle
Ausgewählte Gerichtsentscheidungen veranschaulichen die konkrete Anwendung des Rechts und helfen bei der Orientierung,
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
11. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Sozialhilferegress vermeiden
Immer häufiger nimmt das Sozialamt gut verdienende Kinder in die Pflicht, wenn Eltern Sozialhilfe erhalten. Der Fachratgeber Elternunterhalt: Wann zahlen Kinder für ihre Eltern? klärt auf:
Unterhaltsansprüche von Eltern gegenüber KindernLeistungsfähigkeit des UnterhaltsverpflichtetenBedürftigkeit des UnterhaltsberechtigtenUnterhaltsumfangRegressforderungen des SozialamtsSozialhilferegress bei Schenkungen unter Lebenden und bei erbrechtlichen AnsprüchenGestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung des SozialhilferegressesDüsseldorfer TabelleAusgewählte Gerichtsentscheidungen veranschaulichen die konkrete Anwendung des Rechts und helfen bei der Orientierung,
Autor
Finn Zwißler ist Rechtsanwalt in München; Experte für Ehe- und Familienrecht; erfolgreicher Fachautor.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Unterhaltsansprüche
2. Auskunftspflicht des Unterhaltsschuldners
3. Leistungsfähigkeit
4. Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs
5. Unterhaltsumfang
6. Rangordnung der Unterhaltspflichtigen und der Bedürftigen
7. Unterhaltsverzicht, Erlöschen des Unterhaltsanspruchs
8. Sozialhilferegress
9. Angehörigen-Entlastungsgesetz
10. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
11. Gesetze, die Sie kennen sollten
12. Grundlegende Entscheidungen zum Elternunterhalt
13. Hilfreiche Adressen
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Unterhaltspflicht von Kindern
Abkürzungen
Unterhaltspflicht von Kindern
In der Bevölkerung war lange weitgehend unbekannt, dass auch Kinder ihren Eltern gegenüber unterhaltspflichtig sind. Die aktuelle Diskussion jedoch rückt diesen Umstand mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht die Unterhaltspflicht von Kindern gegenüber den Eltern ebenso vor wie die Unterhaltspflicht von Eltern gegenüber ihren Kindern.
Sicherlich ist in der Praxis der Fall seltener, dass Eltern auf ihre Kinder zugehen und von diesen Unterhalt einfordern oder diesen gar gerichtlich geltend machen. Das liegt in der naturgegebenen und gesellschaftlich verankerten Verantwortung der Eltern gegenüber ihren Kindern und darin, dass die Bedürftigkeit der Eltern nach einem langen Berufsleben seltener eintritt als die von Kindern.
Verstärkt tritt jedoch gegenwärtig und zukünftig eine Bedürftigkeit der Eltern auf – verursacht durch die hohe Lebenserwartung bei dem allmählichen Scheitern des Rentensystems.
In aller Regel wenden sich die Eltern zunächst an den Träger der Sozialhilfe. Die staatlichen Kassen sind angesichts einer hohen Anzahl von Sozialhilfeempfängern leer. Das Sozialamt tritt zwar vorübergehend in der Notsituation ein, haftet gegenüber dem Kind als Unterhaltsschuldner jedoch nur nachrangig und fordert daher grundsätzlich Regress von den Kindern bzw. scheut auch nicht davor zurück, notfalls die Gerichte einzuschalten.
Das gilt nicht nur, wenn die Eltern zu Lebzeiten oder auch für den Fall des Todes ihren Kindern Vermögensgegenstände zugewandt haben, wodurch sie bedürftig geworden sind. Vielmehr wird auch von dem Kind Regress gefordert, das von seinen Eltern bisher nicht bedacht wurde.
Mit Einführung der sogenannten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, vor allem aber durch das Inkraftreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes, ist zwar das Problem des Elternunterhalts bzw. des Sozialhilferegresses deutlich entschärft, aber nicht beseitigt worden. Der Elternunterhalt aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch besteht nach wie vor in vollem Umfang, ebenso der Sozialhilferegress gegenüber Kindern, die mehr als 100.000 Euro brutto jährlich verdienen, sowie bei Schenkungen.
Zudem sind gerade in jüngerer Zeit einige für Kinder negative BGH-Entscheidungen ergangen. Ausgewählte, maßgebliche Entscheidungen zum Thema werden in Kapitel 12 kurz erläutert.
Generell, aber insbesondere in den Fällen der Schenkungen unter Lebenden bzw. der vorweggenommenen Erbfolge, besteht ein legitimes Interesse daran, eine vertragliche Gestaltung zu wählen, mit welcher der Sozialhilferegress möglichst vermieden wird.
Der vorliegende Ratgeber führt in die einzelnen Problembereiche des Elternunterhalts ein, einschließlich des Sozialhilferegresses bei nicht nachgekommener Unterhaltspflicht, bei Schenkungen bzw. gegenüber Erben und befasst sich mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz sowie mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Finn Zwißler
Finn ZwißlerNeuhauser Straße 2780331 MünchenTel.: 0 89/55 02 73 11Fax: 0 89/55 02 73 13E-Mail: [email protected]: www.rechtsanwalt-zwissler.de
Abkürzungen
Abs.AbsatzAz.AktenzeichenBGBBürgerliches GesetzbuchBGBl.BundesgesetzblattBGHBundesgerichtshofBSHGBundessozialhilfegesetzDNotZDeutsche Notar-ZeitschriftNZFamNeue Zeitschrift für FamilienrechtOLGOberlandesgerichtSGB VISozialgesetzbuch Sechstes Buch – Gesetzliche RentenversicherungSGB XII Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe1. Unterhaltsansprüche
Unterhaltsansprüche unter Verwandten
Unterhaltsansprüche der Eltern gegen ihre Kinder
Unterhaltsansprüche unter Verwandten
Auf die Verwandtschaft in gerader Linie kommt es an. Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren (§ 1601 BGB).
Verwandtschaft und Schwägerschaft
Verwandtschaft
In gerader Linie verwandt sind Personen, bei denen eine von der anderen abstammt (Eltern/Kinder). Personen, die nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt (Geschwister). Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten (§ 1589 BGB).
Schwägerschaft
Von der Verwandtschaft zu unterscheiden ist die Schwägerschaft. Schwägerschaft entsteht zwischen einem Ehegatten und den Verwandten des anderen Ehegatten. Die Linie und der Grad der Schwägerschaft bestimmt sich nach der Linie und dem Grad der sie vermittelnden Verwandtschaft. Die Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die sie begründet wurde, aufgelöst ist (§ 1590 BGB).
Damit sind nicht nur Eltern gegenüber ihren Kindern unterhaltspflichtig. Vielmehr sind alle in gerader Linie miteinander Verwandten, sei es absteigend oder aufsteigend, gegenseitig unterhaltspflichtig. So sind die Kinder gegenüber den Eltern unterhaltspflichtig und grundsätzlich auch gegenüber den Großeltern, wobei Letztere in der Praxis aufgrund der sozialhilferechtlichen Vorschriften im Grunde ausscheiden.
Keine Unterhaltspflicht gegenüber Geschwistern und Verschwägerten
Die Unterhaltspflicht erstreckt sich dagegen nicht auf Verwandte in der Seitenlinie, so dass es keine gesetzliche Unterhaltspflicht gegenüber Geschwistern gibt.
Ebenso besteht unter Verschwägerten keine Unterhaltspflicht, genauso wie zum Beispiel der Stiefvater gegenüber den Stiefkindern grundsätzlich nicht unterhaltspflichtig ist.
Zudem hat der BGH in seiner neueren Rechtsprechung keine „verschleierte Schwiegersohnhaftung“ begründet, indem er entschieden hat, dass bei der Inanspruchnahme einer Tochter für den Unterhalt ihrer Mutter auch das Einkommen des Ehemanns der Tochter von Bedeutung sein kann.
Keinesfalls wurde damit entschieden, dass der Schwiegersohn an die Schwiegermutter Unterhalt zahlen müsste.
Allenfalls könnte man von einer mittelbaren oder indirekten „Haftung“ des Schwiegersohns sprechen, da die Tochter wegen des hohen Gehalts des Schwiegersohns an ihre Mutter und damit die Schwiegermutter des Schwiegersohns Unterhalt bzw. einen höheren Unterhalt bezahlen muss.
Darüber hinaus ist grundsätzlich anteilig das Taschengeld eines Ehegatten für den Elternunterhalt einzusetzen, etwa das Taschengeld, das die Tochter von ihrem Ehemann, das heißt dem Schwiegersohn erhält.
Unterhalt bis an das Lebensende
Die Unterhaltspflicht ist grundsätzlich von unbegrenzter Dauer, solange die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten und die Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten bestehen.
Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit
Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (§ 1602 BGB). Danach kommt es darauf an, ob der den Unterhalt verlangende Verwandte bedürftig ist.
Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren (§ 1603 BGB). Beim Unterhaltsverpflichteten ist somit dessen Leistungsfähigkeit ausschlaggebend.
Zur Höhe des Selbstbehalts von Unterhaltsansprüchen der betagten Eltern gegenüber ihren erwachsenen Kindern, die ihrerseits Familien gegründet und Kinder großgezogen haben, hatte der BGH bereits mit Urteil vom 26.02.1992 (Az. XII ZR 93/91) grundsätzlich entschieden.
Danach hat das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 07.06.2005 (Az. 1 BvR 1508/96) zu den verfassungsrechtlichen Grenzen des Elternunterhalts nach Übergang auf den Sozialträger entschieden. Darin wird der grundsätzliche Nachrang des Elternunterhalts sichtbar.
Unterhaltsansprüche der Eltern gegen ihre Kinder
Unterhaltspflicht Eltern – Kind und Kind – Eltern
Nach § 1601 BGB schulden nicht nur die Eltern ihren Kindern Unterhalt, sondern auch die Kinder ihren Eltern. Das gilt für ein Leben lang unter der Voraussetzung, dass die Kinder leistungsfähig und die Eltern bedürftig sind. Darüber hinaus haftet der Ehegatte des unterhaltsbedürftigen Elternteils stets vorrangig.
Sozialhilferegress
Übergang des Unterhaltsanspruchs der Eltern
Wenn und soweit das Sozialamt für einen unterhaltsbedürftigen Elternteil einspringt, geht der Unterhaltsanspruch des Elternteils gegen das Kind nach § 94 Abs. 1 SGB XII auf das Sozialamt über, genauer gesagt, auf den Träger der Sozialhilfe, mit der Folge, dass das Sozialamt den Unterhalt für die Eltern bei den Kindern einfordert. Etwas anderes gilt nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz (vgl. Kapitel 9) bzw. bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (vgl. Kapitel 10).
Kein Sozialhilferegress bei Unterhaltsanspruch der Großeltern
Gemäß § 94 Abs. 1 Satz 3 SGB XII ist bei Ansprüchen von Großeltern gegen die Enkel ein Anspruchsübergang ausgeschlossen.
Rückforderung von Sozialhilfeleistungen
Wenn ein Kind einem unterhaltsbedürftigen Elternteil freiwillig keinen Unterhalt bezahlt, springt – damit der Elternteil überleben kann – das Sozialamt ein und bezahlt an den unterhaltsbedürftigen Elternteil Unterhalt. Diese Unterhaltsleistungen können vom Sozialamt auf dem Weg des Regresses von dem unterhaltspflichtigen Kind bzw. den unterhaltspflichtigen Kindern zurückgefordert werden. Ausnahmen gelten nach dem Angehörigen-Entlastungsgesetz (vgl. Kapitel 9) bzw. bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (vgl. Kapitel 10).
Enge Voraussetzungen des Unterhaltsanspruchs der Eltern (Nachranggrundsatz)
Die Voraussetzungen eines Unterhaltsanspruchs der Eltern gegen die Kinder sind jedoch in der Praxis deutlich enger als für den Unterhaltsanspruch der Kinder gegenüber den Eltern.
Das liegt daran, dass sich – anders als die Eltern, wenn sich diese ein Kind wünschen – die Kinder nicht auf eine Unterhaltsleistung ihrer Eltern eingestellt haben und darüber hinaus durch Sozialabgaben und Steuern ohnehin bereits umfangreich zur Finanzierung der älteren Generation beitragen. Diesen Nachranggrundsatz hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt deutlich hervorgehoben (vgl. BVerfG, Urteil vom 07.06.2005, 1 BvR 1508/96).
Unterhaltspflicht, wenn keine oder keine ausreichende Altersversorgung besteht
Ein Unterhaltsanspruch der Eltern kann bereits dann entstehen, wenn diese über keine ausreichende Altersversorgung verfügen oder die Altersversorgung bzw. Grundsicherung nicht für die regelmäßig sehr hohen Kosten eines Alten- bzw. Pflegeheims ausreicht.
Vermögen der Eltern ist zu verwerten
Haben die Eltern jedoch Vermögen, ist dieses zu verwerten, bevor ein Unterhaltsanspruch gegen die Kinder geltend gemacht werden kann.
Unterhaltspflicht bei Arbeitslosigkeit der Eltern
Aber nicht nur im hohen Alter, sondern auch beispielsweise wegen Arbeitslosigkeit können Eltern gegen ihre Kinder einen Unterhaltsanspruch haben. Im Fall von Arbeitslosigkeit sind allerdings sehr hohe Anforderungen daran zu stellen, ob die Arbeitslosigkeit vermeidbar wäre. Die Eltern müssen dabei jede Tätigkeit annehmen, notfalls auch eine solche, die von ihrem Niveau niedriger ist als ihre Ausbildung.
Kinder haben gegenüber ihren Eltern keine gesteigerte Unterhaltspflicht. Diese ist nachrangig gegenüber den Unterhaltsansprüchen von Ehegatten und minderjährigen sowie volljährigen Kindern.
Bevor sie auf ihre Kinder zugehen, müssen Eltern vorrangig Unterhalt von ihrem Ehegatten verlangen, selbst wenn sie von diesem bereits geschieden sind.
Einschränkung der Lebensführung des Kindes aufgrund der Unterhaltspflicht
Auch im Verhältnis zum Elternunterhalt kann es für ein Kind zumutbar sein, getroffene Vermögensdispositionen rückgängig zu machen (z. B. Kauf eines Hauses). Dabei kommt es jedoch wieder auf die unterschiedliche Lebenssituation an, in der sich die Eltern bei der Frage nach dem Unterhalt für das Kind befanden und sich jetzt das Kind befindet.
Vorhersehbarkeit und Zumutbarkeit
Bei der Frage der Vorhersehbarkeit und Zumutbarkeit ist entscheidend, in welchem Maß die gegenwärtige Lebensführung zur Bezahlung des Unterhalts eingeschränkt werden muss und getroffene Vermögensdispositionen rückgängig gemacht oder zumindest geändert werden müssen. Ohne weitere Anhaltspunkte wird das Kind regelmäßig nicht davon ausgehen müssen, dass seine Eltern unterhaltsbedürftig werden, und entsprechende Vermögensdispositionen treffen können.
2. Auskunftspflicht des Unterhaltsschuldners
Auskunftsanspruch und Auskunftspflicht
Auskunftsverpflichtung unter Verwandten in gerader Linie
Keine automatische Auskunftspflicht!
Schadensersatzanspruch bei verweigerter Auskunft
Form und Umfang der Auskunft
Auskunft regelmäßig nur alle zwei Jahre
Auskunftsanspruch und Auskunftspflicht
Regelmäßig hüllt sich der Unterhaltspflichtige, wenn es darauf ankommt, über die Höhe seiner Einkünfte in Schweigen. Dem Unterhaltsberechtigten wäre es danach nicht möglich, die Höhe seines angemessenen Unterhalts zu berechnen und gegenüber dem Unterhaltsverpflichteten geltend zu machen. Trotz bestehenden Unterhaltsanspruchs könnte der Unterhaltsberechtigte diesen nicht durchsetzen, da der Unterhaltsberechtigte nicht einfach eine beliebige Summe in den Raum stellen kann.
Damit der Unterhaltsberechtigte seinen Unterhaltsanspruch dennoch durchsetzen kann, hat der Gesetzgeber den Unterhaltsberechtigten mit einem umfangreichen Auskunftsanspruch ausgestattet.
Auskunftsverpflichtung unter Verwandten in gerader Linie
Danach sind Verwandte in gerader Linie einander verpflichtet, auf Verlangen über ihre Einkünfte und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Feststellung des Unterhaltsanspruchs oder einer Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. Über die Höhe der Einkünfte sind auf Verlangen Belege, insbesondere Bescheinigungen des Arbeitgebers, vorzulegen (§ 1605 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BGB).
Die Auskunftspflicht besteht danach nicht nur einseitig vom Unterhaltsverpflichteten gegenüber dem Unterhaltsberechtigten, sondern auch umgekehrt vom Unterhaltsberechtigten gegenüber dem Unterhaltsverpflichteten.
Das beruht darauf, dass sowohl der Unterhaltsberechtigte als auch der Unterhaltsverpflichtete sich gegenseitig über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse Einblick verschaffen müssen, da die Einkommens- und Vermögensverhältnisse für die Höhe des Unterhaltsanspruchs sowohl aus der Sicht des Unterhaltspflichtigen als auch des Unterhaltsberechtigten von Bedeutung sind.
Keine automatische Auskunftspflicht!
Der Auskunftsanspruch muss grundsätzlich geltend gemacht werden. Es besteht somit keine automatische Auskunftspflicht. In engen Grenzen besteht allerdings eine Pflicht zur unaufgeforderten Information, zum Beispiel wenn der unterhaltsberechtigte Elternteil eine Erwerbstätigkeit aufnimmt.
Wird die Auskunft verweigert, kann im Rahmen einer sogenannten Stufenklage vor dem Gericht zunächst auf Auskunft geklagt werden sowie anschließend darauf, dass die Richtigkeit der abgegebenen Auskunft an Eides statt versichert wird und schließlich auf Bezahlung des sich aus der Auskunft ergebenden Unterhaltsbetrags.
Schadensersatzanspruch bei verweigerter Auskunft
Eine nicht erteilte oder unrichtige Auskunft kann zu einem Schadensersatzanspruch führen.
Das gilt insbesondere, wenn beispielsweise der Unterhaltspflichtige unaufgefordert weiter Unterhalt bezahlt, weil er den Unterhaltsberechtigten um Auskunft ersuchte, welcher diese zwar erteilte, jedoch verschwieg, dass er Einkünfte aus einer nicht unerheblichen Aushilfstätigkeit erzielte.
Form und Umfang der Auskunft
Bedeutsam sind Form und vor allem Umfang, in welcher die Auskunft zu erteilen ist.
Grundsätzlich erforderlich ist die Vorlage einer systematischen Aufstellung der Einkünfte, welche es dem Unterhaltsberechtigten ohne übermäßigen Arbeitsaufwand ermöglicht, seinen Unterhaltsanspruch zu berechnen. Dabei ist es nicht ausreichend, beispielsweise die Lohnsteuerbescheinigung vorzulegen. Erforderlich wäre vielmehr eine detaillierte Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers. Bei Arbeitnehmern kann regelmäßig Auskunft über die Einkünfte der letzten zwölf Monate verlangt werden. Bei Selbstständigen sind die Bilanzen im Zeitraum von regelmäßig drei Jahren maßgeblich.
Auskunft regelmäßig nur alle zwei Jahre
Aus Gründen des Rechtsfriedens muss die Auskunft jedoch nicht monatlich wiederholt werden. Vielmehr ist vor Ablauf von zwei Jahren ein erneuter Auskunftsanspruch nur möglich, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der zur Auskunft Verpflichtete später, das heißt nachdem er Auskunft erteilt hatte, wesentlich höhere Einkünfte oder weiteres Vermögen erworben hat (§ 1605 Abs. 2 BGB).
3. Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit der unterhaltsverpflichteten Kinder
Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten Elternteils
Leistungsfähigkeit der unterhaltsverpflichteten Kinder
Leistungsfähigkeit ist Voraussetzung
Kinder werden zum Unterhalt verpflichtet, sofern sie leistungsfähig sind.
Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren (§ 1603 Abs. 1 BGB).
Einkünfte des Unterhaltsverpflichteten
Zur Leistungsfähigkeit zählen Einkünfte sowie Vermögen und das, was der Unterhaltsverpflichtete verdienen könnte.
Bei den Einkünften kommt es auf die Nettoeinkünfte an. Berufliche Aufwendungen sind vorweg abzuziehen.
Rückgriff auf den Vermögensstamm
Unter Umständen müssen Kinder auf ihr Vermögen zurückgreifen, um den Unterhalt zahlen zu können.
Selbstbehalt
Als Selbstbehalt verbleibt dem Unterhaltsverpflichteten zumindest der notwendige Eigenbedarf.
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern und dem Ehegatten
Leistungsmindernd wirken sich Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern, auch nicht ehelichen oder aus früherer Ehe, aus. Gleiches gilt für die Unterhaltsverpflichtung gegenüber einem Ehegatten.
Berücksichtigung von Schulden?
Schulden des Unterhaltsverpflichteten vermindern regelmäßig nicht dessen Leistungsfähigkeit.
Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten Elternteils
Feststellung der Bedürftigkeit
Unterhaltsberechtigt ist, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (§ 1602 Abs. 1 BGB).