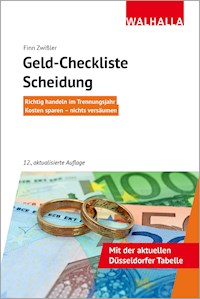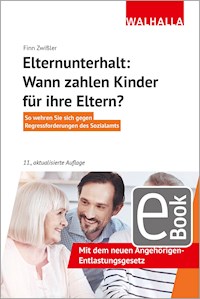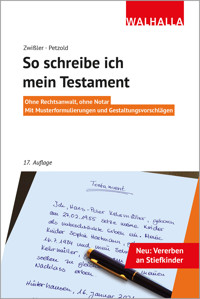
14,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nachlass regeln, Streit vermeiden
Wer etwas zu vererben hat, sollte sich frühzeitig Gedanken machen:
- Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus?
- Wer kommt als Erbe infrage?
- Was kann vererbt werden?
- Welche Regelungen sind sinnvoll?
- Wie wird ein eigenhändiges Testament errichtet?
- Wo wird das Testament am besten aufbewahrt?
- Wie hoch ist die Erbschaftsteuer?
- Wie wird ein Vormund für Kinder nach dem Tod beider Elternteile bestimmt?
- Wahlheimat oder Heimatland: Welche Vorteile bietet das europäische Erbrecht?
Mit dem Ratgeber So schreibe ich mein Testament können Erblasser selbstständig ihren Letzten Willen verfassen – vom Ehegattentestament (z. B. Berliner Testament) bis zur Enterbung missliebiger Kinder.
Erben erfahren, wie sie im Erbfall vorgehen müssen und gegebenenfalls ihre persönliche Haftung verhindern können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
17., aktualisierte. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected]
Kurzbeschreibung
Nachlass regeln, Streit vermeiden
Wer etwas zu vererben hat, sollte sich frühzeitig Gedanken machen:
Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus?Wer kommt als Erbe infrage?Was kann vererbt werden?Welche Regelungen sind sinnvoll?Wie wird ein eigenhändiges Testament errichtet?Wo wird das Testament am besten aufbewahrt?Wie hoch ist die Erbschaftsteuer?Wie wird ein Vormund für Kinder nach dem Tod beider Elternteile bestimmt?Wahlheimat oder Heimatland: Welche Vorteile bietet das europäische Erbrecht?Mit dem Ratgeber So schreibe ich mein Testament können Erblasser selbstständig ihren Letzten Willen verfassen – vom Ehegattentestament (z. B. Berliner Testament) bis zur Enterbung missliebiger Kinder.
Erben erfahren, wie sie im Erbfall vorgehen müssen und gegebenenfalls ihre persönliche Haftung verhindern können.
Autor
Finn Zwißler und Sascha Petzold sind Rechtsanwälte in München. Erbrecht ist ein Schwerpunkt ihrer anwaltschaftlichen Tätigkeit. Erfolgreiche Fachautoren.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Die gesetzliche Erbfolge
2. Verschiedene Formen letztwilliger Verfügungen
3. Testier- und Erbfähigkeit
4. Form und Inhalt des Testaments
5. Was kann in einem Testament geregelt werden?
6. Testamentsgestaltung bei mehreren Erben
7. Das Vermächtnis
8. Testamentsaufbewahrung und -änderung
9. Das Ehegattentestament
10. Vormundbenennung für minderjährige Kinder
11. Rechte und Pflichten des Erben
12. Die Erbengemeinschaft
13. Gesetzliche Auslegungsregeln
14. Vorsicht: Der Fiskus erbt mit
15. Die Europäische Erbrechtsverordnung
16. Formulierungsvorschläge für Testamente
17. Hilfreiche Adressen
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Es ist nie zu früh für ein Testament
Abkürzungen
Es ist nie zu früh für ein Testament
Zunehmend hört und liest man, es sei das Zeitalter der Erben und Erblasser. Dennoch machen sich immer noch viel zu wenige Menschen Gedanken um die Verteilung ihres Vermögens nach dem Tod. Ein Testament zu verfassen wird immer weiter hinausgezögert. Bei einigen kam der Tod schneller als die Muße für das Testament.
Das Ergebnis ist häufig Streit unter den Erben. Davor sind übrigens auch solche Familien und Familienmitglieder nicht gefeit, die bisher bestens miteinander auskamen. Nicht selten wird der Familienfriede durch die Erbschaftsauseinandersetzung für immer zerstört.
Deswegen ist es notwendig, sich bereits frühzeitig Gedanken über ein Testament zu machen. Wer soll wie viel bekommen? Sollen einzelne Personen mit bestimmten Gegenständen bedacht werden? Soll zuerst mein Ehegatte erben, meine Kinder aber erst nach dessen Tod? Wer soll unsere Kinder versorgen, sollten wir beide gleichzeitig ums Leben kommen?
Das bietet dieses Buch
Die Autoren haben den Bedarf für einen Testamentsratgeber in ihrer Berufspraxis erkannt. Immerhin sind über 75 Prozent der Testamente unrichtig und oftmals unwirksam. Sie werden dann insgesamt oder teilweise von den Gerichten im Streitfall nicht anerkannt.
Im vorliegenden Ratgeber erhalten Sie Antwort auf folgende Fragen:
Wer kann überhaupt vererben und wer beerben?
Wie gestalten Sie Form und Inhalt des Testaments?
Wie muss das Testament aussehen?
Was kann in einem Testament geregelt werden?
Wie kann das Testament geändert werden?
Wie sparen Sie und Ihre Erben Erbschaftsteuer?
Wie kann ein Vormund für Kinder benannt werden?
Der Ratgeber informiert Sie über Ihre Rechte und bereitet Sie auf den Gang zum Rechtsanwalt vor. Denn der Rechtsanwalt ist in der Regel nur so gut wie sein Mandant. Der vorbereitete Mandant bekommt vom Rechtsanwalt viel mehr Informationen für sein Geld. Der besonders versierte Leser kann es aber in einfach gelagerten Fällen auch wagen, sein Testament ohne anwaltliche Hilfe zu verfassen.
Zum besseren Überblick sind am Ende eines jeden Kapitels auszugsweise die wichtigsten Gesetzestexte aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch bzw. dem Erbschaftsteuergesetz abgedruckt.
Finn ZwißlerRechtsanwaltNeuhauser Straße 2780331 MünchenTel.: 0 89/55 02 73 11Fax: 0 89/55 02 73 13kanzlei@rechtsanwalt-zwissler.dewww.rechtsanwalt-zwissler.deSascha PetzoldRechtsanwaltNymphenburger Straße 2080333 MünchenTel.: 0 89/189 119 10Fax: 0 89/189 119 [email protected]Abkürzungen
BGBBürgerliches GesetzbuchBGBl.BundesgesetzblattDVEV e. V.Deutsche Vereinigung für Erbrecht undVermögensnachfolge e. V.ErbStGErbschaftsteuergesetzErbStRGErbschaftsteuerreformgesetzEU-ErbVOEuropäische ErbrechtsverordnungInsOInsolvenzordnungKGKommanditgesellschaftGNotKGGesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und NotareOHGOffene Handelsgesellschaft1. Die gesetzliche Erbfolge
Was Sie wissen müssen
Erbrechtliche Begriffserklärungen
Verwandtenerbrecht
Erbrecht des nichtehelichen Kindes
Vererben an Stiefkinder
Ehegattenerbrecht
Wichtige Gesetzestexte aus dem BGB
Was Sie wissen müssen
Wenn Sie nicht durch eine sogenannte „Verfügung von Todes wegen“ Ihren Nachlass regeln, gilt die gesetzliche Erbfolge. Die gesetzliche Erbfolge ist in den §§ 1924 bis 1936 BGB geregelt. Das Gesetz geht davon aus, dass in der Regel jeder Mensch sein Vermögen an die Personen vererben will, die ihm am nächsten stehen: seine Kinder, seinen Ehegatten usw. Wenn die gesetzliche Erbfolge genau Ihrem Willen entspricht, brauchen Sie kein Testament erstellen.
Erbrechtliche Begriffserklärungen
Abkömmlinge sind die Kinder des Erblassers und deren Abkömmlinge (Enkel, Urenkel usw.), das heißt die direkten Nachkommen des Erblassers.
Erbe ist derjenige, der vom verstorbenen Erblasser als Allein- oder Miterbe Vermögen erhält.
Erbfall tritt mit dem Tod des Erblassers ein.
Erbfolge regelt, wer Erbe des Erblassers wird und zu welchen Teilen ihm die Erbschaft zusteht.
Erblasser ist derjenige, der stirbt oder gestorben ist und dessen Vermögen auf die Erben verteilt wird. Der Begriff wird auch gebraucht für eine Person, die ein Testament errichtet.
Nachlass ist das gesamte Vermögen, das mit dem Tod des Erblassers übergeht. Der Ausdruck ist hier identisch mit „Erbschaft“.
Verfügungen von Todes wegen sind Bestimmungen, die regeln, wie das Vermögen nach dem Tod verteilt wird. Diese Bestimmungen trifft der Erblasser selbst, zum Beispiel durch Testament oder Erbvertrag.
Verwandtenerbrecht
Das Gesetz unterscheidet bei der Erbfolge nach dem erbrechtlichen Grad der Verwandtschaft, der sogenannten Ordnung. Dabei schließt ein Verwandter geringerer Ordnung die Verwandten entfernterer Ordnung von der Erbschaft aus. Innerhalb einer Ordnung wird das Vermögen nach Linien bzw. Stämmen gleich verteilt, das heißt zum Beispiel, dass alle Kinder gleich viel erben.
Wiederum innerhalb der Stämme erben nur die sogenannten Repräsentanten des Stammes. Das sind diejenigen, die am nächsten mit dem Erblasser verwandt sind. Nur wenn der Repräsentant bereits gestorben ist, rücken dessen Abkömmlinge an seine Stelle.
Erben erster Ordnung
Erben erster Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers. Es erben alle Kinder zu gleichen Teilen. Ist ein Kind bereits verstorben, treten dessen Kinder (also die Enkel des Erblassers) an seine Stelle.
Die Witwe Bolte hinterlässt nach ihrem Tod nur die Söhne Max und Moritz.
Max und Moritz erben somit jeweils die Hälfte des Vermögens. Die Kinder von Max und Moritz erben nichts.
Nun ist Moritz schon vor seiner Mutter gestorben. Er hinterlässt aber seinerseits drei Kinder.
Auch hier erbt Max zu 1/2. Die andere Hälfte des Vermögens verteilt sich auf die Kinder des Moritz. Diese erben jeweils zu 1/6.
Erben zweiter Ordnung
Erben zweiter Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, das heißt Vater, Mutter, Geschwister, Neffen und Nichten usw. des Erblassers. Sie werden aber nur Erben, wenn keine Erben erster Ordnung vorhanden sind. Beide Elternteile erben zu gleichen Teilen. Ist ein Elternteil bereits verstorben, treten dessen Kinder an seine/ihre Stelle, somit die Geschwister des Erblassers wiederum zu gleichen Teilen.
Diesmal stirbt die kinderlose Witwe Müller.
Da sie keine Abkömmlinge hat (Erben erster Ordnung), kommen die Erben zweiter Ordnung zum Zuge. Es erben demnach die Eltern von Frau Müller zu je 1/2.
Die gleiche Situation wie oben im Beispielsfall 1. Diesmal ist auch die Mutter bereits gestorben. Die Mutter hinterlässt neben Frau Müller noch zwei weitere Kinder.
Der Vater behält seinen halben Erbteil. Die andere Hälfte der Mutter wird auf die beiden noch lebenden Kinder verteilt, also zu je 1/4.
Erben dritter Ordnung
Erben dritter Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Sie werden Erben, wenn es keine Erben erster und zweiter Ordnung gibt. Leben noch alle Großeltern, erben sie allein und zu gleichen Teilen. Ist ein Großvater oder eine Großmutter bereits gestorben, treten an seine/ihre Stelle seine/ihre Abkömmlinge. Sind keine Abkömmlinge des verstorbenen Großelternteils vorhanden, fällt dieser Erbteil dem anderen Teil des Großelternpaares zu, gegebenenfalls bei dessen Tod an dessen Abkömmlinge. Sind beide Teile eines Großelternpaares gestorben und haben beide keine lebenden Abkömmlinge, erbt das andere Großelternpaar allein.
Erben vierter Ordnung
Erben vierter Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
Erben fernerer Ordnung sind entferntere Voreltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Diese erben nur, wenn keine Erben einer früheren Ordnung vorhanden sind.
Für Erben vierter und späterer Ordnung regelt das Gesetz die Vermögensaufteilung anders als in den früheren Ordnungen. Es erben alle lebenden Großeltern bzw. entferntere Voreltern zu gleichen Teilen, ganz gleich zu welchen Stämmen sie gehören. An die Stelle eines verstorbenen Urgroßelternteils treten nicht dessen Abkömmlinge. Es erhöht sich vielmehr die Erbquote der noch lebenden Urgroßeltern zu gleichen Teilen.
Erst wenn gar kein Urgroßelternteil mehr am Leben ist, kommen deren Abkömmlinge zum Zuge. Es erbt derjenige Abkömmling, der mit dem Erblasser gradmäßig am nächsten verwandt ist, wobei mehrere Verwandte gleichen Grades zu gleichen Teilen erben. Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Anzahl der Geburten, die zwischen dem Erblasser und dem Verwandten stehen.
Der Grad der Verwandtschaft ist nicht mit der Ordnung der Erbschaft identisch.
Zur Bestimmung des Verwandschaftsgrads gehen Sie folgendermaßen vor: Zeichnen Sie einen Stammbaum, in dem unter anderem der Erblasser und der zu ermittelnde Verwandte aufgelistet ist. Zeichnen Sie dann im Stammbaum jeweils Linien von den Eltern zu deren Kindern. Jetzt zählen Sie die Striche, die den Erblasser mit den Verwandten auf kürzestem Wege verbinden. Die Zahl entspricht dem Grad der Verwandtschaft.
ersatzweise:
Onkel/Tante
Vetter/Kusine
weitere Abkömmlinge der Großeltern
Erben 2. OrdnungElternersatzweise:
Geschwister
Neffe/Nichte
weitere Abkömmlinge der Eltern
Erblasser(in) †Erben 1. OrdnungKinder
Enkel
Urenkel
weitere Abkömmlinge
Erbrecht des nichtehelichen Kindes
Das Gesetz zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder hat zum 01.04.1998 die nichtehelichen Kinder den ehelichen Kindern erbrechtlich völlig gleichgestellt. Sie werden in gleicher Art und Höhe Erben wie eheliche Kinder. Die Vaterschaft muss aber förmlich festgestellt worden sein.
Eine Ausnahme gilt für nichteheliche Kinder, die vor dem 01.07.1949 geboren wurden. Diese sind zwar inzwischen auch voll erbberechtigt gegenüber ihrem Vater. Die Neuregelung gilt aber nur für Erbfälle, die nach dem 28.05.2009 eingetreten sind.
Im Zweifel sollten Sie sich anwaltlichen Rat von einem Spezialisten einholen.
Vererben an Stiefkinder
Echte und unechte Stiefkinder
Echte Stiefkinder sind Kinder des Ehepartners, welcher dieser in die Ehe aus einer früheren Beziehung mitbringt, also keine gemeinsamen Kinder. Damit es sich aber tatsächlich um ein Stiefkind im rechtstechnischen Sinne handelt, bedarf es einer wirksamen Eheschließung zwischen leiblichem Elternteil und dem nicht leiblichen Elternteil, das heißt dem Stiefelternteil.
Unechte Stiefkinder, das heißt im rechtstechnischen Sinne keine Stiefkinder, sind die Kinder, welche ein Lebenspartner aus einer alten Beziehung in die neue Beziehung mitbringt, wobei die neue Beziehung nicht auf einer wirksamen Eheschließung beruht, sondern es sich dabei um eine nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne Trauschein handelt.
Sowohl echte als auch unechte Stiefkinder haben nach dem echten bzw. unechten Stiefelternteil weder ein gesetzliches Erbrecht noch ein Pflichtteilsrecht.
Testamentarische Erbeinsetzung
Sowohl echte als auch unechte Stiefkinder können wie auch jede andere beliebige Person testamentarisch zum Erben oder Vermächtnisnehmer eingesetzt werden. Denkbar wäre eine Einsetzung auf ein Vermächtnis, beispielsweise Geldvermächtnis bis hin zur Einsetzung als alleiniger Vollerbe.
Zu beachten ist, dass dadurch gesetzliche Pflichtteilsrechte nicht ausgeschlossen werden können, diese bleiben bestehen.
Schenkungen unter Lebenden
Echten bzw. unechten Stiefkindern können auch zu Lebzeiten Vermögensgegenstände schenkweise übertragen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insoweit Pflichtteilsberechtigte im Fall des Versterbens Pflichtteilsergänzungsansprüche hätten.
Adoption
Hat sich zu dem echten bzw. unechten Stiefkind bereits eine Eltern-Kind-Beziehung entwickelt, kommt eine Adoption in Betracht. Dabei handelt es sich um ein aufwendiges gerichtliches Überprüfungsverfahren, welches in der rechtlichen Konsequenz dazu führt, dass das Kind, wenn es adoptiert ist, einem leiblichen Kind gleichgestellt wird.
Sofern es sich um eine Volladoption, das heißt zu den Konditionen eines Minderjährigen handelt, erlöschen die Verwandtschaftsverhältnisse gegenüber dem anderen leiblichen Elternteil, anders als bei der Erwachsenenadoption, wo die Verwandtschaftsverhältnisse bestehen bleiben.
Stiefkinder im Erbschaftsteuerrecht
Der wesentliche Unterschied zwischen echten und unechten Stiefkindern zeigt sich im Erbschaftsteuerrecht:
Echte Stiefkinder haben ebenso wie leibliche Kinder und Adoptivkinder einen Erbschaftsteuerfreibetrag in Höhe von 400.000 Euro und werden nach der günstigen Erbschaftsteuerklasse I besteuert, während unechte Stiefkinder erbschaftsteuerrechtlich wie Fremde behandelt werden, das heißt sie haben nur einen Erbschaftsteuerfreibetrag in Höhe von 20.000 Euro und finden sich in der ungünstigen Erbschaftsteuerklasse III wieder.
Ehegattenerbrecht
Geschieden
War zum Tod des Erblassers die Ehe bereits geschieden, ist der Ex-Ehepartner nicht mehr Ehegatte und von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen.
Ist der Erblasser zurzeit des Scheidungsverfahrens gestorben, ist der „Noch-Ehegatte“ von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, wenn der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hat. Das gilt jedoch nur, wenn die rechtlichen Voraussetzungen für eine Scheidung gegeben sind.
Befinden Sie sich in dieser Lage – Ihr Ehegatte ist während des Scheidungsverfahrens gestorben –, sollten Sie unbedingt einen Rechtsanwalt aufsuchen. Nur ein Spezialist kann genau prüfen, ob die Scheidungsvoraussetzungen vorliegen.
Gesetzlicher Erbteil
Neben den Verwandten ist auch der Ehegatte gesetzlicher Erbe. Wie viel der Ehegatte erbt – die sogenannte Erbquote –, richtet sich danach, welche gesetzlichen Erben sonst noch vorhanden sind.
Neben Erben erster Ordnung erbt der Ehegatte 1/4. (siehe Kapitel Enterben)
Neben Erben zweiter Ordnung erbt der Ehegatte 1/2.
Neben den Großeltern des Erblassers (Erben dritter Ordnung) erbt der Ehegatte ebenfalls 1/2.
Neben Großeltern und Abkömmlingen von Großeltern (weil z. B. ein Großelternteil bereits verstorben ist oder die Erbschaft ausgeschlagen hat) erbt der Ehegatte zusätzlich zu der oben genannten Hälfte noch den Teil, der eigentlich auf den Abkömmling entfallen würde.
Sind weder Verwandte erster oder zweiter Ordnung, noch Großeltern des Erblassers vorhanden, erbt der Ehegatte alles.
Voraus – ein Sonderrecht für Ehegatten
Der überlebende Ehegatte erhält neben seinem gesetzlichen Erbteil noch den sogenannten Voraus. Aber nur, wenn er gesetzlicher Erbe geworden ist; nicht dagegen, wenn der Erblasser ein Testament errichtet, einen Erbvertrag schließt oder der Erbe die Erbschaft nicht annimmt, das heißt ausschlägt.
Was zählt zum Voraus?
Zum Voraus zählen die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände und Hochzeitsgeschenke.
Das sind beispielsweise:
Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände
Haushaltsgeräte
Bücher und Bilder
Familienauto
Ausgeschlossen sind Gegenstände, die nur dem persönlichen Gebrauch des Erblassers dienten. Ebenso gehören Gegenstände, die Zubehör eines Grundstücks sind, nicht zum Voraus.
Erhält der Ehegatte stets den ganzen Voraus?
Nein. Neben Erben erster Ordnung (das heißt neben Kindern und Kindeskindern des Erblassers) erhält der Ehegatte vom Voraus nur dasjenige, was er zur Führung eines angemessenen Haushalts benötigt.
Wie erhält der Ehegatte den Voraus?
Er muss die Gegenstände von den Erben verlangen und sich das Eigentum übertragen lassen. Da der Ehegatte aber im Besitz der Gegenstände ist, reicht die Einigung des Ehegatten mit den anderen Erben, dass er das Eigentum an dem Voraus erhalten soll.
Der „Voraus“ wird gesetzlich wie ein Vermächtnis behandelt (vgl. Kapitel 7).
Dreißigster
Wer von seinem verstorbenen Ehegatten Unterhalt erhalten hat und in dessen Haushalt lebte, hat einen weiteren Anspruch gegen den/die Erben. Die Miterben sind verpflichtet, den Ehegatten für 30 Tage Unterhalt in der bisher erhaltenen Höhe zu zahlen sowie dem Ehegatten die Benutzung der Wohnung und Haushaltsgegenstände zu gestatten.
Der „Dreißigste“ wird gesetzlich wie ein Vermächtnis behandelt (vgl. Kapitel 7).
Zugewinnausgleich
Zugewinnausgleich erhalten nur Ehegatten, die im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten. Haben sie keinen Ehevertrag geschlossen und einen anderen Güterstand gewählt, gilt für sie die Zugewinngemeinschaft.
Zugewinngemeinschaft
Das bedeutet, dass zu Lebzeiten die Ehegatten nicht gemeinsam Eigentum an „ihren“ Gegenständen haben. Vielmehr bleiben die Vermögen von Mann und Frau getrennt. Erst mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Scheidung wird der Zugewinn ausgeglichen. Das heißt man prüft, wer während der Ehe mehr Vermögen ansammeln konnte, wer also mehr Zugewinn hatte. Dieser muss dann die Hälfte dessen, was er mehr als der andere dazu gewonnen hat, an seinen Ehegatten herausgeben.
Erbrechtlicher Zugewinn
Beim Tod eines Ehegatten erhält der überlebende Ehegatte neben seinem gesetzlichen Erbteil ¼ des Nachlasses als gesetzlich vermuteten Zugewinn. Das gilt unabhängig davon, wie viel Zugewinn tatsächlich erwirtschaftet wurde. Diesen erbrechtlichen Zugewinn erhält aber nur der Ehegatte, der gesetzlicher Erbe wird. Somit nicht der Ehegatte, der durch Testament Erbe wird oder sein Erbe ausschlägt.
Neben Erben erster Ordnung erbt der Ehegatte insgesamt 1/2.
Neben Erben zweiter Ordnung erbt der Ehegatte insgesamt 3/4.
Neben den Großeltern des Erblassers erbt der Ehegatte ebenfalls insgesamt 3/4.
Sind weder Verwandte erster oder zweiter Ordnung, noch Großeltern des Erblassers vorhanden, erbt der Ehegatte auch ohne Zugewinnausgleich alles.
Wichtige Gesetzestexte aus dem BGB
(1) Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.
(2) Ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus.
(3) An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge (Erbfolge nach Stämmen).
(4) Kinder erben zu gleichen Teilen.
(1) Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen.
(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge nach den für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so erbt der überlebende Teil allein.
(4) In den Fällen des § 1756 sind das angenommene Kind und die Abkömmlinge der leiblichen Eltern oder des anderen Elternteils des Kindes im Verhältnis zueinander nicht Erben der zweiten Ordnung.
(1) Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls die Großeltern, so erben sie allein und zu gleichen Teilen.
(3) Lebt zur Zeit des Erbfalls von einem Großelternpaar der Großvater oder die Großmutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge. Sind Abkömmlinge nicht vorhanden, so fällt der Anteil des Verstorbenen dem anderen Teil des Großelternpaars und, wenn dieser nicht mehr lebt, dessen Abkömmlingen zu.
(4) Lebt zur Zeit des Erbfalls ein Großelternpaar nicht mehr und sind Abkömmlinge der Verstorbenen nicht vorhanden, so erben die anderen Großeltern oder ihre Abkömmlinge allein.
(5) Soweit Abkömmlinge an die Stelle ihrer Eltern oder ihrer Voreltern treten, finden die für die Beerbung in der ersten Ordnung geltenden Vorschriften Anwendung.
Wer in der ersten, der zweiten oder der dritten Ordnung verschiedenen Stämmen angehört, erhält den in jedem dieser Stämme ihm zufallenden Anteil. Jeder Anteil gilt als besonderer Erbteil.
(1) Gesetzliche Erben der vierten Ordnung sind die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
(2) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern, so erben sie allein; mehrere erben zu gleichen Teilen, ohne Unterschied, ob sie derselben Linie oder verschiedenen Linien angehören.
(3) Leben zur Zeit des Erbfalls Urgroßeltern nicht mehr, so erbt von ihren Abkömmlingen derjenige, welcher mit dem Erblasser dem Grade nach am nächsten verwandt ist; mehrere gleich nahe Verwandte erben zu gleichen Teilen.
(1) Gesetzliche Erben der fünften Ordnung und der ferneren Ordnungen sind die entfernteren Voreltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
(2) Die Vorschrift des § 1928 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung.
Ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist.
(1) Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen. Treffen mit Großeltern Abkömmlinge von Großeltern zusammen, so erhält der Ehegatte auch von der anderen Hälfte den Anteil, der nach § 1926 den Abkömmlingen zufallen würde.
(2) Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, so erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft.
(3) Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.
(4) Bestand beim Erbfall Gütertrennung und sind als gesetzliche Erben neben dem überlebenden Ehegatten ein oder zwei Kinder des Erblassers berufen, so erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen; § 1924 Abs. 3 gilt auch in diesem Falle.
(1) Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und die Hochzeitsgeschenke als Voraus. Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der ersten Ordnung gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm diese Gegenstände, soweit er sie zur Führung eines angemessenen Haushalts benötigt.
(2) Auf den Voraus sind die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften anzuwenden.
Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sowie das Recht auf den Voraus ist ausgeschlossen, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das Gleiche gilt, wenn der Erblasser berechtigt war, die Aufhebung der Ehe zu beantragen, und den Antrag gestellt hatte. In diesen Fällen ist der Ehegatte nach Maßgabe der §§ 1569 bis 1586b unterhaltsberechtigt.
(1) Der Erbe ist verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die zur Zeit des Todes des Erblassers zu dessen Hausstand gehören und von ihm Unterhalt bezogen haben, in den ersten 30 Tagen nach dem Eintritt des Erbfalls in demselben Umfang, wie der Erblasser es getan hat, Unterhalt zu gewähren und die Benutzung der Wohnung und der Haushaltsgegenstände zu gestatten. Der Erblasser kann durch letztwillige Verfügung eine abweichende Anordnung treffen.
(2) Die Vorschriften über Vermächtnisse finden entsprechende Anwendung.
(1) Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht; hierbei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Falle einen Zugewinn erzielt haben.
(2) Wird der überlebende Ehegatte nicht Erbe und steht ihm auch kein Vermächtnis zu, so kann er Ausgleich des Zugewinns nach den Vorschriften der §§ 1373 bis 1383, 1390 verlangen; der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten oder eines anderen Pflichtteilsberechtigten bestimmt sich in diesem Falle nach dem nicht erhöhten gesetzlichen Erbteil des Ehegatten.
(3) Schlägt der überlebende Ehegatte die Erbschaft aus, so kann er neben dem Ausgleich des Zugewinns den Pflichtteil auch dann verlangen, wenn dieser ihm nach den erbrechtlichen Bestimmungen nicht zustünde; dies gilt nicht, wenn er durch Vertrag mit seinem Ehegatten auf sein gesetzliches Erbrecht oder sein Pflichtteilsrecht verzichtet hat.
(4) Sind erbberechtigte Abkömmlinge des verstorbenen Ehegatten, welche nicht aus der durch den Tod dieses Ehegatten aufgelösten Ehe stammen, vorhanden, so ist der überlebende Ehegatte verpflichtet, diesen Abkömmlingen, wenn und soweit sie dessen bedürfen, die Mittel zu einer angemessenen Ausbildung aus dem nach Absatz 1 zusätzlich gewährten Viertel zu gewähren.