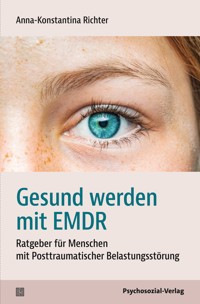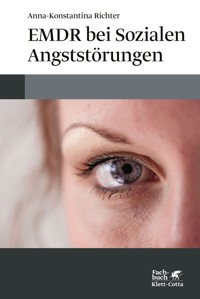
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit EMDR lassen sich Soziale Angststörungen schnell und wirkungsvoll behandeln. Dieses stark anwendungsorientierte Praxisbuch erläutert, wie sozial ängstliche Patient/-innen sicher diagnostiziert werden können. Es zeigt anhand ausführlicher Fallbeispiele, wie Therapeut/-innen effizient und sicher vorgehen können. »Als ich das Manuskript bekomme, dauert es nicht lange, um zu erkennen, dass Konstantinas Werk ein geborener Klassiker über das Thema ist.« André Maurício Monteiro, EMDR-Trainer's Trainer, Brasilia Die Sozialen Angststörungen stellen die dritthäufigste psychische Störung dar und gelten aufgrund der hohen Nonresponderquote als schwer behandelbar. Wissenschaftliche Studien belegen, dass EMDR einen direkten Effekt auf soziale Ängste hat. Das Buch erläutert das therapeutische Vorgehen mit der EMDR-Methode und gibt einen Überblick über wichtige neue Befunde zum Störungsbild. Es verbindet eine theoretische Fundierung mit aktuellen Erkenntnissen über eine gut umsetzbare, praxistaugliche Diagnostik samt Materialsammlung. PsychotherapeutInnen werden mittels praktischer Fallbeispiele gut auf die Anwendung in Klinik oder eigener Praxis vorbereitet. Dies Buch leistet einen einzigartigen Beitrag zur Schließung der seit Jahren bestehenden Forschungslücke bei Sozialen Angststörungen und gibt den weltweit ersten Überblick über die Forschungslage zu EMDR bei Sozialen Angststörungen, der von Frau Richter als führender Forscherin auf dem Gebiet zusammengetragen wurde. Außerdem leistet das Buch einen führenden konzeptionellen Beitrag zur psychologischen Modellentwicklung, wie eine Verbesserung der Heilungschancen gelingen kann durch das neu vorgestellte Konzept der Neokonsolidierung von belastenden Erinnerungen. Dieses Buch richtet sich an - Ärztliche und Psychologische PsychotherapeutInnen aller Richtungen - VerhaltenstherapeutInnen - PsychoanalytikerInnen, tiefenpsychologisch fundierte PsychotherapeutInnen - PsychotherapieforscherInnen - Kinder- und Jugendlichen-PsychotherapeutInnen - Kinder- und JugendlichenpsychiaterInnen - Kinder- und JugendlichenärztInnen - Erziehungsberatungsstellen - SchulsozialarbeiterInnen - MitarbeiterInnen schulischer Beratungs- und Förderzentren, SchulpsychologInnen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Anna-Konstantina Richter
EMDR bei Sozialen Angststörungen
Unter Mitarbeit von Mira-Lynn Chavanon, Hanna Christiansen und Sabine Röcker
Mit einem Vorwort von André Maurício Monteiro
Impressum
Für dieses Buch und E-Book haben wir eine weiterführende Literaturliste und Tests für Sie zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM96388.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart,
unter Verwendung eines Fotos von © DocStein/photocase
Datenkonvertierung : Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96388-5
E-Book: ISBN 978-3-608-11559-8
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20409-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
1
Einleitung: Warum es dieses Buch gibt – Anliegen, Zielgruppen und Spoiler
1.1 Danksagung
2
Was sind Soziale Angststörungen (SAS)?
2.1 Bezeichnung
2.2 Definition
2.3 Differenzialdiagnosen
2.4 Epidemiologie, Verlauf und Prognose
2.5 Ätiologie
2.6 Risikofaktoren
2.7 Komorbidität
2.8 Einsatz diagnostischer Verfahren
2.9 Zusammenfassung
3
Wie SAS entstehen und was sie ausmacht: Gemeinsamkeiten der Modelle der anderen Richtlinientherapien mit dem EMDR-Störungsmodell, neuere Erkenntnisse aus der Forschung
3.1 Angstnetzwerk-Hypothese von Tillfors: Gehirne sozial ängstlicher Patient/-innen reagieren anders unter Erwartungsangst als die einer nichtklinischen Population
3.2 Das AIP-Modell von Shapiro: »The Past is Present«
3.3 Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley: Über Konsolidierung zur Rekonsolidierung von Erinnerungen und mittels EMDR zur Neokonsolidierung
3.4 Das Flashforward-Modell nach Engelhard: Erwartungsängste bezüglich potenzieller zukünftiger Katastrophen
3.5 Informationsverarbeitungsverzerrungen nach Clark und McManus und was die kognitive Verhaltenstherapie zu Bildern und Erwartungsängsten bei sozial ängstlichen Patient/-innen erforscht hat
3.6 Das NSI-Konzept nach Hackmann sowie Schreiber und Steil und Imagery Rescripting nach Arntz und Weertman
3.7 Psychoanalytischer Blickwinkel zur strukturellen Entstehung von Schamgefühlen und einem beobachtenden Selbst aus Sicht der Alteritätstheorie nach Seidler
3.8 Psychodynamisches Manual für die Kurzzeitbehandlung sozialer Phobien nach Leichsenring et al.
3.9 Zusammenfassung
4
Die Störung erkennen: Bewährte und neue Möglichkeiten der Diagnostik
4.1 Erhebung der biographischen Anamnese bzw. der lerngeschichtlichen Entwicklung
4.2 Interviews: SKID-I bzw. SKID-II, DIPS Open Access und Mini-DIPS Open Access
4.2.1 Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV: SKID-I und SKID-II
4.2.2 DIPS Open Access: Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen
4.2.3 Mini-DIPS Open Access
4.3 Tests: Die SOZAS-Skalen
4.3.1 Beurteilung durch Interviewer/-innen mittels Liebowitz-Soziale-Angst-Skala (
LSAS
)
4.3.2 Selbstbeurteilung mittels Soziale-Phobie-Inventar (
SPIN
) zum Screening von
SAS
4.3.3 Selbstbeurteilung mittels Soziale-Interaktions-Angst-Skala (
SIAS
) und Soziale-Phobie-Skala (
SPS
): Überprüfung von Bewertungs- oder Interaktionsängsten
4.4 Ergänzende Diagnostik wegen der hohen Rate an Komorbidität
4.4.1 Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST)
4.4.2 Beck Depressions-Inventar (BDI-II), Allgemeine Depressions-Skala (ADS)
4.5 Explorationsmöglichkeiten zur Erfassung eines negativ verzerrten Selbstbildes
4.5.1 Die Negatives-Selbstbild-Skala (NSBS) von Richter
4.5.2 Das Waterloo Images and Memories Interview (
WIMI
) von Moscovitch
4.5.2.1 Über die Entwicklung des WIMI
4.5.2.2 Was für Anwender/-innen in der klinischen Praxis aus dem WIMI hilfreich ist
4.6 Das Berner Inventar für Therapieziele (BIT)
4.7 Soziale Angststörung – Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen
4.7.1 Angst und soziale Angst im Entwicklungsverlauf
4.7.2 Warum sollten wir aufmerksam sein für kindliche Ängste?
4.7.3 Diagnostik sozialer Angststörungen im Kindes- und Jugendalter
4.7.4 Erstgespräch und Exploration
4.7.5 Störungsübergreifende Diagnostik
4.7.6 Strukturierte Interviews
4.7.7 Störungsspezifische und therapierelevante Fragebögen
4.7.8 Verhaltensbeobachtung und Wochenprotokolle
4.8 Strukturierung der Diagnostikergebnisse nach dem dreigliedrigen Behandlungsansatz des EMDR mittels EMDR-Arbeitsbogen für SAS
4.9 Fallvignette der Diagnostikphase einer Patientin mit SAS
4.10 Zusammenfassung
5
Wie kann man Soziale Angststörungen mit EMDR behandeln?
5.1 Prozessfaktor Aktivierung von Patient/-innenressourcen mit EMDR
5.2 Behandlungsplanung mit dem EMDR-Arbeitsblatt bei SAS
5.3 Ableitung des EMDR-Erklärungsmodells
5.4 Bewährte Vorgehensweise: Der dreigliedrige Behandlungsansatz des EMDR
5.4.1 Der Ablauf von EMDR Phase 3 – 8:
5.4.1.1 Die störungsspezifische Besonderheit in Phase 3
5.5 Störungsspezifische Ergänzung I: Auflösung des NSI mit dem EMDR-Standardprotokoll in Phase 3
5.6 Störungsspezifische Ergänzung II: Auflösung des Flashforwards/der Erwartungsangst mit EMDR mit der Flashforward-Prozedur nach Logie und De Jongh
5.7 EMDR mit Einsatz der »Working Memory Bomb«: Praktische Umsetzung nach dem Baddeley-Modell zur Verhinderung der Rekonsolidierung belastender Inhalte und zur Ermöglichung von Neokonsolidierung
5.8 Fallvignette der Behandlung eines Patienten mit SAS ausschließlich mit EMDR
5.9 Implementierung der EMDR-Behandlungsphase in die Psychotherapie: Weitere Fallbeispiele und Überlegungen
5.9.1 EMDR vor der Verhaltenstherapie: Fallvignette EMDR vor GSK-Training, kognitiven Interventionen und Verhaltensexperimenten (am Beispiel Depressionen, Leistungsängsten und selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung)
5.9.2 EMDR inmitten der verhaltenstherapeutischen Behandlung: Patientin mit Anpassungsstörungen und SAS
5.9.3 Überlegungen zur Implementierung von
EMDR
in psychoanalytische oder psychodynamische Psychotherapie
5.9.4 EMDR in der stationären Behandlung eines Patienten mit SAS
5.10 Zusammenfassung
6
Was weiß man über die Wirkung von EMDR durch Studien, insbesondere bei Sozialen Angststörungen?
6.1 Anerkennung von EMDR bei der ISTSS und der APA
6.1.1 Befunde zum Wirkmechanismus von EMDR
6.2 Historie von EMDR in Deutschland
6.2.1 Einführung von
EMDR
in Deutschland 1994 an der Klinik Hohe Mark in Hessen
6.2.2 Metaanalyse von Seidler & Wagner:
EMDR
so wirksam bei
PTBS
wie
KVT
6.2.3 Anerkennung von
EMDR
in Deutschland als Richtlinienbehandlung
6.3 Zum besseren Verständnis bisher vorliegender EMDR-Studien zu SAS: Evidenzgrade klinischer Studien, Phasen der Psychotherapieprüfung und Effektstärke von traumafokussierter Psychotherapie
6.3.1 Suchprocedere der vorgestellten EMDR-Studien bei SAS
6.3.2 Studien über EMDR in Leistungssituationen
6.3.2.1 Studie von : EMD und Fingerklopfen bei Prüfungsangst
6.3.2.2 Studie von
6.3.2.3 Studie von
6.3.2.4 Studie von
6.3.2.5 Studie von
Stevens & Florell (1999)
6.3.2.6 Studie von , Veröffentlichung von
6.3.2.7 Studie von
Enright, Baldo & Wykes (2000)
6.3.2.8 Studie von
6.3.2.9 Studie von
Munshi & Mehrotra (2014)
6.3.3 Studien über
EMDR
bei Vortrags- und Auftrittsängsten
6.3.3.1 RCT von
6.3.3.2 RCT von
6.3.3.3 Studie von
Aslani, Miratashi & Aslani (2014)
6.3.3.4 RCT von
6.3.3.5 Drei Fallbeschreibungen über EMDR bei Auftrittsängsten von
6.3.4 Einzelfallstudie über
EMDR
bei sozialen Phobien von
Sun & Chiu (2005)
6.4 Warum wir die Behandlung mit EMDR erwägen sollten: Die hohe Nonresponderquote bei verhaltenstherapeutischer oder psychodynamischer Behandlung und die hohe Effektstärke von Psychotraumatherapie
6.5 Konsequenzen für Forschung und Lehre: Empfehlungen bezüglich EMDR bei SAS
6.5.1 Erweiterung der Diagnosekriterien für
SAS
im
DSM
-5 und
ICD
-10
6.5.2 Erweiterung diagnostischer Interviews in den
SAS
-Teilen
6.5.3 Zukünftige Studien bei SAS und EMDR: Verschiedene Überlegungen aus der Psychotherapieforschung
6.5.3.1 Müssen Studienleiter/-innen EMDR-Therapeut/-innen sein?
6.5.3.2 Mögliche Fragestellungen und Designs für Studien zu EMDR bei SAS
6.5.3.3 Prävention sozialer Traumatisierung – mehr als eine Utopie
6.5.4 Weshalb es sich lohnt: Der Feuertiger in eigenen Worten
7
Supervisorische Hinweise für die Anwendung von EMDR
8
Anhang
8.1 Anamnesebogen von Gravemeier Version A (mit freundlicher Genehmigung des Autors)
8.2 Anamnesebogen von Gravemeier (Version A.2) (mit freundlicher Genehmigung des Autors)
8.3 Berner Inventar für Psychotherapieziele: Zielcheckliste von Grosse Holtforth und Grawe (mit freundlicher Genehmigung des Autors)
8.4 EMDR-Arbeitsblatt bei SAS von
8.5 EMDR-Worksheet Social Anxiety Disorder (SAD) by
8.6 NSBS von Richter (1. Arbeitsversion)
8.7 Ermittlung des Flashforward
8.8 Ansteuern des NSI mit EMDR
Literaturverzeichnis
Literatur zu Unterkapitel 4.7 Soziale Angststörungen – Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen
Stichwortverzeichnis
Im April 2018
wurde das Verfassen
dieses Buches begonnen,
und es ist
Irmela Florin
(1938 – 1998)
Professorin für Klinische Psychologie
der Philipps-Universität Marburg
gewidmet, die im April 2018
80 Jahre alt geworden wäre
und von der ich in
ihrer letzten Vorlesung das erste Mal
von EMDR hörte.
»Die Psychologie und Psychotherapie wird auf Irmela Florins Einsichten und experimentelle Befunde zurückkommen, auch wenn die Zeit dafür noch nicht reif ist. Dies wird spätestens unter dem Druck der Betroffenen und ihrer Angehörigen und der Kosten ineffizienter Verbalpsychotherapie geschehen.«
Niels Birbaumer (1999), Nachruf auf Irmela Florin
»Ich habe nachträglich entdeckt, dass Lakatos (1976) und mutmaßlich Popper selbst später das Vertrauen in die Falsifikation aufgegeben haben, indem sie argumentierten, dass das Kennzeichen einer guten Theorie sein sollte, dass sie produktiv ist, indem sie nicht nur vorhandenes Wissen wiedergibt, sondern auch fruchtbare Fragen aufwirft, die unser Wissen vergrößern werden. Diese eher landkartenartige Sichtweise auf Theorie an sich ist eine, die ich fortsetze einzunehmen.«
Alan Baddeley (2012), S. 4 (Übers. A.-K. Richter)
Abkürzungsverzeichnis
ÄPÄrztliche/r Psychotherapeut/-in
ADSAllgemeine Depressions-Skala
AIP-ModellModell der adaptiven Informationsverarbeitung (Adaptive Information Processing Model) nach Shapiro
Baby-DIPSDiagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter
BDI-IIBeck-Depressions-Inventar Revision
BIT_CP_DBerner Inventar für Therapieziele Therapiezielcheckliste Patientenversion
DIPS Open AccessDiagnostisches Interview bei psychischen Störungen
DSM-5Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
EGExperimentalgruppe
EMDREye Movement Desensitization and Reprocessing
ICD-10 Kapitel V (F)Internationale Klassifikation psychischer Störungen
IRRTImagery Rescripting & Reprocessing Therapy
KGKontrollgruppe
Kinder-DIPS Open AccessDiagnostisches Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter
KJPKinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut/-in
KVTKognitive Verhaltenstherapie
LASTLübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test
LSASLiebowitz-Soziale-Angst-Skala (Liebowitz Social Anxiety Scale)
Mini-DIPS Open AccessDiagnostisches Kurzinterview bei psychischen Störungen
NStichprobenumfang gesamt
nStichprobenumfang Teilgruppe
NKnegative Kognition
NSINegative Distorted Self-Image (negativ verzerrtes Selbstbild)
NSBSNegatives-Selbstbild-Skala
NSPSNegative Self-Portrayal-Scale
PDPPsychodynamische Psychotherapie
PKpositive Kognition
PPPsychologische/r Psychotherapeut/-in
RCTrandomisierte kontrollierte Studie (randomized controlled trial)
SASSoziale Angststörung
SETSupportiv-expressive Therapie
SIASSoziale-Interaktions-Skala (Social Interaction Anxiety Scale)
SKID-IStrukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV, Achse I: Psychische Störungen
SKID-IIStrukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV, Achse II: Persönlichkeitsstörungen
SORKC-Modellverhaltenstherapeutisches Modell nach Frederick Kanfer, bestehend aus Stimulus (S), Organismusvariable (O), Reaktion (R), Kontingenz (K) und Konsequenz (C – consequence)
SOZASSkalen zur Sozialen Angststörung
SPINSoziale-Phobie-Inventar (Social Phobia Inventory)
SPSSoziale-Phobie-Skala (Social Phobia Scale)
SUDSubjective Units of Disturbance nach Wolpe, 1969 (Skala von 0 »neutral« bis 10 »maximal vorstellbare Belastung)
WIMIWaterloo Images and Memories Interview
ZBKTZentrales Beziehungskonflikt-Thema
Vorwort
Wir schreiben das Jahr 2014. Ich besuche die EMDR Europe-Konferenz in Edinburgh. Es ist das erste Mal, dass ich einem größeren Publikum etwas auf Englisch vortrage. Ich bin nervöser als sonst. Als ich mit dem Vortrag der Präsentation beginne, wird mein Mund trocken. Ich habe Probleme bei dem Versuch, mit der Flasche Wasser auf dem Rednerpult klarzukommen bei gleichzeitigem Präsentieren meiner PowerPoint-Folien. Die Strahler beleuchten das Podium besonders hell. Ich fühle mich, als ob ich an emotionaler Taubheit leide und niemanden vor mir erkenne. Ich kann die Buchstaben im gedruckten Text kaum unterscheiden. Das Verteidigungs-Aktions-System ist voll im Gange. Ein großartiges Beispiel dafür, was für ein Spiel soziale Ängste treiben!
Ich verlasse die Bühne, und meine Augen passen sich an die dunklere, behaglichere Umgebung an. Das ist der Moment, in dem Konstantina zu mir hochkommt, sich vorstellt, etwas Ermutigendes sagt und sich über das Thema meines Vortrags interessiert äußert. So lernen wir uns das erste Mal kennen. Es scheint, als ob das subjektive Drama auf dem Podium gut genug verborgen war. Der bedauerliche Vorfall ist kein Thema mehr.
Das ist die Light-Version eines Moments, den wir möglicherweise alle erleben können. Er bietet einen kurzen Blick darauf, wie furchtbar es sein muss, diese Gefühle und körperlichen Wahrnehmungen jedes Mal zu empfinden, wenn der Scheinwerfer bedrohlich auf uns gerichtet wird.
Wir blenden ein paar Jahre vor, und Konstantina lädt mich ein, ein Vorwort für dieses großartige Buch über EMDR und soziale Ängste zu schreiben, das sie gerade fertigstellt. Nichts passt besser zu der Erfahrung unseres ersten Kennenlernens!
Als ich das Manuskript bekomme, dauert es nicht lange, um zu erkennen, dass Konstantinas Werk ein geborener Klassiker über das Thema ist. Es ist, als ob sie die Hand des Lesers ergreift und uns einen sanften Rundgang bezüglich des Themas »soziale Angst« anbietet. Wir als Therapeuten werden erkennen, dass wir das Buch im Einklang mit den Schritten lesen können, die wir intuitiv im Alltag unserer Praxis unternehmen.
Es beginnt mit dem Rapport, wenn wir den Klienten anfangs kennen lernen, den Symptomen, die üblicherweise auftauchen, noch bevor der Klient fähig ist, mit uns eine therapeutische Beziehung einzugehen. Der Klient trägt seine Klagen direkt vor, insbesondere wenn Angst im Spiel ist. Der erste Kontakt aktiviert unsere theoretischen Modelle. Konstantina setzt Symptomatik, relevante Literatur und Forschung mit Anmut und Leichtigkeit miteinander in Beziehung. Das Adaptive Information Processing (AIP)-Modell, welches EMDR zugrunde liegt, wird von ihr auf eine sehr didaktische Art und Weise vorgestellt.
Während wir im Geiste mit einer Sitzung voranschreiten, könnten wir bestätigende Informationen durch die Nutzung von psychometrischen Tests benötigen, die die Diagnose bekräftigen. Das Buch bietet Beispiele für psychometrische diagnostische Möglichkeiten. Die gesamte Fallkonzeption führt auf natürliche Weise zur therapeutischen Intervention. Und das genau ist der Moment, in dem das Buch sich entfaltet. Konstantina versorgt uns mit klärenden Fallvignetten, die die theoretischen Konzepte erhellen und eine verständliche Integration von Theorie und Phasen der EMDR-Therapie bringen.
Dann erweitert Konstantina den Geltungsbereich des Buches, indem sie historische und regionale Charakteristika der EMDR-Therapie in Deutschland gemäß dem three-pronged approach, dem dreigliedrigen Ansatz des EMDR beschreibt: Sie beginnt damit, wie die Dinge entstanden sind, fährt fort mit dem augenblicklichen Status im deutschsprachigen Raum und einigen zukünftigen Möglichkeiten.
Oft mahnt die Entwicklerin der EMDR-Therapie, Dr. Francine Shapiro, zu forschen und ein systematisches Studium der EMDR-Anwendung auf verschiedene Störungsbilder zu verfolgen. Dieses Buch ist mit größter Sicherheit eine Antwort auf Dr. Shapiros Forderung, präsentiert auf eine zugängliche Art und Weise, durch die EMDR-Therapeuten das Schicksal der Klienten mit Sozialer Angststörung besser verstehen und behandeln.
Dr. André Maurício Monteiro
Brasília, im August 2018
EMDR Trainer of Trainers EMDR Institute (USA)
EMDR-Trainer (akkreditiert durch EMDR Europe und EMDR Ibero-América)
Gründungspräsident der brasilianischen EMDR-Fachgesellschaft
Ehrenmitglied der portugiesischen EMDR-Fachgesellschaft
Ehemals Professor der katholischen Universität Brasília
1
Einleitung: Warum es dieses Buch gibt – Anliegen, Zielgruppen und Spoiler
Silk or leather or a feather
Respect yourself and all of those around you
Prince Charming
Prince Charming
Ridicule is nothing to be scared of
»Prince Charming«, Adam and the Ants, 1981
Es gibt dieses Buch aus zwei Gründen.
Erstens gibt es zwar Psychotherapien für Soziale Angststörungen (kurz SAS) mit hohen Effektstärken für kognitive Verhaltenstherapie (kurz KVT) und Psychodynamische Psychotherapie (kurz PDP), die Nonresponderquote mit bis zu 48 % (Leichsenring et al., 20131) ist aber so hoch, dass die Autor/-innen u.a. ergänzend eine andere Art Psychotherapie in Betracht ziehen (S. 765). Eine Diskussion zu diesem Thema anzustoßen, Psychotherapeut/-innen Wissen und Handlungsvorschläge mittels einer anderen Art der Psychotherapie, nämlich EMDR, für die Behandlung Sozialer Angststörungen anzubieten und weitere Forschung zum Thema anzuregen – das ist ein Ziel dieses Buches.
Beiträge wie die von Ströhle und Fydrich (2018) bedürfen einer deutlichen Ergänzung über das Wesen der Störung, die sich eben nicht nur durch Vermeidungsverhalten und »negative, selbstbezogene und generalisierte Gedankenmuster« (S. 272) auszeichnet und sich daher nicht nur durch Verhaltensexperimente und kognitive Interventionen behandeln lässt – sonst gäbe es die hohe Nonresponderquote nicht. In den verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Manualen zur Sozialen Angststörung von Stangier, Clark, Ginzburg und Ehlers (2016) sowie Leichsenring, Beutel, Salzer, Haselbacher und Wiltink (2015) ist von der hohen Nonresponderquote nicht die Rede, lediglich in der o. g. Publikation der Erstautoren der Manuale, so dass es für die Kliniker/-innen in der Praxis, die eher die Manuale als die Publikationen in den Journals lesen, schwer ist, von der Lücke in der Wirksamkeit zu wissen. Im neuen Manual von McEvoy, Saulsman und Rapee (2018) über mit Imagery (zu deutsch »bildliche Vorstellung, Imagination«) verbesserte KVT wird das Problem offen genannt, bisher steht dieses Werk jedoch nur in englischer Originalfassung zur Verfügung.
Ein weiteres Ziel ist es, mit diesem Buch für strukturierte Psychodiagnostik zu werben, denn bei meinen Recherchen zu diesem Thema ist mir ein weiteres eklatantes Problem aufgefallen: Patient/-innen mit SAS werden oftmals nicht als solche erkannt. Wenn man das weiß, wundert es einen auch nicht, denn es ist störungsimmanent, nicht peinlich auffallen zu wollen. Als Verfechterin einer strukturierten Psychodiagnostik sehe ich hier einmal mehr, dass es wichtig ist, diesen Sachverhalt zu verbessern – daher enthält dieses Buch aktuelle Hinweise auf Material, das den Kolleg/-innen dabei helfen möge, in der probatorischen Phase in der ambulanten Praxis bzw. bei der stationären Aufnahme zu erkennen, welche der depressiven oder alkoholabhängigen Patient/-innen nicht eventuell SAS als Indexdiagnose haben (s. Kap. 4).
Strukturierte Psychodiagnostik stellt immer wieder ein Reizthema unter Kolleg/-innen dar; so erinnere ich eine Supervision, in der mir als Psychotherapeutin in Ausbildung (kurz PiA) gesagt wurde, strukturierte Diagnostik wie mit dem DIPS-Interview mache man nur in der Forschung, und mein damaliger Supervisor stelle nach der zweiten probatorischen Sitzung die Diagnose(n) sowie den Antrag auf Psychotherapie. »Wie willst du Störungen erkennen, die mit Vermeidung einhergehen, wenn du nicht mit einem Interview danach fragst?« fragte ich meinen Supervisor, der mir Recht gab. Und genau vor diesem Problem stehen wir bei unseren Patient/-innen mit SAS. An dieser Stelle wird Birbaumer mit obigem Zitat über zum Teil ineffiziente Verbalpsychotherapie und Druck, der von Betroffenen und deren Angehörigen kommen wird, Unrecht haben, denn sozial ängstliche Patient/-innen werden keinen Druck machen, diagnostische und psychotherapeutische Herangehensweisen zu ergänzen bzw. zu ändern: Störungsimmanent tarnen sie sich, um Peinlichkeit zu entgehen. Der Druck, den er prognostiziert, und die Wahl der richtigen Konsequenzen werden von uns Behandler/‑innen ausgehen müssen. Als akkreditierte verhaltenstherapeutische und EMDR-Supervisorin ist es mir mit diesem Buch ein Anliegen, meine Kolleg/‑innen nach Kräften zu unterstützen, in der Praxis gut einsetzbares Diagnostik-Material zu implementieren und die Wirksamkeit von Psychotherapien zu verbessern.
Wahrscheinlich ist dies das weltweit erste Buch überhaupt zum Thema EMDR bei SAS. Mein persönlicher Weg zur Autorinnenschaft eines solchen Buches sah folgendermaßen aus: Als Psychotherapeutin in Ausbildung in der Klinik Hohe Mark in Oberursel bei Frankfurt am Main habe ich begeistert auf unserer Station das verhaltenstherapeutische Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK-Training) von Hinsch & Pfingsten kennengelernt. An unserem Verhaltenstherapie-Ausbildungsinstitut, der GAP (Abkürzung für »Gesellschaft für Ausbildung in Psychotherapie«) in Frankfurt am Main, haben mein Kollege Dipl.-Psych. Jörg Stenzel und ich GSK-Gruppen auch ambulant angeboten, um unsichere oder aggressive Menschen dabei zu unterstützen, selbstsicherer zu werden.
Ich hatte zuvor Verhaltenstherapie im Studium an der Philipps-Universität Marburg in der letzten Vorlesung »Klinische Psychologie« von Irmela Florin kennengelernt (das muss im WS 1997/1998 gewesen sein), bevor sie viel zu früh verstorben ist, und es gab für mich zu diesem Zeitpunkt nie die Frage, etwas anderes zu lernen als Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie war das, was wirkte, und man sollte für seine Patient/-innen Therapieverfahren lernen, die wirken, so bin ich in Marburg sozialisiert worden (ab meinem ersten Semester, WS 1995/96, war Tiefenpsychologie aus dem Studienplan verschwunden). Jedoch berichtete Frau Florin uns in ihrer letzten Vorlesung »Klinische Psychologie« auch von EMDR, dieser wirksamen neuen Therapie, von der man nur noch nicht wisse, warum sie wirksam sei.
Als PiA kam ich der EMDR-Therapie deshalb näher, weil die Klinik Hohe Mark die deutsche Keimzelle des EMDR-Verfahrens ist – dort tätige Psychotherapeut/‑innen hatten in den 90er Jahren in den USA von Francine Shapiro EMDR gelernt und in Deutschland verbreitet (s. Kap. 6). Der damalige Verhaltenstherapie-Supervisor aller PiA der Klinik, Dipl.-Psych. Dieter Herrmann, ist auch ein EMDR-Therapeut, aber was dieses EMDR genau war, erschloss sich mir damals noch nicht, ich bekam nur mit, wenn unsere Patient/-innen auf unserer allgemeinpsychiatrischen Privatstation von einer Sitzung bei ihm kamen, weil sie bei ihm z. B. Traumata mittels EMDR bearbeitet hatten. Ich gehörte nicht zu den PiA, die an der Reihe waren, bei einer EMDR-Sitzung zu hospitieren, so hatte ich keine Ahnung, was dieses EMDR genau war. Genau das war der Grund, weshalb ich in der Zeit meines Staatsexamens in der Klinik Hohe Mark im dortigen Kirchsaal sofort den ersten EMDR-Baustein lernte (das sogenannte EMDR Level 1), obwohl sich an meinem Verhaltenstherapie-Institut eine Dozentin heftig gegen EMDR ausgesprochen hatte: Ich war total gespannt darauf, was dieses EMDR denn nun war; intuitiv zog es mich zu EMDR, und es folgten sukzessive die Zertifizierungen als EMDR-Therapeutin und später als EMDR-Supervisorin durch die Dachgesellschaft EMDR Europe.
Ich lernte EMDR von einem tiefenpsychologisch fundierten Psychiater und Psychotherapeuten (was sehr spannend war – das waren Termine, auf die ich mich immer freute), und es sollte lange Zeit so bleiben, dass ich kaum auf Kolleg/-innen traf, die wie ich Verhaltenstherapeut/-in undEMDR-Therapeut/-in waren. Das brachte mir zwar ergänzendes psychodynamisches Wissen, das ich noch nicht hatte, aber mir fehlte jemand, der mir in Sachen KVT und EMDR »Entweder-oder«-Fragen beantworten konnte.
Im Jahre 2014, anlässlich der 15. Europäischen EMDR-Konferenz in Edinburgh, saß ich in einem Vortrag am Ende der Konferenz und schon mehr auf Abflug eingestellt, als ich auf einmal hellwach war, denn der Redner, EMDR-Trainer Prof. Dr. Ad De Jongh von der Universität Amsterdam, brachte in seinem Vortrag über »Treatment of Fears and Phobias with EMDR« Fragen aufs Tapet, die auch mich immer wieder beschäftigt hatten: Sollte ich für die Behandlung meiner Angstpatient/-innen EMDR oder KVT anwenden? Ad, zu Beginn seines Berufslebens Zahnarzt und später als Psychologe Spezialist für die Behandlung spezifischer Phobien (er war über die Schnittstelle »Zahnarztangst« zu dem Thema gekommen), exerzierte mit dem Publikum durch, wann man nach Verständnis des Wesens einer Störung Verhaltenstherapie und wann EMDR anwenden sollte, und obschon er nicht für alle Angststörungen EMDR empfahl, zeigte er dem Publikum etwas, das ich als Paradigmenwechsel verstand: dass der Kern der meisten psychischen Störungen, in denen Angst eine Rolle spiele, Erwartungsangst sei, ein »Flashforward« (als Gegenbegriff zum bekannten Flashback, s. Abschnitt 3.4), den es mit EMDR zu behandeln gelte, und dass es etliche Studien gebe, die zeigten, dass EMDR Ängste und Phobien schneller behandle als KVT und dass die Follow-up-Werte besser seien. Zudem seien die Verhaltenstherapie-Studien überaltert, die die Dominanz der Verhaltenstherapie begründen sollten. Er forderte mehr Studien zu EMDR bei Angststörungen.
Dieser Vortrag hat mich zutiefst beeindruckt, denn dass jemand für mich sortierte, wann man was anwendet, wo EMDR erwiesenermaßen überlegen sei oder überlegen sein könnte, das hat mich seither bewegt. In späteren Gesprächen mit Ad und anderen Forscher/-innen zu diesem Thema, sei es aus verhaltenstherapeutischer oder EMDR-Sicht, hat sich für mich dann herauskristallisiert, mich mit diesem Sachverhalt bezüglich SAS zu beschäftigen und meinen Beitrag zu leisten zu Ads Forderung, in diesem Bereich mehr zu forschen.
»Wieso?«, hat mich vor einigen Monaten eine Kollegin gefragt. SAS sei doch gut behandelbar. Leider nicht ohne Einschränkungen, wie die o. a. Studie von Leichsenring et al. (2013) zeigt. Ich denke, dass es sich bei der dort von den Autor/‑innen vermuteten anderen Psychotherapieform, die nötig sei, (auch) um EMDR handelt, und daher habe ich zusammengetragen, was man bisher darüber weiß (Kap. 3 und Kap. 6) und wie meine und die Erfahrungen anderer erfahrenen Kolleg/‑innen sind, SAS mit EMDR zu behandeln (Kap. 5).
Dieses Buch richtet sich also an approbierte Kolleg/-innen als Hilfe für ihre diagnostische und psychotherapeutische Arbeit (Kap. 3, 4 und 5); es richtet sich an Kolleg/-innen, die in der Forschung arbeiten, um zu zeigen, wo EMDR bezüglich Wirksamkeitsnachweisen zum Thema SAS steht (Kap. 6) und welcher Art weiterer Studien es bedarf. Psychotherapeut/-innen in Ausbildung (hoffentlich bald Psychotherapeut/-innen in Weiterbildung) und Assistenzärzt/-innen sind als Leser/-innen ebenso willkommen wie wissbegierige Studierende der Studienrichtung Klinische Psychologie und Psychotherapie (demnächst: Psychotherapie-Studierende).
Lassen Sie sich bitte nicht von meinem Einstieg abschrecken, wenn Sie kein(e) Verhaltenstherapeut/-in sind – auch meine Welt hat sich weitergedreht (z. B. in Form von Intervisionsgruppen mit tiefenpsychologisch fundiert arbeitenden Kolleg/-innen, Zentrumsgründung mit einer tiefenpsychologisch, gestalttherapeutisch, hypnotherapeutisch und systemisch arbeitenden Kollegin): Leser/‑innen anderer Therapieschulen sind herzlich willkommen, und ich habe mich bemüht, Antworten auf deren mögliche Fragen zu »EMDR + Psychoanalyse bzw. psychodynamischer Psychotherapie« durch Lektüre meines Kollegen (als EMDR-Supervisor) und Mentors Günter H. Seidler, seines Zeichens Kontroll- und Lehranalytiker, in seinem umfangreichen Werk zu finden, der für mich ein inspirierender Autor der Therapieschule ist, der ich nicht angehöre (Unterkap. 3.7 und 3.8). Dies war ein Prozess, der mir selbst nochmal viele wichtige Informationen brachte, die ich sehr gern mit den Leser/-innen teilen möchte. Es würde mich sehr freuen, wenn die Leser/-innen diesen Entstehungsprozess nachvollziehen würden, indem auch sie Sichtweisen eigener und anderer Therapieschulen lesen und dadurch einen Weg beschreiten, wie ihn z. B. Grawe mit einer Auflösung einer unproduktiven Trennung im Umgang mit Therapieschulen vorgeschlagen hat. Dieses Buch ist daher auch an Fachgesellschaften und Berufsverbände adressiert, Institutionen der psychotherapeutischen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie an Psychotherapieforscher/-innen.
Letztendlich ist dieses Buch für die sozial ängstlichen Patient/-innen gedacht – für den Dienst an ihnen gemäß der Wortbedeutung von »Therapie« (altgriechisch Θεραπεία für »Dienst, Pflege, Heilung«).
Wir alle, die dieses Buch lesen, stehen im therapeutischen Alltag mit Mitgefühl unseren Patient/-innen bei, die sich mit einer verzerrten Sicht auf sich selbst quälen (s. Abschnitt 3.6 über negativ verzerrte Selbstbilder), an denen das Leben vorbeigeht, weil sie am Leben ganz oder teilweise nicht teilnehmen. Sollten Sie sich als Behandler/-in diesbezüglich bisher hilflos gefühlt haben, weil die Behandlung nicht so recht anschlug und Sie auf Nonresponder/-innen stießen, hoffe ich sehr, dass meine und unsere Arbeit zum Thema wiederum Ihnen dienlich ist.
1.1 Danksagung
I always said you could make it
Blondie, »Will anything happen«, 1978
So wie es heißt, es brauche ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, bedurfte es des Äquivalentes eines Dorfes, um dieses Buch zu verfassen, und dieses »Dorf« möchte ich den Leser/-innen gern vorstellen:
Ich bin dankbar dafür, dass ich Frau Prof. Dr. Irmela Florin † (Philipps-Universität Marburg) kurz vor ihrem Tod im Jahr 1998 kennenlernen und von ihr lernen durfte. Dieses Buch ist ihr deshalb anlässlich ihes 80. Geburtstags gewidmet, weil sie auch als schwerkranke Frau gegen Ende ihres Lebens vermittelt hat, wie viel Spaß Klinische Psychologie und Psychotherapie machen können. Sie war eine zutiefst vorbildliche Förderin des Nachwuchses, wie Ehlers (1999), Margraf (1999) und Birbaumer (1999) beschreiben und wie es auf der Website des Fachbereiches Psychologie der Universität zu lesen ist als Erklärung dafür, dass dieser Fachbereich »Professorenschmiede«2 genannt wird. Frau Florin war eine freundliche Frau, die Autorität ausstrahlte und Menschen wahrnahm, ohne Angst zu machen oder zu demütigen. In dem Zeitraum, in dem Frau Florin und ich unmittelbar miteinander zu tun hatten, durch die o. a. Lehrveranstaltung, aber auch in einer Habilitationskommission, in der wir beide Mitglieder waren, hatte sie die Fachschaft Psychologie eingeladen, kurz vor ihrem Tod in ihrem Haus ihren Weinkeller leerzutrinken und gemeinsam zu feiern. Sie sprach mich auf gütige und wertschätzende Weise auf den Umstand an, dass sie wahrnahm, dass ich eine studierende Mutter war, die mit kleinem Kind Lehrveranstaltungen besuchte, und sie machte mich sprachlos mit der Bemerkung, wie viel ich ihr voraushätte, indem ich Mutter sei. Ich danke Frau Florin für ihr Vorbild, und ich versuche nun, sie als Inspiration dafür zu sehen, was sie mir voraushatte: Im Zuge des Verfassens dieses Buches schaffte ich mir noch fehlende Bücher von ihr an, die als vergilbte antiquarische Ausgaben ihren Weg zu mir fanden und die ich mit Rührung las. Ich vermisse sie, und sie dient mir als Rollenvorbild. Durch ihren viel zu frühen Tod bedurfte es allerdings eines Förderers im Diesseits, dieses Buch zu verfassen.
Dieser Förderer im Diesseits ist Herr Prof. Dr. med. Günter H. Seidler (ÄP, EMDR-Supervisor in Dossenheim b. Heidelberg), dem ich sehr für die Einladung, dieses Buch zu schreiben, danke, außerdem für die stets freundliche und aufbauende Kommunikation und seinen festen Glauben an mich (in der Sprache von Blondie: He always said I could make it). Ich danke ihm außerdem für sein inspirierendes Vorbild als Forscher, Autor, Psychotherapeut und Berufspolitiker, der in persona eine Schlüsselrolle bei der Anerkennung von EMDR in Deutschland spielte (s. hierzu die Abschnitte 6.2.2 und 6.2.3). Seidler zu lesen, verursachte mir eine besondere Freude im Geist, und damit hat er eine Messlatte gesetzt, an der ich mich in meinem weiteren Leben orientieren werde. Zudem verdanke ich Herrn Seidler die kostbare Erfahrung, Chancen bekommen zu haben (eine hilfreiche positive Kognition), und er erfüllte die Verheißung der verstorbenen Frau Florin, dass es Menschen gibt, die Möglichkeiten eröffnen.
Mein Kontakt zu Herrn Seidler ist ab 2014 entstanden, weil ich ihm als Experten immer wieder Fragen zu EMDR und Forschung gestellt hatte, und unsere Begegnung zeigt, wie wichtig es ist, dass man fähig ist, Kontakt zu knüpfen und aufrechtzuerhalten – etwas, das vielen sozial ängstlichen Patient/-innen nicht möglich ist. Diese Fähigkeit kam in der Zusammenarbeit mit allen hier genannten Personen immer wieder zum Tragen. Meist habe ich den Anstoß gegeben, aber es gab immer wieder erfreuliche positive Resonanz, die auf mich zukam, wie bei Frau Dr. Chavanon, der ich (wieder)begegnete, da sie die Ringveranstaltung »Berufsfelder der Psychologie« am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg organisiert, zu der ich seit 2014 einen Beitrag leiste, indem ich den Studierenden die Arbeit als niedergelassene Psychotherapeutin vorstelle. Frau Dr. Chavanon würdigte mein Forschungsinteresse, meine Beschäftigung mit Sozialen Angststörungen, mir gegenüber auf sehr wertschätzende Weise (auch das eine Fähigkeit, die sozial ängstlichen Patient/-innen schwerfallen kann: Kontakt verfestigen durch positive Verstärkung), und später konnten wir feststellen, dass wir uns aus dem Studium kannten (was das Ziel des Kontaktknüpfens ist: auf Gemeinsamkeiten stoßen).
Mein herzlicher Dank gilt daher ganz besonders Frau PP Dr. Mira-Lynn Chavanon sowie Frau PP Prof. Dr. Hanna Christiansen (beide Philipps-Universität Marburg) für ihre tatkräftige Unterstützung, dem Buch ein Unterkapitel über Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Sozialen Angststörungen beizusteuern. Auch Frau Dr. med. Sabine Röcker, ÄP und leitende Ärztin der Privatklinik Hohenegg in Meilen in der Schweiz, bin ich zu Dank verpflichtet für den Beitrag einer Fallvignette; sie hatte mir anlässlich der EMDR-Konferenz in Straßburg 2018 von ihren guten Erfahrungen in der Behandlung sozial ängstlicher Patient/-innen mit EMDR berichtet und war so freundlich, ein Beispiel hierfür zu notieren und uns daran teilhaben zu lassen. Gemeinsam haben wir es als Autorinnenkleeblatt geschafft, Gegensätze zu vereinen und Pluralität zu schaffen: Ärztliche und Psychologische Psychotherapeutinnen, die ambulant und stationär arbeiten und die außerdem die fruchtbare Kooperation und das Miteinander von akademischer und klinisch-praktischer Welt repräsentieren. Ich danke den Kolleginnen dafür, dass wir zeigen, dass es ein Gegenkonzept zur weitverbreiteten gegenseitigen Abwertung und zu den Spaltungen unserer beruflichen Teilwelten gibt. Eine Zersplitterung unserer professionellen Landschaft schwächt, und dieses Buch ist ein Beitrag dazu, dem entgegenzuwirken.
Weiterhin danke ich dem EMDR-Trainer Dr. med. Michael Hase (ÄP in Lüneburg) für seinen freundlichen und interessierten Zuspruch bezüglich meiner Arbeit zum Thema EMDR bei SAS, seitdem er der Chair meines Workshops zum Thema dieses Buches beim EMDRIA-Tag 2017 in Bonn war.
Herrn Dr. Heinz Beyer (Klett-Cotta Verlag, Stuttgart) gebührt mein herzlicher Dank für sein inhaltliches Interesse an EMDR und seine Rolle als Multiplikator für das Thema EMDR bei meinem ersten Buch mit dem Greif. Herr Dr. Beyer hat sich im Entstehungsprozess dieses Buches viele Stunden Zeit genommen, meine Weltsicht bezüglich EMDR anzuhören und seitenweise diesbezügliche Beschreibungen über die Psychotherapiewelt durchzulesen, mit denen ich ihn behelligte, und es war ein faszinierender Prozess zu erleben, wie er meine Infos aufnahm und umsetzte und die Essenz meiner Sicht der Dinge bei ihm ankam. Daraus ist etwas sehr Fruchtbares entstanden.
Ich danke meinem EMDR-Trainer und Vorbild Dr. med. Franz Ebner (ÄP in Oberursel/Ts. und Institutsambulanz der Klinik Hohe Mark, Frankfurt am Main) für sein Vertrauen in mich, während ich das Buch schrieb (»Das wird schon«) und auch an dieser Stelle für die Freude und Faszination, die ich erlebte dadurch, bei ihm EMDR zu lernen (und zwar auf Fränkisch – Kontextreiz). Es war jede Minute atemberaubend, ich habe mich immer, immer auf jede einzelne EMDR-Supervision bei ihm gefreut; ich habe seit EMDR Level 1 bei ihm das Gefühl gehabt, jetzt die Welt zu verstehen, und ich vertraue weiter dem Prozess3. Auch danke ich meinen beiden anderen EMDR-Trainern Dr. Michael Paterson, OBE (Belfast) und Sandi Richman (London), von denen ich in freundlicher Atmosphäre viel lernen durfte.
Prof. Ad De Jongh PhD, EMDR-Trainer von der Universität Amsterdam, danke ich dafür, durch ihn die EMDR-Flashforward-Prozedur und die »Working Memory Bomb« (s. Abschnitt 5.7) kennengelernt zu haben und für seine stets großzügige und zügige Überlassung von Material. Ebenso danke ich der Autorin des Flashforward-Konzeptes, Frau Prof. Iris Engelhard PhD (Utrecht) für ihre freundliche Unterstützung und Angebote bei allen Fragen zum Thema.
PP Prof. Dr. Thomas Heidenreich von der Fachhochschule Esslingen hat mich freundlicherweise mit Informationen über die SOZAS-Skalen versorgt. Weiterhin danke ich Prof. David Moscovitch PhD von der University of Waterloo, Kanada, dafür, dass ich zu Studienzwecken von ihm das WIMI-Interview bekommen habe. Auch PP Dipl.-Psych. Ralf Gravemeier (Marl) war so freundlich, einen gewünschten Beitrag zu leisten, indem ich sein Formular für die Erhebung der biographischen Anamnese für dieses Buch verwenden und der Kolleg/-innenschaft vorstellen darf. PP Prof. Dr. Silvia Schneider von der Ruhr-Universität Bochum war (wie stets in den letzten Jahren, wenn es um Fragen zum DIPS ging) so freundlich, mir Fragen zu beantworten und mich auf die neue Open Access-Version des DIPS aufmerksam zu machen sowie mir neue Publikationen zum Thema zu schicken, die in dieses Buch eingeflossen sind, und ich danke ihr und Herrn PP Prof. Dr. Jürgen Margraf (ebenfalls Ruhr-Universität Bochum) dafür, dass ich den SAS-Teil des DIPS und Mini-DIPS zwecks ausführlicher Besprechung ausschnittweise zitieren darf.
Auch Prof. Alan Baddeley PhD von der University of York danke ich für seine Unterstützung. Es war hilfreich, zentrale Gedanken bezüglich des Arbeitsgedächtnisses von ihm nachlesen zu können in klassischen Publikationen, die zum Teil vergriffen waren und die ich direkt von ihm beziehen konnte.
Herr Dipl.-Soz.-Päd. Gottfried Cramer, Leiter Kommunikation und Marketing der Klinik Hohe Mark in Oberursel/Ts., war stets eine zügige tatkräftige und freundliche Unterstützung, indem er mich mit Material zur Historie von EMDR in der Klinik Hohe Mark versorgte, wofür ich ihm sehr danke.
Herr Dr. Dominik Klenk war so freundlich zu gestatten, dass sein Zeitungsartikel über die Einführung von EMDR an der Klinik Hohe Mark aus 1994 noch einmal in diesem Buch abgedruckt wird, dafür an dieser Stelle meinen herzlichen Dank.
Auch Herr Prof. Dr. med. Martin Sack, ÄP und EMDR-Supervisor von der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum rechts der Isar in München war so freundlich, mir Zugang zu wichtigen Publikationen über EMDR zu gewähren, daher geht mein Dank auch an ihn.
Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Uwe Eckart (Heidelberg), Medizinhistoriker und Mitglied der Leopoldina, war so freundlich, Kapitel 6 über die Geschichte und Forschung bezüglich EMDR vor Abgabe des Buches prüfend zu lesen und mir Material beizusteuern. Für seine freundliche Offenheit, dafür Zeit zu opfern, bin ich ihm sehr dankbar. Auch danke ich PP Dipl.-Psych. Oliver Schubbe (Berlin), ab 1999 als EMDR-Trainer anerkannt, für seine Zeit, mir einiges über die Historie von EMDR-Institutionen erklärt zu haben, und EMDR-Therapeutin PP Dipl.-Psych. Tabea Freitag (Haste und Hannover), mir persönlich aus der Zeit der Implementierung von EMDR an der Klinik Hohe Mark 1994 und vom ersten EMDR-Training in Kassel 1995 mit ihren heiteren Schilderungen einen atmosphärischen Eindruck vermittelt zu haben – das alles floss ins Kapitel 6 mit ein.
PP Dr. Frank Wagner, niedergelassen in Bensheim, war so freundlich, mir Material zukommen zu lassen wie z. B. seine Dissertation über EMDR, und ich danke ihm für sein eigenes inspirierendes Lebenswerk, denn seine Forschung ist eingeflossen in die bis jetzt einzige deutsche Metaanalyse über EMDR sowie in den erfolgreichen Antrag auf Anerkennung von EMDR beim wissenschaftlichen Beirat des Bundesregierung Deutschlands, und als Chefredakteur der ersten deutschen Fachzeitschrift über Psychotraumatologie fördert er heute Publikationen anderer Autor/-innen zum Thema, weshalb er für mich eine großzügige unterstützende Quelle an Material war.
Auch Prof. Dr. Frank Jacobi von der Psychologischen Hochschule Berlin war so freundlich, mich mit aktuellem Material über Maßstäbe der Psychotherapieforschung zu versorgen, wofür ihm an dieser Stelle mein Dank gebührt.
Ich danke Herrn Dr. Bernd Frank (PP in Marburg) und Frau Dr. Jutta Margraf-Stiksrud (Philipps-Universität Marburg) dafür, dass sie meine diagnostischen Lehrer/-innen waren. Ich baue heute noch darauf, dass Herr Dr. Frank uns den Einsatz des DIPS-Interviews (Abschnitt 4.2.2) in der VT-Ausbildung gelehrt hat sowie die selbstverständliche Haltung, dies in der ambulanten und stationären Praxis einzusetzen. Die von Frau Dr. Margraf-Stiksrud vermittelte Freude, die Psychodiagnostik machen kann, würde ich gern in diesem Buch transportieren und an die Leser/-innen weitergeben.
Während ich aus Studien für dieses Buch die statistischen Kennwerte heraussuchte, hatte ich das österreichische Timbre meiner Statistikprofessorin Prof. Dr. Ingeborg Stelzl (Philipps-Universität Marburg, mittlerweile im Ruhestand) im Ohr. Meine interne Repräsentation von Frau Stelzl samt ihrem feinen Humor amüsierte mich des Nachts, wenn ich über p-, t- und F-Werten brütete, zumal meine Erinnerungsnetzwerke diverse lustige Gespräche mit ihr kommemorierten (z. B. beim Sommerfest des Fachbereichs Psychologie, etwa 1998, in denen ich ihr sagte, dass es Spaß gemacht habe, ihr Werk »Fehler und Fallen der Statistik« zu lesen, und sie berichtete, es habe auch Spaß gemacht, es zu schreiben). Jedenfalls war es aktuell amüsant, sich bei den Analysen der EMDR-Studien für Kapitel 6 durch eine Art Retard-Kapsel der Methodenlehre an unsere diversen Schlagabtausche zu erinnern (Frau Stelzl hat immer gewonnen) – danke dafür. In diesem Zusammenhang auch vielen Dank an Maximilian Stefani M. Sc. vom Institut für Psychologie an der Universität der Bundeswehr in München, mit dem ich die Einschätzung der ein oder anderen hier berichteten Studie diskutierten konnte.
Ich danke der Anthropologin Frau Anja Rost M. A., Heilpraktikerin für Psychotherapie in Burgwald, sehr dafür, dass ich ihre Zeichnung eines Feuertigers verwenden durfte.
Ich danke Herrn PP Prof. Dr. Christoph Kröger von der Stiftung Universität Hildesheim für seine Anregungen und sein Interesse für EMDR. Frau Eva Swobodzinski von der Bibliothek der Stiftung Universität Hildesheim war eine sehr hilfreiche Unterstützung beim Finden von weiteren Artikeln – auch falsch buchstabierte Quellen hielten sie nicht davon ab, fündig zu werden. Außerdem erhielt ich von Dr. Barbara Hensley, EMDR-Supervisorin an der Francine Shapiro Library in Austin, Texas/USA, stets schnell und freundlich benötigte Publikationen. Kurz vor Fertigstellung des Buches erreichten mich zudem weitere Informationen über randomisierte kontrollierte Studien zum Thema, die mir Dr. Dawid Pieper MPHMSc (Epi), Abteilungsleiter Evidenzbasierte Versorgungsforschung vom IFOM Institut für Forschung in der Operativen Medizin an der Fakultät für Gesundheit, Department für Humanmedizin der Universität Witten/Herdecke, übermittelte und die in Kapitel 6 eingeflossen sind – meinen herzlichen Dank für diesen Kontakt und den Austausch von Studien, die wir gegenseitig ergänzen konnten.
EMDR-Supervisorin Michaela Huber (PP in Göttingen) danke ich sehr für ihre gute Erklärung anlässlich eines Gruppensupervisionstages zwei Wochen vor Fertigstellung des Buches, bei dem sie als Spezialistin für Dissoziationen Depersonalisationsprozesse als Spaltungsprozesse sehr gut erklärte. Hier wurde mir nochmal umso mehr deutlich, dass das, was ich in Kapitel 3 über die Störung beschreibe und was Forscher/-innen vor mir, Seidler, Clark und Wells, Hackmann, Clark und MacManus beschrieben haben, Folgen eingefrorener Depersonalisierung sind.
Dieses Buch ist die Folge von Aufenthalten zunächst im SS 2016 an der Justus-Liebig-Universität Gießen zum Thema Forschungsmethoden, dann als Promotionsstudentin an der Stiftung Universität Hildesheim vom WS 2017/2018 bis SS 2018, die dort nicht mit einer Promotion abschlossen, aber durch Einladung und Unterstützung von Prof. Seidler (ehemals Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) mit dem Verfassen eines Original-Artikels in einem Peer-Reviewed Journal, mit dem Schreiben dieses Buches und der fortgeschrittenen Planung weiterer Original-Artikel und verschiedener Forschungsprojekte zum Thema. Am Schreibtisch im Studentenwohnheim in Hildesheim-Moritzberg hatte ich stets den Schreibtisch meines Lieblingsschriftstellers John Irving in Vermont vor meinem geistigen Auge sowie dessen Hinweise, wie Schreiben funktioniert: »Schreiben ist wie Ringen. Man braucht Disziplin und Technik. Man muss auf eine Geschichte zugehen wie auf einen Gegner.«4 So habe ich es gemacht, und ich danke ihm dafür, dass er das Geheimnis seines Erfolges zugänglich gemacht hat.
Das Schreiben des Buches brachte mich der Isolation von sozial ängstlichen Patient/-innen sehr nah: Absurderweise war mein Aufenthalt in Hildesheim begleitet von mehrfachen General-Abmahnungen des Betreibers des Studentenwohnheims (meines Zweitwohnsitzes, der Schreibklause) an alle Bewohner/‑innen wegen maßlosen Feierns und Beschwerden der Anwohner/-innen – absurd deshalb, weil die Abmahnungen kontrastierten mit meinem quasi völligen Verzicht auf Freizeit in der Zeit des Verfassens dieses Buches (offenbar im Auge des Party-Hurrikans), sowohl in Hildesheim als auch am Ort meiner Niederlassung, in Marburg. Mein soziales Netz akzeptierte klaglos, dass ich während der Entstehung dieses Buches keinen Einladungen folgte und nicht für Freizeitaktivitäten zur Verfügung stand (tut mir leid, PP Dr. Romina und Sven Montini aus Landau, meinen Glückwunsch zur Hochzeit). Ich danke folgenden befreundeten Kolleg/‑innen für ihre Ermutigung meiner Arbeit zu dem Thema (auch aus der Ferne durch Anrufe und Videofonie), durch offene Ohren, hilfreiche Rückmeldungen, guten Zuspruch und geduldig-liebevollen Verzicht auf mich in der Zeit der Schreibens:
EMDR-Trainer Dr. André Maurício Monteiro (Brasília) danke ich für seine Bereitschaft, dem Buch ein Vorwort beizusteuern, was bedeutete, vorher das ganze Manuskript zu lesen und mein EMDR-Arbeitsblatt für Soziale Angststörung aus Sicht eines EMDR-Institute-Trainers und Trainer’s Trainer zu prüfen (und dabei deutsche Gründlichkeit zu attestieren), mit mir die Klinik Hohe Mark zu besuchen und auf diese Weise die Historie von EMDR in Deutschland interessiert nachzuvollziehen und mit unvergleichlicher südamerikanischer Herzlichkeit die Bindung nach der Rückkehr nach Brasilien aus der Ferne weiter zu pflegen (z. B. durch das Übersenden humorvoller Cartoons). Weiterhin danke ich PP Dipl.-Psych. Thomas Wäschenbach (Wiesbaden), einem stets interessierten Probehörer meiner Präsentationen zum Thema mit der besten Rückmeldung, die ich mir vorstellen kann (»Jetzt ist EMDR ja direkt wieder interessant! Du musst mir trotzdem versprechen, irgendwann Hypnotherapie zu lernen«), der zuverlässig auf mich wartete, die Abgabe des Manuskripts gebührend zu feiern. Außerdem danke ich EMDR-Therapeutin PP Dipl.-Psych. Bettina Freitag (Offenburg) für viel Ermutigung, ebenso EMDR-Trainerin Dr. Penny Papanikolopoulos (Athen), EMDR-Supervisorin Valerie Grattage-Rushton M. A. (Leighton, Cheshire/UK), Denise Grahame, M. Sc. B. Sc. (Hons) Psych P/G Dip CBT (Belfast), EMDR-Supervisorin und EMDR-Facilitator Dr. Gyða Eyjólfsdóttir (Reykjavík), EMDR-Therapeutin PP Dipl.-Psych. Catherine Kemeny und Dipl.-Psych. Thomas Ploch (beide Marburg) für ermutigende Kommentare und interessierte Nachfragen zum Thema. Valerie und Denise gilt mein besonderer Dank dafür, dass sie für die englische Version des Arbeitsblattes die Cutoffs der englischen Testversionen herausgesucht haben. Ich danke meiner früheren Kommilitonin und heutigen Kollegin PP Dipl.-Psych. Claudia Neumann (Marburg) dafür, dass wir in der Schreibphase dieses Buches über Kurznachrichten Kontakt hielten und dass sie mich sofort nach Beendigung des Schreibens wieder dem Leben zu- und mich ins Theater entführte. So erschloss sich mir die merkwürdige Parallelität, wie es den betroffenen Patient/‑innen gehen muss, wenn sie nicht am Leben teilnehmen, und welch eine Erleichterung es darstellen muss, sich (wieder) aufs gesellschaftliche Parkett zu begeben.
Mein Dank gilt auch der konstanten Ermutigung meiner langjährigen EMDR-Supervisorin Tessa-Ava Prattos-Spongalides M. A. MAAT (Athen), die meine englische Übersetzung des EMDR-Arbeitsblattes für SAS korrekturgelesen hat, sowie der Unterstützung durch meine Mitarbeiterin Franziska Beham B. Sc.