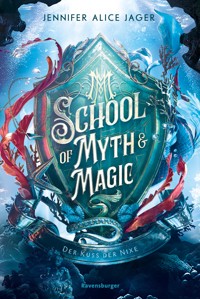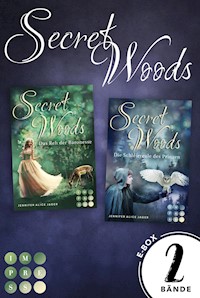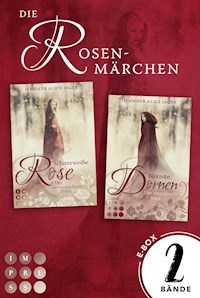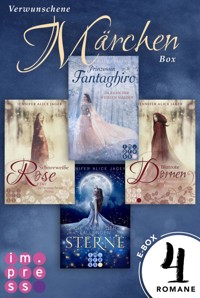Emily Seymour, Band 1: Totenbeschwörung für Anfänger (Bezaubernde Romantasy voller Spannung und Humor) E-Book
Jennifer Alice Jager
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Emily Seymour
- Sprache: Deutsch
Tote Jungs küsst man nicht. Es gibt keinen schlechteren Start in eine Beziehung, als den süßen Typen, in den man sich Hals über Kopf verliebt hat, aus Versehen umzubringen. Genau das passiert der untalentierten Totenbeschwörerin Emily Seymour – und nun muss sie einen Weg finden, Ashton wiederzubeleben. Doch es steckt mehr hinter seinem Ableben, als Emily ahnt. Schon bald muss sie mit einem schlecht gelaunten Untoten an ihrer Seite die größte Verschwörung aufdecken, die die magische Welt je gesehen hat. Band 1 der magischen Romantic-Fantasy-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2022
Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2022 Ravensburger Verlag
Originalausgabe
Copyright © 2022 by Jennifer Alice Jager
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Diese Veröffentlichung wurde gefördert durch:
Lektorat: Franziska Jaekel
Vorsatzkarten und Illustration: JenniferAlice Jager
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Hamburg
Unter Verwendung des folgenden Bildmaterials von Shutterstock: © Serg Zastavkin, © debra hughes, © PayPau, und © paranormal
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-51138-9
ravensburger.com
Todfeinde zu haben ist so was von überholt
Es war viel zu früh am Morgen, als mich der Sturz aus meinem Bett unsanft weckte. Ich landete auf dem Rücken zwischen meiner Dreckwäsche, schlug mir den Ellbogen auf und blinzelte verschlafen.
»Autsch«, sagte ich, verzögert zu dem bereits abklingenden Schmerz.
Meine Zimmertür schwang knarzend auf, ich legte den Kopf in den Nacken und sah meine Cousine Mandy im Eingang stehen.
»Wie zur Hölle schaffst du es, jeden Morgen aus deinem eigenen Bett zu fallen?«, fragte sie.
Mandy war aufgestylt, als würden ein roter Teppich und jede Menge Paparazzi auf sie warten. Sie hatte sich Wellen in ihre blonde Mähne geföhnt, trug ein paillettenbesetztes Oberteil, viel zu viel Make-up und Fingernägel, mit denen sie Steaks hätte schneiden können. Sie sah also aus wie immer. Allerdings war die Perspektive, aus der ich sie vom Boden aus betrachtete, nicht gerade vorteilhaft.
»Mir fällt jetzt erst auf, dass du ein Doppelkinn hast«, stellte ich fest. »Eigentlich sogar zwei.«
»Tss«, zischte sie empört, warf sich das Haar schwungvoll über die Schulter und stolzierte davon.
Ich mühte mich aus meiner Bettdecke, die meine Beine wie eine Würgeschlange fest im Griff hielt, und stand auf. Wie es mir gelang, mich nachts so darin einzuwickeln, dass ich jedes Mal auf dem Fußboden landete, wusste ich wirklich nicht. Es gehörte wohl zu meinen geheimen Superkräften. Neben dem Stolpern über die eigenen Füße im Stehen und dem Verfehlen eines Stuhls beim Hinsetzen.
»Emily, kommst du zum Essen?« Mom streckte ihren Kopf ins Zimmer und schaute sich erschrocken um. »Oder du räumst erst mal auf. Wurdest du heute Nacht von einer Horde Vampire angegriffen oder wieso sieht es hier aus wie nach einem Kampf?«
»Klopfen ist in diesem Haus ein Fremdwort, oder?«, murrte ich.
Mom hob eine Braue. »Deine Tür stand offen. Räum auf und dann komm runter. Es gibt Neuigkeiten.«
Ich schaute zum Fenster. Die Sonne war gerade erst aufgegangen, was bedeutete, dass ich noch mindestens eine halbe Stunde hätte dösen können, bevor ich zur Schule musste. Neuigkeiten beim Frühstück mit der ganzen Familie? Das klang in meinen Ohren nicht sehr verlockend.
»Fangt doch einfach ohne mich an«, schlug ich vor.
»Das war keine Bitte«, betonte Mom.
Ich seufzte. In solchen Fällen ließ sie nicht locker. Wenn es um die Familie ging, musste jeder jederzeit parat stehen.
»Von mir aus … bin gleich da«, gab ich widerwillig nach und feuerte meine Decke aufs Bett. Um diese Uhrzeit hatte ich wirklich keine Lust, mich auf unnötige Diskussionen einzulassen.
In Moms Rücken tauchte Cedric auf. Mein älterer Bruder, der mir alles andere als ähnlich sah. Er hätte Mandys Zwillingsbruder sein können, denn auch sein Haar war – genau wie Moms – von einem kräftigen Blond und nicht kürbisrot wie meines. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass er jeden Morgen mindestens eine Stunde investierte, um seine perfekt sitzende Gelfrisur hinzubekommen. Er trug einen seiner maßgeschneiderten Anzüge, der ihn wie einen edlen Lord aus dem 18. Jahrhundert aussehen ließ, den Wappenring unserer Familie und polierte Lederslipper. Auf dem roten Teppich wäre er neben Mandy gut weggekommen.
»Na, da lebt aber jemand seinen Hang zum Chaos in vollen Zügen aus«, sagte er und schaute sich um.
»Hat man hier nicht mal ein paar Minuten Ruhe?!« Ich stapfte auf ihn zu, drängte ihn aus dem Zimmer und schloss die Tür. Von innen lehnte ich mich dagegen und atmete tief durch. Wahrscheinlich versuchte ich meiner Familie im Schlaf zu entkommen. Das wäre jedenfalls eine logische Erklärung für meine unruhigen Nächte.
»Zehn Minuten!«, hörte ich Mom rufen.
Ich verdrehte die Augen, stieß mich ab und schnappte mir aus dem Durcheinander auf meinem Fußboden einen knallroten Hoodie und eine Jeans. Bei der Gelegenheit warf ich alles, was muffig roch, auf einen mannshohen Wäschehaufen neben dem Kleiderschrank.
Das war in meinen Augen erst einmal genug aufgeräumt. Es ging auch niemanden etwas an, wie es in meinem Zimmer aussah. Das war mein Reich. Meine eigenen vier Wände. Alles andere in diesem Haus musste ich mir mit Mandy, ihren und meinen Eltern, Cedric und meiner Granny teilen. Unsere abrissreife Villa, so riesig sie auch war, hatte einfach nicht genug Platz. Zumindest sah ich das so, denn ich sehnte mich danach, auch mal meine Ruhe zu haben, einfach ein paar Stunden für mich zu sein und dabei ein gutes Buch zu lesen – was jedoch unmöglich war, wenn ständig gestritten wurde, Hektik ausbrach, irgendetwas explodierte oder Untote durch den Garten wanderten. Für fast jeden, den ich außerhalb meiner Familie kannte, hätte sich das total irre angehört, für mich war es Alltag. Untote und solche Sachen.
So war das nun mal, wenn man in eine Nekromantenfamilie geboren wurde, bei der es auf der Tagesordnung stand, mit Geistern in Kontakt zu treten, die Seelen Verstorbener herbeizurufen oder Zombies zu beschwören. Denn Nekromantie war nichts anderes als die Gabe der Totenbeschwörung, die man vererbt bekam, was bei mir nicht der Fall war. Ich kam in dieser Hinsicht nach meinem Vater, war also eine Normalsterbliche, ganz ohne magische Fähigkeiten und das Können, Armeen von Untoten auf die Welt loszulassen, sollte mir der Sinn danach stehen.
Trotzdem konnte ich die Berufung meiner Familie nicht einfach ignorieren. Wenn jede helfende Hand benötigt wurde, musste auch ich mit anpacken. Häufiger als es für die gesunde Entwicklung einer Sechzehnjährigen gut sein konnte, war ich gezwungen, meine Nächte auf Friedhöfen zu verbringen, mich mit Geistern herumzuschlagen und Särge auszubuddeln.
Mein einziger Hoffnungsschimmer, dem zu entkommen, war ein guter Highschoolabschluss, um danach auf eine weit entfernte Uni zu gehen. Bevorzugt am anderen Ende der Welt, wo ich mit dem ganzen Theater nichts mehr zu tun haben musste und niemand auch nur ahnte, dass Nekromanten, Hexen, Vampire und Geister wirklich existierten.
Nachdem ich in die Klamotten geschlüpft war, gönnte ich mir ein paar Minuten Zeit im Badezimmer, wusch mich, putzte mir die Zähne und knotete mein wirres Haar zu einem lockeren Zopf zusammen. Von unten drang bereits das Geräusch von klirrendem Geschirr und Besteck zu mir herauf. Mit Sicherheit wäre ich mal wieder die Letzte am Tisch und würde böse Blicke ernten. Aber wenigstens musste ich mir das Waschbecken mit niemandem teilen.
Mit meiner Schultasche über der Schulter eilte ich die geschwungene Treppe hinunter. Das alte, abgenutzte Holz knarzte unter meinen Füßen, und kurz bevor ich die imposante Eingangshalle erreicht hatte, rutschte ich ab. Mit den Armen rudernd fing ich mich am Geländer ab, knallte mit dem Hintern auf die unterste Stufe und sah dabei zu, wie meine Tasche quer über das polierte Parkett bis zur Eingangstür schlitterte.
»Autsch«, stieß ich nun schon zum zweiten Mal an diesem bescheidenen Morgen aus. Wenn man bedachte, dass ich ungefähr so geschickt war wie ein betrunkener Esel beim Inlineskaten, war es vielleicht ganz gut, dass mir die Befähigung fehlte, über Leben und Tod zu bestimmen. Ich würde von mir jedenfalls nicht wiederbelebt werden wollen.
Wie gerufen, tauchte Mandy vor mir auf und stemmte die Fäuste in die Seiten. »Du liebst es, am Boden zu lümmeln, was?«
Ich zog mich hoch und rieb mir das Steißbein. »Weißt du, Mandy, in so ziemlich jedem trashigen Horrorstreifen gibt es ein altes, gruseliges Geisterhaus. Eben noch scheint die Sonne, die Vögel zwitschern, alle sind glücklich und lecken Vanilleeis. Dann zieht plötzlich Nebel auf, Wolken verdüstern den Himmel, ein Hund bellt in der Ferne und eine kleine Gruppe total verblödeter Teenies schmiedet den Plan, die Nacht in ebendiesem Geisterhaus zu verbringen. Der perfekte Ort, um sich einer Mutprobe zu stellen und binnen neunzig Minuten Filmmaterial eine bescheuerte Entscheidung nach der anderen zu treffen, bis am Ende alle tot sind.«
»Und was willst du damit sagen? Dass wir in so einem Geisterhaus leben? So schrecklich kannst du unser Familienanwesen doch nicht finden.«
»Nein, ich will damit sagen, dass du perfekt zu diesen hirnamputierten Teenies passt. Und wahrscheinlich würdest du als Erste draufgehen.«
Mandy lachte und warf dabei den Kopf zurück. »Ich nehme das als Kompliment. Ich wäre eine überragende Schauspielerin. Außerdem habe ich keine Angst vor Geistern. Eher haben die Angst vor mir.«
»Wer nicht«, murmelte ich.
»Wie bitte?«
Ich winkte ab und durchquerte die getäfelte Eingangshalle. »Nichts, ich habe mich nur gewundert, warum noch kein Filmproduzent angefragt hat, ob wir unsere abgehalfterte Villa für die Neuverfilmung der Addams Family zur Verfügung stellen würden.«
Das Setting wäre tatsächlich perfekt. Das Anwesen war riesig, steinalt, es gab Räume, die einer Todesfalle glichen, und geheime Gänge, die selbst ich noch nicht erkundet hatte. Geister gab es gratis dazu. Uns fehlte eigentlich nur noch das eiskalte Händchen.
»Du bist verrückt Emily, weißt du das?«, rief Mandy und folgte mir.
Wie ich es vermutet hatte, saßen an der langen Tafel im Esszimmer bereits Granny, Mom, Dad, mein Bruder Cedric und auf der gegenüberliegenden Seite Tante Sophia mit Onkel Joseph. Zu ihnen gesellte sich Mandy.
Granny hockte wie immer tief versunken in ihrem Ohrensessel am Kopfende des Tisches, um ihren Hals trug sie eine abgenutzte Fuchsfellboa über einer unbezahlbar teuren Perlenkette. Sie klammerte sich an den goldbeschlagenen Gehstock, der in den letzten Jahren zu ihrem treuesten Weggefährten geworden war, und murmelte etwas vor sich hin.
Von links goss Tante Sophia ihr Tee ein. Genauso aufgetakelt wie ihre Tochter Mandy war die Familienähnlichkeit kaum abzustreiten. Warum sie Granny ständig umsorgte, nur um sich bei ihr einzuschmeicheln, würde ich wohl nie verstehen. Hinter ihrem Rücken nannte Sophia sie eine alte Schabracke und schielte schon auf ihr großes Schlafzimmer. Ich bezweifelte allerdings, dass Granny sie in ihrem Testament besonders bedachte. Dazu konnte sie ihre Schwiegertochter viel zu wenig ausstehen. Wahrscheinlich, weil Onkel Joseph durch diese Ehe eine Hexe ins Haus geholt hatte. Granny traute Hexen nicht über den Weg.
»Das reicht!« Granny wedelte energisch mit der Hand. »Willst du mich in dem Tee ersaufen oder warum füllst du die Tasse bis zum Rand?«
»Sie hat es nur gut gemeint«, versicherte Mom versöhnlich. Sie saß rechts von Granny, gleich neben meinem Dad, der dabei war, auf seinem Teller einen Berg Rührei unter Speckstreifen zu begraben.
»Halt dich zurück, Veland«, ermahnte ihn Mom. »Denk an dein Herz.«
»Glaub mir Odila, ich denke an mein Herz und was mein Herz will, ist knuspriger Speck bis zum Abwinken.«
Mom seufzte. »Das bringt dich noch mal ins Grab und ich hole dich dort nicht wieder raus. Nur dass du es weißt.«
»Das will ich dir auch geraten haben«, sagte Dad.
Ich nahm zwischen ihm und Cedric Platz.
Dad raufte mir durch die Haare. »Na schau mal einer an, wer sich zu uns gesellt.«
»Lass das«, murrte ich und strich meine abstehenden Strähnen glatt. Als ich sechs oder sieben Jahre alt gewesen war, fand ich es noch ganz süß, wenn Dad mein Haar verwuschelte. Mittlerweile war es nur ein Zeichen dafür, dass er mich noch immer für ein Kind hielt.
»Das kannst du gleich aufgeben«, sagte Mandy schnippisch und setzte sich an die andere Tischseite. »Bei der Frisur ist nichts mehr zu retten.«
»Haha«, höhnte ich trocken.
»Zeigt am Tisch etwas mehr Benehmen«, ermahnte uns Tante Sophia, ohne aufzuschauen. Sie zerteilte gerade ein Vollkorntoast mit Messer und Gabel. Neben ihr starrte Onkel Joseph schweigend auf seinen leeren Teller. Manchmal fragte ich mich, ob er überhaupt noch am Leben war. Er sah aus und benahm sich, als hätte ihm Sophia längst das letzte Fünkchen Lebenskraft ausgesaugt.
»Genau, benimm dich«, pflichtete Cedric unserer Tante bei und beugte sich breit grinsend zu mir vor. »Obwohl sie ja recht hat.«
»Idiot«, zischte ich und rammte ihm meinen Ellbogen in die Rippen.
Er lachte. »War doch nur Spaß!«
Ich verdrehte die Augen, klatsche mir eine Scheibe Brot auf den Teller, malträtierte sie mit Butter und streute Kakao darüber.
»Du weißt schon, dass wir auch Nugatcreme haben?«, fragte Mandy rechthaberisch.
Ich hatte mir das Brot bereits in den Mund geschoben, schnaufte als Reaktion auf ihre Bemerkung und pustete dabei versehentlich Kakaopulver quer über den Tisch – direkt in Onkel Josephs Gesicht. Er sah aus, als hätte er sich eine Gesichtsmaske aus Blumenerde gegönnt, und ich musste die Luft anhalten, um bei dem Anblick nicht vor Lachen loszuprusten.
»Pass doch auf!«, fluchte Tante Sophia, sprang auf und tupfte die Wange ihres Mannes mit einer Serviette ab. »Du bist so ungeschickt!«
Mandy und Cedric lachten herzhaft, während Onkel Joseph keine Miene verzog. »Es geht schon«, murmelte er und nahm Sophia die Serviette aus der Hand.
»Emily?«, sagte Mom in scharfem Ton.
»Es war ja wohl Mandy, die …«, begann ich, brach aber ab und seufzte resigniert. Ich musste mir unbedingt abgewöhnen, Diskussionen mit Mom loszutreten. Erfolgversprechender wäre es gewesen, Tomaten in der Wüste anzupflanzen oder Hunde mit Katzen zu kreuzen. »Kein Kakaobrot mehr beim Frühstück. Versprochen.«
»Ich will auch so ein Brot«, sagte Granny und schaute sich um. »Sophia, kümmere dich darum.«
»Ähm …«, stammelte sie. »Aber sicher. Emily, reich mir bitte den Kakao. Ohne ihn über dem Tisch zu verteilen, wenn möglich.«
Ich schaute verwundert zu Granny und sie zwinkerte mir zu. »Hopp, hopp«, drängte sie. »Ich werde auch nicht jünger.«
»Wenn wir dann alle unsere Kakaobrote haben, lasst uns besprechen, weshalb wir zusammengekommen sind«, verkündete Mom ungeduldig.
Ich ahnte bereits, dass es etwas mit Nekromantie zu tun hatte, und war froh, als mich die Türglocke erlöste, bevor Mom richtig loslegen konnte.
Ich sprang auf. »Das wird Santana sein«, sagte ich. »Sie holt mich zur Schule ab. Ihr könnt das gern auch ohne mich besprechen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, verließ ich das Esszimmer. Santana war meine beste Freundin und obendrein eine Hexe. Mit ihr konnte ich offen darüber reden, was mir an der Nekromantie und meiner Familie auf den Senkel ging, ohne befürchten zu müssen, für verrückt erklärt zu werden. Denn das würde unter Garantie passieren, wenn meine übrigen Mitschüler etwas von meinem Doppelleben mitbekämen. Nur Santana wusste als eingefleischte Hexe über alles Bescheid.
»Emily, wir sind noch beim Essen!«, rief Mom.
»Ich kann Santana aber schlecht draußen stehen lassen!«, gab ich zurück, durchquerte die Eingangshalle und riss die Tür auf.
Entgegen meiner Erwartung war es nicht Santanas Gesicht, in das ich blickte. Vor mir stand ein Fremder. Ein junger Mann, etwas größer als ich, mit schmalen moosgrünen Augen, pechschwarzem Haar, das ihm in Strähnen im Gesicht hing, und breiten Lippen. Ein undurchsichtiges Lächeln hing ihm in den gekräuselten Mundwinkeln, wodurch er einschüchternd selbstbewusst wirkte.
Der Postbote war er sicher nicht. Zwar hatte er eine Schultertasche bei sich, trug aber keine Uniform, sondern ein schwarzes, eng anliegendes Hemd zu einer lockeren Jeans. Und darin sah er verdammt gut aus. Ich überlegte, meiner Familie die Frage zuzuwerfen, ob jemand ein männliches Supermodell per Onlineversand bestellt hatte. Natürlich hätte ich das nur machen können, wenn es mir gelungen wäre, etwas anderes zu tun, als diesen überirdisch heißen Kerl debil anzuglotzen.
Ich konnte weder Schmuck mit magischen Symbolen entdecken, noch hatte er spitze Ohren oder Flügel auf dem Rücken. Er war lediglich etwas blass um die Nase, aber ihm fehlte der typische grausilbrige Teint eines Vampirs. Wie es schien, war er ein normaler Mensch – wenn man so gutes Aussehen noch als normal bezeichnen konnte.
»Du hast Schokolade im Gesicht«, sagte er.
Augenblicklich schoss mir die Hitze in die Wangen und ich fuhr mir mit beiden Händen über den Mund.
Er schmunzelte. »Gutes Frühstück gehabt?«
»Ja … ich … wer?«
»Ashton Goodwin«, stellte er sich vor und streckte mir die Hand entgegen.
Ich stand total neben mir und hätte beinahe zugegriffen, bevor mir einfiel, dass ich den Kakao jetzt an den Händen hatte. Eilig wischte ich sie an meiner Hose ab. »Sorry.«
»Schon gut.« Er trat an mir vorbei in die Eingangshalle und schaute sich interessiert um. »Sehr … imposant.«
»Ähm, warte mal! Hast du Goodwin gesagt?« Ich hielt mich zwar lieber aus den magischen Angelegenheiten meiner Familie heraus, aber der Name sagte selbst mir etwas. Die Goodwins waren Nekromanten, genau wie meine Familie. Und sie galten als unsere Todfeinde. Auch wenn ich es schon immer lächerlich fand, dass es so etwas im wahren Leben geben sollte.
Ashton wandte sich mir zu. »Und du bist Mandy Seymour?«
»Emily«, erwiderte ich.
Er verengte den Blick. »Ich bin positiv überrascht.«
»W-Was?«, stotterte ich. »Woher …?«
In dem Moment kam Mom herbeigeeilt und schob sich zwischen uns. »Mr Goodwin, Sie sind früh dran! Wir haben Sie erst in einer Stunde erwartet.«
»Ashton reicht völlig«, versicherte er.
»Ashton, sehr gern. Die holprige Begrüßung meiner Tochter tut mir leid. Emily, musst du nicht zur Schule?«
Ich schaute zur offenen Tür und wollte gerade sagen, dass Santana noch nicht da war, als mich Mom auch schon nach draußen schob. Nur mit Mühe schaffte ich es, mir noch meine Schultasche zu schnappen.
»Hab einen schönen Tag!«, wünschte sie mir und schlug mir die Tür vor der Nase zu.
»Aber …«, murmelte ich noch.
Ashton Goodwin … Wenn mir klar gewesen wäre, dass die Goodwins einen so gut aussehenden Sohn hatten, hätte ich längst dafür plädiert, mit ihnen Frieden zu schließen.
Ich torkelte beinahe von der Terrasse. Eigentlich war es ganz gut, dass die Begegnung zwischen ihm und mir so peinlich verlaufen war, denn andernfalls hätte ich mir nur Hoffnungen gemacht. Ashton spielte definitiv nicht in meiner Liga. Mal ganz abgesehen davon, dass so ziemlich jeder in meiner Familie lieber unsere Villa bis auf die Grundmauern niedergebrannt hätte, als eine Verbindung der Seymours mit den Goodwins zu dulden. Aber der Gedanke, zwischen uns könnte es funken, ließ mein Herz flattern. Ein breites Grinsen legte sich auf meine Lippen und ich machte mich auf den Weg.
Wer hätte gedacht,dass man mich mit einer Banane verführen kann?
Um Santana auf dem Weg zur Schule abzupassen, musste ich einen Tannenwald durchqueren, von dem behauptet wurde, er wäre verflucht. Das hing unter anderem mit den alten, borkigen Bäumen zusammen, deren Schatten an gruselige Hexen erinnerten. Sie wuchsen so dicht, dass kaum Licht auf den Trampelpfad fiel, der sich holprig wie ein ausgetrocknetes Flussbett durch ihre Reihen schlängelte. Nachts war es hier besonders unheimlich, und wenn man dann auch noch die falsche Abzweigung nahm, landete man auf dem alten Friedhof von Springdale.
Der hauptsächliche Grund, aus dem sich die Bewohner meiner Heimatstadt an diesem Ort gruselten, hing allerdings mit der Raumfalte zusammen, die sich quer durch den Wald zog.
Mein Bruder Cedric hätte bestimmt mit einer wirren Mischung aus Magie und Physik erklären können, was genau es mit einer Raumfalte auf sich hatte. Ich blickte nur weit genug durch, um zu verstehen, dass es im Grunde genau das war, wonach es klang: Das Raum-Zeit-Gefüge war auf magische Weise zusammengefaltet. So wie man Falten in einen Rock bügelte, bloß dass es sich eben nicht um einen Rock, sondern um die Welt handelte, die – unsichtbar für die Augen Unwissender – in Falten lag.
Im Inneren dieser Falten verbargen sich ganze Landstriche. Normalsterbliche hatten also keine Ahnung, dass sich überall auf der Welt direkt vor ihrer Nase Zugänge zu einem Ort befanden, an dem Hexen, Vampire und Geister zur Normalität gehörten. Ein Ort, der von jenen, die ihn kannten, Zwischenwelt genannt wurde.
Und durch ebendiese Zugänge – oder Raumfalten – schwappten gern mal irgendwelche Absonderlichkeiten in die Außenwelt. Wenn also irgendwo an einem klaren Sonnentag plötzlich Nebel aufzog oder man einen Wolf heulen hörte, obwohl es in der Gegend gar keine Wölfe gab, konnte man davon ausgehen, dass eine Raumfalte in der Nähe war. Und genau solche unerklärlichen Dinge sorgten für den Gruselfaktor, der ein unschuldiges Wäldchen, wie das nahe meiner Heimatstadt, so unheimlich machte.
Gedankenversunken folgte ich dem Pfad durch die knorpeligen Bäume und hatte schon fast vergessen, dass ich auf dem Weg zu Santana war. Ashton ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Zweifelsohne wussten die Goodwins einiges über unsere Familie, genau wie umgekehrt. Mom hatte ihn offenbar erwartet und ich hätte darauf wetten können, dass er der Anlass für unser gemeinsames Frühstück gewesen war.
Vor mir tauchte eine Hand auf, schnipste und riss mich damit zurück in die Wirklichkeit.
»Erde an Emily«, flötete Santana.
Ich war zu versunken gewesen, um mitzubekommen, wie sie durch die Raumfalte getreten war. Dass sie das tagtäglich machte, als wäre nichts dabei, erstaunte mich immer wieder. Mir wurde jedes Mal speiübel, wenn ich auch nur daran dachte, die Zwischenwelt zu betreten. Santana hatte allerdings keine andere Wahl. Im Gegensatz zur Villa der Seymours lag das Haus, in dem sie mit ihrer Mom wohnte, im Inneren einer Raumfalte. Der Besuch von Mitschülern war also tabu.
Santana grinste breit, lief neben mir her und beugte sich dabei zu mir vor, sodass ihre dunkelbraunen Zöpfe in der Luft baumelten. »Schläfst du noch?«, fragte sie.
Ich seufzte ausgiebig. »Santana, mir ist eben der heißeste Typ begegnet, den die Welt je gesehen hat! Also … beide Welten.«
»Und der besteht aus Schokolade?«, fragte sie.
»Was?«
»Dein Mundwinkel.« Sie deutete auf mein Gesicht.
»O Mist, verdammter!« Ich fuhr mir mit den Fingern über die Lippen. »Weg?«
»Ja. Und jetzt erzähl!«
Ich holte tief Luft für einen langen Redeschwall. »Er heißt Ashton Goodwin, stand heute Morgen vor unserer Tür und –«
»Goodwin?«, fiel sie mir ins Wort. »Du meinst doch nicht etwa die Goodwins?!«
»O doch, genau die.«
Santana riss die Augen auf. »Nicht dein Ernst? Hat deine Familie ihn sofort zum Teufel gejagt?«
»Ganz im Gegenteil! Mom hat ihn mit offenen Armen empfangen. Wirklich verstehen kann ich das auch nicht. Der Streit zwischen unseren Familien herrscht schon seit Generationen. So was legt man nicht mal eben über Nacht ab.«
»Versteh ich nicht«, sagte Santana.
»Mom wollte beim Frühstück eine Neuigkeit verkünden, als Ashton plötzlich aufgetaucht ist. Daraufhin hat sie mich regelrecht aus dem Haus gejagt«, erklärte ich. »Und wenn ich Pech habe, ist er verschwunden, bevor ich wieder zurück bin.«
Wir hatten den Wald mittlerweile verlassen und folgten einer leeren Straße, vorbei an grasenden Kühen. Vor uns tauchten bereits die ersten Gebäude auf. Kleine, beschauliche Häuschen, mit gepflegten Vorgärten und weißen Lattenzäunen. Springdale war ein richtiges Vorzeigestädtchen. Ganz im Gegenteil zu unserer gruftigen Villa.
In der Ferne sah ich andere Schüler auf dem Weg zum Unterricht. Sie fuhren in Grüppchen auf Fahrrädern oder waren zu Fuß unterwegs und begrüßten sich winkend, als wären sie Statisten in einem Werbevideo für das friedvolle Landleben.
»Dann geh doch einfach jetzt zurück«, riet mir Santana. »Sag, dir ist schlecht oder so. Ich kann dir Bauchschmerzen anhexen, wenn du willst.« Sie schnipste mit den Fingern und eine grünlich flackernde Lichtkugel erschien, die sie auf ihrer Handinnenfläche balancierte.
»Hey, ihr beiden!«, rief jemand in unserem Rücken.
Ich reagierte blitzschnell, packte Santanas Hand und drückte sie nach unten. In dem Moment sauste auch schon David Adler auf seinem neuen Mountainbike an uns vorbei.
»Hey, Dave!«, erwiderte ich seine Begrüßung und schirmte den Zauber in Santanas Hand vor seinen Blicken ab.
Zum Glück schenkte uns David kaum Aufmerksamkeit. Er radelte weiter, ohne sein Tempo zu verlangsamen, und war schon bald außer Hörweite.
Ich atmete erleichtert auf. »Puh, das war knapp.«
Santana schaute David noch einen Moment lang nach, dann hob sie die Hand. »Contare«, flüsterte sie und die Lichtkugel verschwand. »So knapp nun auch wieder nicht«, behauptete sie.
Wer Magie beherrschte, musste viele Regeln beachten. Die Wichtigste davon war, magische Fähigkeiten niemals vor den Augen Unwissender einzusetzen. Mom drohte immer, dass mich das Tribunal der Zwischenwelt für den Rest meines Lebens in ein dunkles Loch werfen würde, wenn ich so unvorsichtig war, Normalsterblichen etwas über Magie oder die Zwischenwelt zu offenbaren. Mit den Wächtern, die im Auftrag des Tribunals für die Einhaltung der Gesetze der Zwischenwelt sorgten, würde sich niemand freiwillig anlegen. Da ich allerdings nicht einfach so mit den Fingern schnipsen konnte, um Magie zu wirken, drohte mir keine ernsthafte Gefahr.
»Dass mit der Übelkeit ist übrigens eine super Idee«, sagte ich in ironischem Ton. »Dann werde ich den Tag in meinem Zimmer verbringen und kriege genauso wenig mit. Außerdem darfst du keine Krankheiten anhexen.«
Santana winkte ab. »Das gilt nur für Normalsterbliche.«
»Jaaa?« Ich deutete auf mich. »Und was bin ich?«
»Alles, aber ganz bestimmt nicht normal.« Sie verpasste mir neckend einen Stoß.
»Oh, danke«, höhnte ich.
»Nein, im Ernst, du tust immer so, als hättest du mit dem Erbe deiner Familie nichts zu tun, aber du bist und bleibst die Tochter einer Nekromantin, das kannst du nicht abstreiten. Und Nekromantie ist eine wunderbare Gabe! Ich wünschte, ich könnte das. Deine Leute erschaffen ja nicht ständig nur irgendwelche Zombies. Sie können mit den Seelen Verstorbener in Kontakt treten, ihnen sogar ein paar letzte Tage gönnen, damit sie ihre Angelegenheiten klären. Sie können Leben schenken! Das beherrscht sonst niemand aus der Zwischenwelt. Jeder dort beneidet die Nekromanten.«
»Und du kannst ödes Käsebrot in Schokoladenkuchen verwandeln. Das Talent hätte ich gern!«
Wobei ich nicht wirklich scharf darauf war, mit Santana zu tauschen. Um sich eine echte Hexe nennen zu dürfen, musste man einem Zirkel angehören und dort wurden nur unverheiratete Frauen aufgenommen – nicht, dass ich vorgehabt hätte, in nächster Zeit zu heiraten.
Santana lachte. »Okay, ich gebe zu, das ist schon ziemlich genial. Aber ich musste dafür auch lange üben. Ich studiere fast jeden Tag die Zaubersprüche aus dem Grimoire meines Hexenzirkels und Mom bringt mir alles bei, was ich über die Zubereitung von Tränken wissen muss.«
»Ich habe früher auch viel geübt«, sagte ich. »Es hat nur nichts gebracht. Ich bin und bleibe normalsterblich, genau wie mein Vater.«
»Wenn du in Bio besser aufgepasst hättest, wüsstest du, dass das faktisch gar nicht möglich ist. Die Hälfte deines Erbguts kommt nun mal von deiner Mom, die Nekromantengene stecken also in dir.« «Wenn das so ist, bin ich wohl die miserabelste Totenbeschwörerin der Welt.« »Wer weiß, vielleicht ist dieser Ashton gekommen, um dir Nachhilfe zu geben, damit du deine verborgenen Kräfte doch noch entdeckst! Ihr verbringt die nächsten Wochen jeden Nachmittag zusammen, kommt euch näher und dann Bähm!«
»Bähm, was?«
»Bähm, verliebt! Was dachtest du denn?« Sie grinste breit.
Ich zuckte mit den Schultern. »Bähm, Haus in die Luft gesprengt?« Das traute ich mir bei meinem Geschick eher zu.
Santana verdrehte die Augen.
»Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ein Goodwin bei uns sucht, bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Eltern mich lieber von einem Goldfisch unterrichten lassen würden als von jemandem aus seiner Familie.«
Santana zwinkerte mir unschuldig zu. »Wieso eigentlich nicht? Wenn der Goldfisch weiß, was er tut.«
»Haha.«
»Und jetzt erzähl, wie sieht er aus? Lass bloß kein Detail weg!«
Nachdem sich der Unterricht an diesem Tag wie Kaugummi gezogen hatte, war ich froh, als wir uns nachmittags wieder auf den Heimweg machen konnten. Am Wäldchen verabschiedete ich mich von Santana und sie verschwand zwischen den Bäumen. Diesmal sah ich die Raumfalte aufflackern, durch die sie in die Zwischenwelt trat. Es war bloß ein kurzer Lichtblitz, wie ein Riss, der wieder verschwunden war, bevor man ihn richtig wahrgenommen hatte. Ziemlich unspektakulär, wenn man nicht selbst in die Falte gezogen wurde. Wer keine Ahnung hatte, was dort gerade geschehen war, hätte es wohl damit abgetan, kurz von der Sonne geblendet worden zu sein.
Auf dem Weg nach Hause wurde ich immer nervöser. Ich wusste, dass das lächerlich war – Ashton war bestimmt schon weg –, aber ich konnte das Gefühl einfach nicht abschalten. Ich war mir sicher, dass ich unsere erste peinliche Begegnung toppen würde, sollte ich ihn doch noch antreffen. Vor der Eingangstür atmete ich erst einmal tief durch und nahm mir vor, cool zu bleiben und so zu tun, als würde mich Ashton kein bisschen interessieren.
»Hallo?«, rief ich, nachdem ich eingetreten war. Meine Stimme hallte von den getäfelten Wänden wider. Niemand reagierte, also nahm ich die Treppe nach oben. Entweder ignorierten sie mich, was häufig vorkam, oder sie konnten mich dort, wo sie waren, nicht hören.
Ich suchte die üblichen Plätze ab, warf einen flüchtigen Blick in die riesige Familienbibliothek, die der Bodleian Library in Oxford Konkurrenz machen könnte, schaute im alten Arbeitszimmer von Urgroßvater mit dem monströsen gusseisernen Kamin nach und ging schließlich im zweiten Stock durch den langen Korridor. Er endete an einer unscheinbaren Tür, die zum Ritualzimmer im Ostturm hinaufführte. Ich wusste, dass insbesondere Cedric dort viel Zeit verbrachte, und wollte nach der Türklinke greifen, doch meine Finger stießen gegen einen Widerstand. Ein Siegelzauber flammte auf und verpasste mir einen leichten Schlag.
»Verdammter …«, stieß ich aus und streckte meine kribbelnden Finger.
Das Symbol aus alten Runen leuchtete noch einen Moment lang, als hätte jemand die Tür mit fluoreszierender Farbe bepinselt, dann erlosch es wieder. Es handelte sich quasi um das Betreten-verboten-Schild unter Magiebegabten, und da der Zauber von außen gewirkt werden musste, war wohl niemand hier.
Ich gab schließlich auf und verzog mich in mein Zimmer. Etwas verärgert war ich schon. Einmal in meinem Leben wollte ich wissen, was alle trieben, und genau dann war niemand aufzufinden. Dabei hatte man in diesem Haus normalerweise selten seine Ruhe.
Ich mühte mich eine Weile mit Mathe ab, bis sich mein Magen meldete. Das Mittagessen in der Schule war sehr mager ausgefallen und das Kakaobrot heute Morgen hatte ich kaum angerührt. Entsprechend wuchs mein Heißhunger darauf schnell an.
Ich ließ die Hausaufgaben unfertig zurück und machte mich auf den Weg in die Küche – den einzigen Raum des Hauses, der nicht aussah, als wäre die Zeit vor gut dreihundert Jahren stehen geblieben. Tante Sophia hatte hartnäckig darauf bestanden, zumindest in der Küche ein wenig Moderne einziehen zu lassen. Nach ihren Wünschen – und trotz Grannys Protesten – war vor ein paar Jahren eine Kochinsel mit Induktionsfeld, ein Einbaubackofen mit unzähligen Funktionen und eine Spülmaschine installiert worden. So konnte uns niemand nachsagen, wir wären nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Nur die getrockneten, teils giftigen Kräuter, die von der Decke hingen, ließen darauf schließen, dass an diesem Ort nicht bloß leckere Speisen zubereitet wurden, sondern auch Zaubertränke für diverse Rituale und Beschwörungen. Spätestens ein Blick in die Speisekammer hätte diesen Verdacht dann bestätigt. Dort lagerten nämlich die seltsamsten Zutaten und Utensilien. Hühnerfüße und Schlangenhaut gehörten dabei noch zu den harmloseren Dingen.
Als ich die Küche betrat, war gerade niemand damit beschäftigt, unseren Vorrat an magischen Elixieren aufzustocken, Eidechseninnereien einzukochen oder Rattenschwänze zu hacken. Erst jetzt kam mir in den Sinn, dass die anderen vielleicht gar nicht zu Hause waren, sondern mit irgendeinem superwichtigen Ritual beschäftigt, mit dessen Hilfe sie die Welt vor dem drohenden Untergang bewahrten. Und ich würde wieder mal erst davon erfahren, wenn im örtlichen Tagesblatt etwas von seltsamen Wetterphänomenen zu lesen war.
Ich legte die letzte Scheibe Brot auf einen Teller und stellte ihn zusammen mit Butter und Kakao auf die Küchentheke. Als ich gerade in der Besteckschublade nach einem Messer fischte, berührte mich etwas an der Schulter. Mein Unterbewusstsein hatte sofort eine fette Spinne parat, ich schrie vor Schreck auf und wirbelte herum.
Ashton wich vor mir zurück und hob verteidigend die Hände. »Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken.«
»H-hast du auch nicht«, stolperte es aus mir heraus. Dass ich kurzatmig war und mir eine Hand auf die Brust drückte, in der mein Herz hektisch pochte, bewies allerdings das Gegenteil.
»Nimmst du das dann runter?«, fragte er. »Oder muss ich um mein Leben fürchten?«
Verwundert legte ich die Stirn in Falten.
Ashton deutete mit dem Zeigefinger nach unten, ohne dabei die Hände zu senken. Ich folgte seiner Geste und bemerkte, dass ich das Buttermesser auf ihn gerichtet hielt. Eilig drehte ich die Klinge von ihm weg.
»Wenn du dich noch mal so anschleichst, kann ich für nichts garantieren«, sagte ich.
»Das werde ich mir merken«, versprach er und schaute über meine Schulter. »Schmierst du mir auch ein Brot?«
»Ähm …« Ich wandte mich wieder dem Teller zu. Nach dem kurzen Schreck kehrte meine Nervosität zurück und ich suchte nach Worten. »Ich … weiß nicht«, stammelte ich. »Wir haben kein Brot mehr und … Wie lange wirst du denn bleiben?«
»Vielleicht ein oder zwei Tage«, sagte er und lehnte sich an die Theke.
Ich musste mich zusammenreißen, um ihn nicht dümmlich anzuglotzen. Menschen wie ihn dürfte es im wahren Leben gar nicht geben. Diese hohen Wangenknochen, die perfekt geschwungenen Lippen, die dunklen Augen, umrahmt von dichten Wimpern – viel zu langen Wimpern. Wie konnte er derart lange Wimpern haben? Jemand wie er gehörte in Filme oder Serien, wo man ihn aus der Ferne bewundern konnte – und nicht befürchten musste, neben ihm zusammenzuschrumpfen wie ein Speckstreifen in der Pfanne. Insbesondere dann, wenn er verstohlen lächelte, was er gerade tat. Und dabei beugte er sich auch noch zu mir vor. Unwillkürlich lehnte ich mich zurück, um den Abstand zwischen uns zu wahren.
»Wenn ich gewusst hätte, dass die Seymours ihr Essen mit Waffengewalt verteidigen, hätte ich mir etwas mitgebracht«, raunte er.
»Ich habe nicht gesagt, dass …«, begann ich, brach aber ab, als sich sein Gesichtsausdruck veränderte.
Er grinste schief und schaute erneut zu meiner Hand. Ich folgte seinem Blick. Beim Gestikulieren hatte ich das Buttermesser geschwungen und dadurch nun schon zum zweiten Mal auf ihn gerichtet.
Offenbar amüsierte ihn das.
»Du machst dich über mich lustig, oder?«, fragte ich argwöhnisch.
»Ein bisschen vielleicht.« Er hob vielsagend die Brauen.
Ich konnte es überhaupt nicht ausstehen, wenn jemand Scherze auf meine Kosten machte. Ruckartig wandte ich mich wieder dem Teller zu. »Bitte, dann teilen wir uns eben die letzte Scheibe«, entschied ich und strich Butter auf das Brot. »Wenn der Herr sonst vom Fleisch fällt«, schob ich ungewollt schnippisch nach und bereute es sofort.
»Schon gut«, räumte er ein. »Ich kann mir auch etwas anderes holen.«
»Nein, nein, kein Problem!«, versicherte ich ihm. »Ich wollte nur … das war ein Scherz. Wir teilen, okay?«
»Wie du magst«, sagte er.
Sein Blick war fest auf mich gerichtet, als hätte ihn irgendetwas an mir oder dem, was ich gesagt hatte, neugierig gemacht. Vielleicht lag es auch nur daran, dass sich unsere Familien schon lange aus dem Weg gingen und ich nicht dem Bild entsprach, das er sich von uns gemacht hatte. Vielleicht hatte ich aber auch noch Schokoflecke im Gesicht.
Ich wandte mich eilig von ihm ab, griff nach der Kakaodose, warf sie dabei fast um, und bestreute schließlich großzügig das Butterbrot. Dann fiel mir ein, dass ich Ashton gar nicht gefragt hatte, was er auf seinem Brot haben wollte.
»Tut mir leid, hättest du lieber Käse gewollt oder so?«
»Ich nehme, was du nimmst«, sagte er.
»Gut, dann …« Ich wagte es nicht, ihn noch einmal anzusehen. Zu sehr befürchtete ich, von seinem Anblick gefesselt zu werden und dabei rot anzulaufen wie ein blinkendes Warnlämpchen. Ich teilte das Brot in zwei Hälften und schob ihm den Teller hin.
»Magst du Bananen?«, fragte er aus heiterem Himmel. Das Brot schaute er nicht einmal an.
»Was?«
»Diese gelben, gebogenen Dinger.« Er deutete auf die Obstschale, die Tante Sophia dekorativ auf der Kochinsel platziert hatte. Sie war mit Birnen, schrumpeligen Äpfeln und überreifen Bananen gefüllt – ein deutliches Zeichen dafür, dass wir Seymours zu selten Obst aßen.
»Ich weiß, was Bananen sind«, grummelte ich.
Ashton stieß sich von der Theke ab und brach eine der Bananen ab. In seiner Hand begannen die braunen und schwarzen Flecken zu verblassen. Sie wichen einem kräftigen Gelbton und kurz darauf war die Banane um mehrere Tage verjüngt.
Ungläubig starrte ich sie an. »Wie hast du das angestellt?«
»Machst du dich jetzt über mich lustig?«, fragte er. »Du tust gerade so, als wärst du noch nie einem Nekromanten begegnet.«
»Aber das … von uns kann niemand …« Ich deutete von ihm auf die Banane und wieder zurück, und noch während ich das tat, kam Ashton einschüchternd nah auf mich zu. So nah, dass ich seinem Blick nicht mehr ausweichen konnte. Ich versank in seinen moosgrünen Augen und bemerkte erst, dass er nach dem Buttermesser in meiner Hand griff, als sich unsere Finger berührten. Mir fuhr ein Kribbeln durch den ganzen Körper.
»Ich bin mir sicher, dass ihr das auch könnt«, sagte er. »Ihr nutzt eure Fähigkeiten nur seltener für die kleinen Dinge. Die Seymours bevorzugen aufwendige Rituale.«
»Kann sein«, murmelte ich und schluckte schwer. Er war mir jetzt so nah, dass ich nicht umhinkam, seinen unheimlich guten Geruch wahrzunehmen. Ich war schon kurz davor, die Augen zu schließen und tief einzuatmen, konnte mich aber gerade noch zusammenreißen.
Es gelang mir, seinem Blick standzuhalten, bis er sich abwandte, um die Banane zu schälen. Erleichtert stieß ich die Luft aus. Es wäre wohl nicht so gut, wenn ich die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen würde, aber genau der Drang wuchs gerade in mir. Mit diesem superheißen Typen allein zu sein, machte mich zu einem unsicheren, eingeschüchterten Nervenbündel. Und normalweise war ich weder unsicher noch schüchtern!
Ashton schnitt die Banane in dünne Scheiben und belegte das Brot damit. »Du gehst auf eine Schule hier in der Außenwelt, nicht wahr?«, fragte er.
»Du etwa nicht?« Meine Stimme klang ungewohnt piepsig. Ich räusperte mich, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen.
Ashton ignorierte meine Gegenfrage. Sein Blick hing an den Bananenscheiben und er wirkte mit einem Mal abwesend. Als wäre er mit seinen Gedanken nicht mehr hier in der Küche, sondern an einem ganz anderen Ort – irgendwo weit entfernt, wo es ihm ganz und gar nicht gefiel. »Dein Bruder Cedric, hat er auch die örtliche Schule besucht?«
Er wandte sich mir zu, versteckte– was auch immer ihn tatsächlich beschäftigte – hinter einem gezwungenen Lächeln und hielt mir den Teller hin.
Zögernd nahm ich mir eine Hälfte des Brotes. Ich wusste nicht, was es mit seiner Frage über meinen Bruder auf sich hatte, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es sich um mehr als nur harmlosen Small Talk handeln musste.
»Ja, hat er«, antwortete ich, denn es war kein wohlgehütetes Familiengeheimnis, das ich ihm damit offenbarte. Ich biss in das Brot und riss die Augen auf. »O mein Gott!«, nuschelte ich mit vollem Mund. »Das ist verdammt noch mal das Leckerste, was ich je gegessen habe!«
Ashton schmunzelte und stellte den Teller wieder ab. »Freut mich, dass es dir schmeckt. Meine Mom hat mir früher immer Kakao-Bananen-Brote gemacht. Das weckt Erinnerungen.«
»Früher?«, fragte ich schockiert. Meine Stimme klang dabei um einiges höher als gewöhnlich. »Habt ihr keinen Kakao, wo du herkommst, oder wieso isst du etwas so Leckeres nicht täglich?« Ich schob mir noch einen großen Bissen in den Mund und kaute genüsslich.
»Vielleicht hielt mich Mom irgendwann für zu alt«, meinte er.
»Zu alt?« Ich musste lachen. »Wie alt bist du? Fünfzig?«
Ashton antwortete nicht. Sein Blick ruhte unergründlich auf mir, ich starrte ihn an und wartete darauf, dass er mir widersprach, aber das tat er nicht.
Die Stille zwischen uns dehnte sich, während das Fragezeichen in meinem Kopf wuchs. »Du …?«, stammelte ich. Er war doch nicht etwa wirklich steinalt? Nachdem, was er mit der Banane angestellt hatte, kannte er vielleicht einen Trick, um ewig jung zu bleiben.
Der Gedanke, ich könnte in einen alten Knacker verschossen sein, sorgte dafür, dass mir heiß und kalt zugleich wurde. Als ich mich gerade an den Gedanken gewöhnen wollte, es mit einem Opi zu tun zu haben, kehrte das Schmunzeln auf Ashtons Lippen zurück – nur hatte es diesmal etwas Schelmisches an sich.
»Achtzehn«, sagte er.
Mir fiel eine Lastwagenladung Steine vom Herzen. Er war bloß zwei Jahre älter als ich.
»Mit achtzehn ist man also zu alt für Kakao-Bananen-Brot?«, höhnte ich. »Dann muss ich mich ja ranhalten!« Ich biss noch einmal ab, seufzte genießerisch beim Kauen und wischte mir mit dem Daumen über die Mundwinkel.
Ashton beobachtete mich, als hätte er noch nie zuvor jemanden beim Essen gesehen. »Na ja, ein paar Jahre hast du noch Zeit, oder?«
Meine Augen weiteten sich. Für wie jung hielt er mich? »Ein paar …?«, begann ich und hielt mir die Hand vor den Mund, weil ich ihm beinahe Kakao-Bananenpampe aufs Hemd gespuckt hätte. Peinlicher konnte es nun wirklich nicht mehr werden! Ich schluckte erst einmal, bevor ich ein verlegendes »Sorry …« hervorbrachte. »Ich bin sechzehn.«
Ashton musterte mich ausgiebig. »Ach ja? Dann iss mal lieber auf, damit du noch ein bisschen wächst.«
Blinzelnd starrte ich ihn an. Die Hitze war mir ins Gesicht geschossen. Okay, ich war nicht riesig, aber auch kein Zwerg. Es war wohl eher mein Benehmen, das ihn vermuten ließ, ich sei jünger. Ich hatte schon häufiger zu hören bekommen, dass ich mich nicht unbedingt meinem Alter entsprechend benahm. Wobei das hauptsächlich von Mandy kam, die jede Gelegenheit nutzte, sich über mich lustig zu machen.
So oder so fühlte ich mich nun veranlasst, älter rüberzukommen. Ich strich mir das Haar hinter die Ohren, stellte mich aufrechter hin und wollte mich ganz lässig an die Küchentheke hinter mir lehnen – die allerdings etwas weiter von mir entfernt war, als ich vermutet hatte. Ich taumelte ins Leere, mir entfuhr ein kurzer Aufschrei und hätte mich Ashton nicht in einer blitzschnellen Bewegung am Ellbogen gepackt, wäre ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Hintern gelandet.
Verlegen schaute ich zu ihm auf. »Rutschig«, behauptete ich.
Er legte die Stirn in Falten und löste die Hand von meinem Arm. »Der Boden?«
Ich nickte bloß. Eben noch hatte ich geglaubt, dass es nicht peinlicher werden konnte. Offenbar hatte ich mein Talent darin, mich selbst in Verlegenheit zu bringen, unterschätzt.
»Wolltest du nicht aufessen?«, fragte er.
»Äh … ja …« Ich stopfte mir das letzte Stück Brot in den Mund und schluckte es in einem Stück hinunter, was ich augenblicklich bereute. Der Klumpen war viel zu groß und drückte in meiner Kehle. Ich drehte mich von Ashton weg, kämpfte gegen den Drang an, zu würgen und zu husten, räusperte mich und klopfte mir auf die Brust.
Dabei fiel mir auf, dass Ashton kein einziges Mal von seiner Brothälfte abgebissen hatte. Sie lag noch immer unangerührt auf dem Teller. Scheinbar war er zu sehr damit beschäftigt, mir beim Essen zuzuschauen. Ich bot ihm ja auch eine fesselnde Show.
»Du hast die Banane doch nicht vergiftet, oder?«, fragte ich im Scherz. Weil ich aber immer noch gegen den Knoten in meinem Hals kämpfen musste, klangen meine Worte gepresst und ungewollt ernst.
Ich sah zu Ashton, der ebenso ernst wirkte. Wieder waberte diese unergründliche Stille zwischen uns, er kam näher, durchbohrte mich regelrecht mit seinem Blick und ich vergaß zu atmen.
»Keine Sorge«, sagte er, seine Stimme zu einem bedrohlichen Raunen gesenkt.
Sorgen? Ich? Nur weil er mich anschaute, als würde er mich genauso verschlingen wollen wie ich zuvor mein Brot?
»Du kannst dir sicher sein, dass ich der Letzte bin, der den wackeligen Frieden zwischen unseren Familien aufs Spiel setzt.«
»Dann … ist ja gut«, stammelte ich.
Und um mir das zu sagen, musste er mir so nah kommen, dass ich seine Wimpern hätte zählen können? Ich wollte ihn schon höflich von mir schieben, als er an mir vorbei nach dem Teller griff und wieder auf gebührenden Abstand ging.
»Ah, hier bist du!« Mom war in die Küche getreten und lächelte Ashton übertrieben freundlich an. »Wir sind jetzt so weit. Wenn du mich also begleiten würdest?«
»Sicher«, sagte er und drückte mir den Teller in die Hand. »Du kannst meine Hälfte gern haben. So wie du geschlungen hast, musst du immer noch am Verhungern sein.«
Ich suchte eilig nach Worten, während er schon zu Mom ging.
Sie trat beiseite, um ihn aus der Küche zu lassen. »Emily, hast du nicht noch Hausaufgaben zu erledigen?«
»Die können warten«, meinte ich, stellte den Teller auf den Küchentresen und wandte mich wieder der Tür zu. »Ich würde lieber …«
Mom und Ashton waren bereits verschwunden.
»… mitkommen.«
Frustriert ließ ich mich gegen die Theke plumpsen. Diesmal traf ich sie sogar. Unsichtbar zu sein konnte ich wohl auch auf die Liste meiner Superkräfte setzen. Dabei war es eigentlich nichts Neues für mich, als Normalsterbliche aus den wirklichen wichtigen und vor allem gefährlichen Angelegenheiten herausgehalten zu werden. Neu war diesmal nur, dass es mich störte.
Es geht doch nichtsüber einen Familienausflug zum Friedhof
Ich saß an meinem Schreibtisch und starrte schon eine halbe Ewigkeit auf die ungelösten Matheaufgaben. Es gelang mir einfach nicht, mich darauf zu konzentrieren. Dabei nahm ich meine schulischen Leistungen normalerweise sehr ernst. Schließlich wollte ich nicht ewig in diesem Haus festsitzen. Solange mir aber Ashton im Kopf herumschwirrte, war dort kein Platz für andere Dinge.
Mein Blick wanderte zu seiner Kakao-Bananen-Brothälfte. Ich hatte den Teller mit auf mein Zimmer genommen, bisher jedoch nichts davon angerührt.
Ob es total irre wäre, Santana zu bitten, einen Konservierungszauber über das Brot zu legen? Dann könnte ich es in meiner Andenkenkiste unter dem Bett verstauen. Verdammt, und wie irre das wäre! Dass ich überhaupt auf solche Gedanken kam, war schon ein Zeichen dafür, dass mich Ashton verrückt machte.
Ich warf mich frustriert gegen die Rückenlehne meines Stuhls und schlug mir die Hände vors Gesicht. Wieso musste er auch so unglaublich heiß sein? Wieso war er hier aufgetaucht und hatte mit seinem Bananenzauber und diesem durchdringenden Blick meine ganze Welt auf den Kopf gestellt?
Ich lehnte mich noch weiter zurück, starrte an die Decke und fasste den Entschluss, meine Hausaufgaben zusammenzupacken und zu Santana zu gehen. Ich brauchte jemanden, mit dem ich Reden konnte, und das ging nur bei ihr. Smartphones waren in diesem Haus verpönt und das einzige Telefon der Seymours war eine Antiquität aus den Dreißigerjahren, die in der Eingangshalle hing. Das Teil funktionierte zwar, aber wer stand schon gern in einem Durchgangszimmer, um Privatgespräche zu führen?
Ich wollte mich wieder an die Tischkante ziehen, als es an der Tür klopfte. Vor Schreck verlor ich den Halt, wäre beinahe rücklings vom Stuhl gekippt, schaffte es aber mit Mühe, mich zu fangen.
Cedric betrat mein Zimmer und schaute sich äußerst skeptisch um. Er hatte sein Jackett abgelegt, das Hemd aufgeknöpft und die Ärmel hochgekrempelt. Ich schloss daraus, dass er einen sehr arbeitsreichen Tag hinter sich hatte, denn normalerweise achtete er darauf, immer wie frisch gestriegelt auszusehen.
»Das Chaos in diesem Zimmer lässt tief blicken, Schwesterherz.«
»Was suchst du hier?«, fragte ich.
»Wie ich gehört habe, bist du in der Küche mit unserem Gast zusammengetroffen?«
»Ja und?«
»Darf ich?« Er deutete auf mein Bett.
Ich machte eine ausholende Geste. »Fühl dich wie zu Hause.«
Mit federndem Gang durchquerte Cedric mein Zimmer. Ich wusste nicht, wie er das tat, aber in jedem Raum, den er betrat, schien sich ab dem Moment alles nur noch um ihn zu drehen. Selbst meine eigenen vier Wände kamen mir in seiner Gegenwart nicht mehr wie mein Zimmer vor, sondern bloß wie die Kulisse für das Schauspiel seines Lebens.
An meinem Bett angekommen, strich er das Laken glatt, sank auf die Matratze und stützte sich mit den Ellbogen auf den Knien ab. Eine Strähne löste sich aus seinem zurückgegelten Haar und fiel ihm ins Gesicht. Das ließ ihn sympathischer wirken und ich glaubte, erahnen zu können, warum fast alle Mädchen während seiner Schulzeit in ihn verschossen waren und alle Jungs so sein wollten wie er. Sein Abschluss lag schon ein paar Jahre zurück, sodass ich in der Highschool nicht in die Verlegenheit gekommen war, bloß eine Statistin im Leben meines Bruders zu spielen – nicht, dass ich ohne seine Anwesenheit je eine Hauptrolle in irgendetwas gespielt hätte. Ich war schon immer eher die Bühnenassistentin gewesen.
»Ich weiß, du hältst nicht viel von unserer Zunft«, begann er ohne Umschweife.
»Es ist nicht so, dass …«
»Nein, nein!«, unterbrach er mich. »Du musst dich nicht verteidigen. Dir geht die Nekromantie gegen den Strich und du lässt auch keine Gelegenheit aus, uns das spüren zu lassen. Insofern ist es ganz gut, dass du nach Vater kommst. So musst du dich wenigstens nicht selbst verleugnen.«
Ich hätte ihm gern erklärt, dass es anders war. Insbesondere, weil ich das Gefühl hatte, dass er unser geheimes Familientalent, in dem er so außergewöhnlich gut war, gern mit seiner kleinen Schwester geteilt hätte. Mir ging es nicht anders. Ich hatte schon immer zu ihm aufgesehen, ihn als kleines Kind über alle Maßen bewundert, geradezu angehimmelt, aber die Nekromantie stand zwischen uns und sorgte dafür, dass wir uns im Laufe der Jahre immer weiter voneinander entfernt hatten. Natürlich tat mir das leid. Cedric war mir sehr wichtig und ich hätte ihm gern viel nähergestanden.
Dass ich zur Enttäuschung aller im Höchstfall eine Glühbirne zum Leben erwecken konnte – und das auch nur, wenn ich dafür den Schalter an der Wand betätigte –, ließ sich aber nun mal nicht leugnen.
»Und weiter?« Ich verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ganz egal, wie du zur Nekromantie stehst, dir sollte die historische Bedeutung des Ereignisses bewusst sein, das gerade vonstattengeht.«
»Welches Ereignis denn?«, fragte ich.
»Die Seymours schließen Frieden mit den Goodwins«, erklärte er, als hätte mir das längst klar sein müssen. »Du weißt, was das heißt?«
Ich setzte eine nachdenkliche Miene auf und rieb mir mein Kinn. »Keine filmreifen Schlachten mehr zwischen untoten Armeen?«
»Das kam seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr vor«, belehrte er mich lächelnd. »Unsere Familien stehen seit Ewigkeiten in Konkurrenzkampf zueinander. Den zu beenden, wird vieles zum Positiven wenden. Es wird künftig keine Rangeleien um Zuständigkeiten mehr geben. Keine Anfeindungen mehr, keine Befürchtung, von einem Goodwin in einen Hinterhalt gelockt zu werden. Was in diesen Tagen geschieht, wird Einfluss auf alle Bewohner der Zwischenwelt haben. Auch für dich wird sich einiges ändern, Emily. Du könntest zum Beispiel problemlos an einer Uni an der Westküste studieren. Keiner von uns würde befürchten müssen, die Goodwins könnten es auf dich abgesehen haben, solltest du nicht länger unter unserem Schutz stehen.«
Mir war gar nicht klar gewesen, dass diese Gefahr bestanden hatte. Auch nicht, dass ich in irgendeiner Weise unter dem Schutz meiner Familie stand. Was hätten die Goodwins auch mit mir anfangen sollen? Doch je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich eine Schwachstelle für meine Familie war. Ich beherrschte keine Zauber, um mich zu verteidigen, wusste aber einiges über die Seymours. Zum Beispiel, wo wir unser Grimoire aufbewahrten und wie man die Schrift darin las. Ich kannte Rituale, die nur unserer Familie vorbehalten waren, und hatte schon als Kind Reime auswendig gelernt, die einem den Weg zu verborgenen Orten verrieten.
»Was erwartest du jetzt von mir?«, fragte ich.
»Wir haben den ganzen Tag verhandelt und eine gute Übereinkunft getroffen, was jedoch nicht einfach war. Wir dachten, dass wir mit dem jungen Goodwin leichtes Spiel hätten, aber er ist anders als die übrigen etwas schludrigen Mitglieder seiner Familie. Er hat Köpfchen und weiß sehr genau, worauf er achten muss. Das wird auch der Grund sein, warum sie ihn als Verhandlungspartner zu uns geschickt haben. Jedenfalls fehlen nur noch ein paar letzte Details, bevor wir die Siegel unserer Familien auf den Vertrag setzen. Bis es so weit ist, wird es deine Aufgabe sein, den jungen Goodwin zu beschäftigen. Er scheint Gefallen an dir gefunden zu haben. Wenn du ihn ablenkst, kann ich die letzten Einzelheiten zu unseren Gunsten ausformulieren.«
Ich war mir nicht sicher, ob ich Cedric richtig verstanden hatte. Ashton hatte Gefallen an mir gefunden? An mir? Wirklich glauben konnte ich das nicht. Immerhin hatte ich mich in seiner Gegenwart wie der letzte Trottel verhalten. Mal ganz abgesehen davon, dass er mich für viel jünger gehalten hatte. »Wie soll ich ihn denn ablenken?«
Cedric schaute an mir vorbei zu meinen Hausaufgaben. »Kommst du nicht voran? Normalerweise liegt dir Mathe doch.«
»Ich bin nur …«
»Unkonzentriert?« Er wackelte mit den Brauen und hob dabei die Mundwinkel zu einem hämischen Schmunzeln. »Ich weiß doch, wie das bei euch Teenies läuft. Durch die rosarote Brille sehen die Angebeteten übernatürlich gut aus, die Hormone spielen verrückt und es reicht ein Blick oder eine Berührung, damit ihr glaubt, die Liebe des Lebens gefunden zu haben. Keine Ahnung, ob Goodwin in dich verschossen ist, aber er ist höchstens ein oder zwei Jahre älter als du und er stellt Fragen über dich. Einen Versuch, ihn ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, ist es allemal wert. Was haben wir schon zu verlieren?«
Ich stellte mir gerade vor, wie Mom, Dad, Tante Sophia – einfach alle – zusammengesessen und darüber gesprochen hatten, mich mit Ashton zu verkuppeln. Ich fragte mich, ob sie Streichhölzer gezogen hatten, um auszuknobeln, wer mir diese Botschaft überbringen sollte.
»Das ist ein hinterhältiger Plan«, sagte ich geradeheraus. »Wie soll das mit dem Frieden zwischen unseren Familien funktionieren, wenn ihr schon betrügt, bevor dieser Vertrag unterschrieben ist?«
»Ach komm schon, es spricht wohl kaum etwas dagegen, wenn man sich ein paar Vorteile verschaffen will. Und von dir wird auch nicht mehr erwartet, als ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn du aber der Meinung bist, das sei zu viel verlangt, dann bitte«, er deutete auf die Tür, »geh zu ihm, erzähl ihm von unserem Gespräch und verbau dir deine Chance auf eine Zukunft außerhalb dieser vier Wände. Denn eines kannst du mir glauben: Wenn der Vertrag nicht zustande kommt, wirst du Springdale nie verlassen.«
»Das würdet ihr gar nicht verhindern können«, sagte ich.
»Wenn du …!« Mit erhobenem Zeigefinger brach er ab und atmete tief durch. Erst rieb er sich den Nasenrücken, dann kam er ganz versöhnlich auf mich zu und legte mir die Hände auf die Schultern. »Du hast recht. Wir Seymours sind gut darin, unsere Vorteile aus allem zu ziehen. Es ist die ewige Rivalität mit den Goodwins, die uns so hat werden lassen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dem ein Ende zu setzen. Das verstehst du doch, oder?«
»Ist ja schon gut.« Ich schüttelte seine Hände ab. »Wenn es unbedingt sein muss, mach ich es. Ich lenke ihn ab, aber mehr auch nicht, verstanden? Ihr haltet mich aus eurer Intrige heraus.«
»Steckt also doch eine Seymour in dir, Schwesterherz! Vielleicht keine Nekromantin, aber zumindest eine Seymour.« Er lief zur Tür und hielt dort noch einmal inne. »Hey, Emily …«
»Was denn jetzt noch?«, fuhr ich ihn an.
»Vielleicht leiht dir Mandy ein sexy Top.«
Ich hechtete zu meinem Bett, schnappte mir ein Kissen und warf es nach ihm. »Hau bloß ab!«, zischte ich.
Cedric wich geschickt aus. »Zu langsam, Schwesterherz.« Er öffnete die Tür und glitt in einer eleganten Bewegung auf den Flur hinaus. »In zehn Minuten unten in der Eingangshalle. Mit festem Schuhwerk. Wir haben noch einen Auftrag reinbekommen. Es geht auf den Friedhof, eine Leiche ausgraben. Und Goodwin wird uns begleiten.« Er zwinkerte mir zu und schloss die Tür, bevor ich ein weiteres Kissen nach ihm werfen konnte.
Zehn Minuten hatten ausgereicht, um jedes Kleidungsstück aus meinem Schrank zweimal in die Hand zu nehmen. Viele waren es ja nicht, denn die meisten lagen muffig und verdreckt auf dem wachsenden Wäschehaufen. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, Cedrics Rat zu befolgen und Mandy um Hilfe zu bitten. Den verwarf ich aber ganz schnell wieder. Schließlich wollte ich nicht aussehen wie eine Diskokugel. Außerdem war ich nicht die unscheinbare Hauptdarstellerin eines Teenie-Liebesfilms, die durch ein Umstyling vom grauen Mäuschen zum Supermodel mutierte und in einem eleganten Abendkleid die Treppe hinunterschwebte, wo ihr Abschlussballdate auf sie wartete. Lieber blieb ich bei meinem gewohnten Style – nämlich keinen zu haben. Dann fühlte ich mich wenigstens wie ich selbst.
Ich beließ es bei meinem roten Hoodie und nahm die Gummistiefel vom Schuhregal. Noch während ich aus der Tür stolperte, schlüpfte ich in die Stiefel hinein – und wäre beinahe gegen Tante Sophia geprallt. Passend zu ihrem Lidschatten trug sie ein bodenlanges Kleid in dunklem Lila und darüber einen Mantel, der erschreckende Ähnlichkeit mit den Vampirumhängen alter Schwarz-Weiß-Horrorstreifen hatte. Eigentlich fehlte nur noch der Besen, um ihr Halloween-Hexen-Outfit zu komplettieren.
Sie musterte mich von oben bis unten. »Dein Bruder hat mit dir geredet?«, fragte sie.
»Ja, hat er.«
»Und du willst wirklich so …?« Sie räusperte sich. »Nun ja, daran lässt sich jetzt auch nichts mehr ändern.« Mit einem unterkühlten Lächeln auf den Lippen griff sie nach meinem Arm und zog mich die Treppe nach unten.
Ich hätte gern behauptet, dass meine Tante der Paradiesvogel unter den Seymours war und alle anderen wussten, wie man sich im 21. Jahrhundert kleidete. Doch leider war dem nicht so.
In der Vorhalle warteten bereits Mom, Mandy und Cedric auf uns. Und auch sie sahen aus, als wären wir auf dem Weg zu einem historischen Kostümfest. Genau wie Tante Sophia war Mom in ein langes wallendes Kleid gehüllt. Wenigstens Mandy wirkte nicht wie aus dem vorigen Jahrhundert. Mit ihrem glitzernden Oberteil, dem Hüftgürtel, der Leggins und den hochhackigen Schuhen machte sie aber auch nicht gerade den Eindruck, als hätte sie vor, sich die Hände schmutzig zu machen. Cedric, der sein Jackett wieder angezogen und die Haare perfekt zurückgegelt hatte, zupfte am Einstecktuch in seiner Brusttasche und nickte mir verstohlen zu, als er mich sah.
»Ich habe das doch richtig verstanden, wir graben eine Leiche aus?«, fragte ich.
»Ganz so einfach wird es nicht werden, Schätzchen«, sagte Mom. Sie kam zu mir und fummelte an meinem Hoodie herum. »Hättest du nichts Schickeres gehabt? Was ist mit der blauen Bluse, die ich dir zu Weihnachten geschenkt habe?«
»Die Sache mit den Werwölfen, schon vergessen?« Das Teil bestand nur noch aus Löchern, nachdem sich meine Familie mit einem ganzen Rudel angelegt hatte und ich in diese Sache mit hineingezogen worden war. Der damalige Abend gehörte nicht gerade zu meinen Glanzmomenten, aber Mom neigte dazu, solche Dinge schnell zu verdrängen.
»Ach ja«, sagte sie nachdenklich.
In dem Moment betrat Dad die Eingangshalle. Er war schwer beladen mit drei Schaufeln und einem Zehn-Kilo-Sack Salz. Ashton folgte kurz darauf, unsere Blicke trafen sich und ich wandte mich eilig von ihm ab. Mich hatte plötzlich das Gefühl beschlichen, er könnte den Plan meiner Familie von meiner Stirn ablesen, wenn ich ihn zu lange anschaute.
»Wenn Joseph das nächste Mal wartet, bis das Salz im Kofferraum liegt, bevor er den Wagen aus der Garage fährt, muss ich den Sack nicht quer durchs Haus schleppen«, ächzte Dad und stolperte beinahe über die Schaufeln, die ihm unter dem Armen wegrutschten.
»Lass mich …«, bot ich an – und stieß gegen Ashtons Hand, der zeitgleich nach derselben Schaufel griff. Erschrocken zuckte ich zurück. Mein Herz klopfte wie wild, während Ashton nur freundlich lächelte.
Er nahm Dad die Schaufeln ab und reichte eine davon an mich weiter. »Nimm die hier, ich trage die anderen.«
Ich erwiderte sein Lächeln verlegen und griff zögernd zu. Wieder trafen sich unsere Blicke und mein Herz machte einen Satz. Das hätte einer jener Momente werden können, in denen alles um mich herum verstummte und ich mich völlig in Ashtons moosgrünen Augen verlor. Allerdings entging mir Moms verstohlenes Schmunzeln nicht.
Ich riss Ashton die Schaufel regelrecht aus der Hand, wirbelte herum und stapfte auf die Tür zu. Peinlich war das. Einfach. Nur. Peinlich.
Cedric holte mich auf halbem Weg ein. »Etwas Mühe musst du dir schon geben«, flüsterte er mir zu.
»Zisch ab«, knurrte ich.
Das konnte unmöglich gut gehen. Es fiel mir auch so schon schwer, mit Ashton in einem Raum zu sein. Wie sollte ich es in seiner Gegenwart aushalten, wenn mir die ganze Zeit mein geheimer Auftrag im Kopf herumschwirrte? Ich lief schneller, um Cedric abzuhängen, und verließ das Haus.
Unsere Familienkutsche war ein alter Ford Lincoln. Eine Limousine aus den Achtzigern, in der wir alle Platz fanden. Onkel Joseph stand damit bereits in der Einfahrt. Ich verstaute die Schaufel im Kofferraum und verzog mich auf die Rückbank. Links von mir stieg Mandy ein. Sie schob mich unsanft in die Mitte und schloss die Tür. Rechts folgte Ashton und ich schrumpfte in mich zusammen.
»Einen schönen Wagen habt ihr«, meinte er.
»Ja«, erwiderte ich und hielt die Luft an. Er saß so nah neben mir, dass sich unsere Schulten berührten.
Uns gegenüber nahmen Mom, Tante Sophia und Cedric Platz. Onkel Joseph gab wie immer den Chauffeur und Dad verstaute das Salz im Kofferraum, bevor er sich mit einem kurzen Blick in den Innenraum verabschiedete. Er blieb meistens zu Hause, wenn die Familie einen Auftrag zu erledigen hatte. Er nutzte es gern aus, die Villa so gut wie allein für sich zu haben, um in Ruhe arbeiten zu können. Als freischaffender Restaurator bekam er regelmäßig alte Filme und Fotos zur Bearbeitung geschickt und bevorzugte es, nicht gestört zu werden, wenn er mit den empfindlichen Materialen und Chemikalien hantierte.