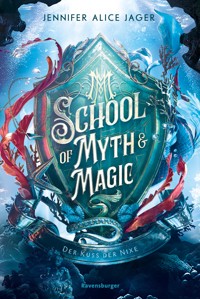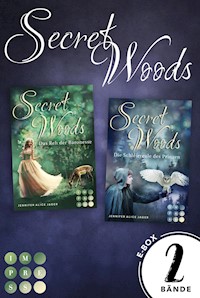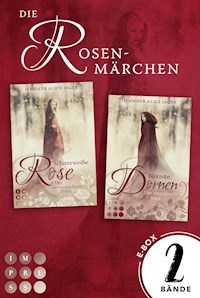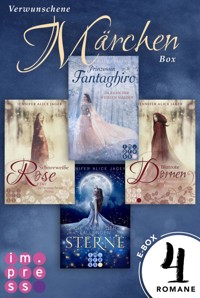Emily Seymour, Band 2: Zeitreisen für Fortgeschrittene (Bezaubernde Romantasy voller Spannung und Humor) E-Book
Jennifer Alice Jager
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Emily Seymour
- Sprache: Deutsch
Wenn dein Bruder entführt und gegen einen Doppelgänger ausgetauscht wird, du dem Tod nur knapp entgehst und dann auch noch jemand deine Erinnerungen löscht, tun sich Fragen auf – viele Fragen. Auf der Suche nach Antworten reisen Emily und Ashton einmal durch die magische Weltgeschichte. Zwischen mordlüsternen Vampiren und Drachen-Gestaltwandlern bleibt Emily kaum Zeit, das größte Rätsel von allen zu lösen: Ashton. Für Leser*innen ab 12 Jahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2023
Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
© 2023 Ravensburger Verlag
Originalausgabe
Copyright © 2023 by Jennifer Alice Jager
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Diese Veröffentlichung wurde gefördert durch:
Lektorat: Franziska Jaekel
Vorsatzkarten: Jennifer Alice Jager
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Hamburg
Unter Verwendung des folgenden Bildmaterials von Shutterstock: © Serg Zastavkin, © alaver, © Adam Vilimek und © debra hughes
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-51153-2
ravensburger.com
Gewidmet all den lustigen Sprüchen,die ungesagt geblieben sind, weil sich jemandnicht getraut hat, den Mund aufzumachen.Die Welt kann ein bisschen mehr Fröhlichkeitgebrauchen, also traut euch, seid witzig,bringt andere zum Lachen und lacht auch selbst.
Mister Sexy-007 unter Palmen
Das Meer, die Hitze, die Sonne und verdammt noch mal die Palmen! Die Palmen waren das Genialste an meiner neuen Heimat. Ich liebte Palmen. Ich liebte Palm Beach.
»Du bist echt kreidebleich«, stellte Rachel fest.
Wir saßen auf der halbhohen Mauer, die den Strand von der Promenade trennte, schleckten Vanilleeis und ließen unsere Beine baumeln. Ich hatte den Kopf in den Nacken gelegt, genoss den rötlichen Glanz der Sonne auf meinen geschlossenen Augenlidern und atmete die salzige Meeresluft ein. Das Eis lief mir über die Finger, also schlug ich die Augen wieder auf und leckte es mir von der Haut.
»Ich werd schon noch Farbe kriegen«, meinte ich mit dem Mund voll Vanilleeis.
»Wie lange lebst du jetzt schon hier? Zwei Monate?« Rachel begutachtete mich über den Rand ihrer superschicken Gucci-Sonnenbrille hinweg. Sie hatte sich die kreisrunden Gläser bis zur Nasenspitze heruntergeschoben und ihren Mund zu einer Schnute verzogen. »Du bist noch genauso bleich wie am Tag deiner Ankunft.«
Nachdenklich betrachtete ich unsere Beine – ihre fast schokobraun, meine weiß wie Puderzucker. Ich war nun mal ein hellhäutiger Typ, was man auch an meinen kürbisroten Haaren sah. Selbst nach zwei Monaten in Shorts, mit Flipflops und knappen Shirts sah ich aus wie ein Butterbrot. Wenigstens bekam ich nicht mehr so schnell Sonnenbrand. Allmählich gewöhnte sich meine Haut an das Summerfeeling, genauso wie sich mein Kopf darauf eingestellt hatte, dass Palm Beach meine neue Heimat war.
»Gib mir noch zwei Monate«, sagte ich.
Rachel lachte. »So krass blass wie du bist, braucht es zwei Jahre, bevor du nicht mehr wie eine Touristin aussiehst.«
»Es kommt nicht drauf an, wie man aussieht, sondern wie man sich fühlt.« Ich stand auf und balancierte mit ausgebreiteten Armen auf der Mauer entlang.
Auch wenn mein Äußeres noch nicht darauf schließen ließ, hatte ich mich sehr schnell an Florida gewöhnt. Wer würde sich auch nicht über ein Leben direkt am Strand freuen? Meine neue Heimat bot mir alles, was das Herz begehrte. Die Turners, bei denen ich lebte, waren ein freundliches Paar. Josh und Dorothy hatten immer ein offenes Ohr für mich. Rachel war eine tolle Freundin und auch die anderen in der Schule hatten kein Problem mit mir als der Neuen. Gut, der Start war etwas holprig gewesen, weil das Gerede über das Mädchen, dessen Eltern bei einem Autounfall gestorben waren und das sich an nichts mehr erinnern konnte, schnell die Runde gemacht hatte. Aber mittlerweile konnte ich mir gar kein anderes Leben mehr vorstellen.
»Hey, Mädels!«, rief uns jemand von der Promenade aus zu.
Rachel sprang sofort auf. »Holy Shit! Das ist Grayson Scott aus der Parallelklasse!«
Das musste sie mir nicht sagen. Jeder wusste, wer Grayson war – der heißeste Typ der Schule. Und gerade kam er auf seinem Bike auf uns zugefahren, seine besten Freunde Hudson und Robby im Schlepptau.
Was alle an ihm fanden, wusste ich nicht. Mit seinen Hawaiishirts, der Justin-Biber-Frisur, diesem Breitmaulfroschmund und der ständigen Angeberei vereinte er so ziemlich alles in sich, was ich an Jungs abschreckend fand. Rachel hingegen war ihm ganz und gar verfallen.
Unmittelbar vor der Mauer legte Grayson eine Vollbremsung hin, schlitterte mit dem Hinterrad in Seitenlage und fing sich gekonnt mit dem Fuß ab.
Rachel schielte über ihre Brille hinweg, tat desinteressiert und lehnte sich lässig gegen die Mauer. »Was geht?«, fragte sie wie beiläufig.
»Mia, nicht wahr?« Er nickte mir zu.
»Die bin ich«, bestätigte ich, auch wenn sich dieser Name seltsam falsch anfühlte. Ich konnte nur mutmaßen, dass ich in meinem alten Leben einen Spitznamen gehabt hatte und mir Mia deswegen so gar nicht vertraut vorkam.
»Wir wollen zu Benny’s. Habt ihr Bock?«
Eigentlich kamen wir gerade von dort, worauf das Vanilleeis in meiner Hand ein ziemlich guter Hinweis war. Offenbar hatte es Grayson nicht so mit logischen Rückschlüssen und Rachel war sowieso alles egal. Sie wäre auch seinem Vorschlag gefolgt, zum Fischmarkt zu gehen und sich nackt in toten Forellen zu wälzen.
»Klar!«, sagte sie, warf ihr Eis in den Mülleimer und schwang sich über die Mauer.
»Spring auf!«, forderte Grayson sie auf. Rachel stieg hinter ihm auf das Bike.
»Willst du bei mir mitfahren?«, fragte mich Robby.
Ich wollte ablehnen, aber Rachels Blick verriet mir, dass sie keine Widerworte meinerseits gebrauchen konnte. Gedanklich war sie wahrscheinlich schon bei der Familienplanung mit Grayson.
»Okay …«, stimmte ich zu und stieg auf Robbys Gepäckträger.
Die Jungs radelten los und ich merkte schnell, dass es gar nicht so leicht war, im Gleichgewicht zu bleiben, während ich mich mit einer Hand am Sitz festklammerte und in der anderen mein Eis hielt.
Da Grayson gar keinen Gepäckträger hatte, musste Rachel stehen – und das mit ihren Flipflops auf der Befestigung des Hinterrads. Ihr machte das aber nichts aus. Sie klammerte sich an Grayson und jubelte freudig, als wäre die kurze Tour zu Benny’s eine rasante Achterbahnfahrt.
Ich musste zugeben, dass mir der Ausflug ebenfalls Spaß machte. Der Wind wehte durch mein Haar, mein Herz vollzog bei jedem wilden Schlenker, den Robby fuhr, einen Salto, und Rachels Lachen war ansteckend.
Bei Benny’s angekommen, stiegen wir alle ab und die Jungs ließen ihre Bikes fallen. Robby spendierte mir eine Coke, die anderen bestellten sich Eis, wir lachten und scherzten miteinander und es fühlte sich an, als könnte jeder Tag so sein – so voller Sonnenschein und schöner Momente.
Nachdem die Jungs ihr Eis verputzt hatten, jagten wir uns gegenseitig über den Strand und wichen lachend den Wellen aus. Robby kitzelte mich, bis ich kaum noch Luft bekam, und Hudson nutzte die Gelegenheit, um mir meine Flipflops zu stibitzen.
»Na warte, den kriegen wir!«, verkündete Rachel selbstbewusst und wir rannten Hudson hinterher.
Nach einer fast schon epischen Sandschlacht waren wir völlig aus der Puste, hatten aber gewonnen. Triumphierend hob ich meine Flipflops in die Höhe und erntete Applaus von Grayson und Robby. Die beiden schlossen zu uns auf, während ich mich erst mal an die Strandmauer lehnen musste, um wieder zu Atem zu kommen. Rachel ließ sich neben mir an die Mauer plumpsen.
»Hast du den Typen dort bemerkt?«, fragte sie und schielte zu Benny’s und den anderen Strandbuden.
Ich drehte mich um.
»Nicht so auffällig!«, zischte sie.
»Wen meinst du?«
An den Tischen saßen einige Leute, die mir ganz normal vorkamen. Ein paar Touristen, einige Anwohner, nichts Ungewöhnliches.
»Da hinten, an der Ecke.«
Ich schaute noch einmal nach, diesmal unauffälliger, und wusste gleich, von wem sie sprach. An einer Hausecke lehnte ein Junge, den ich in der Schule noch nie gesehen hatte. Er musste ein Tourist sein, denn er war genauso blass wie ich. Eigentlich sogar noch blasser, was meines Erachtens kaum sein konnte, wenn man nicht gerade ein Geist war. Er hatte pechschwarzes Haar, trug ein ebenso schwarzes, langärmliges Hemd zu einer dunklen Jeans und verbarg seine Augen hinter einer schmalen Sonnenbrille.
»Der beobachtet dich schon die ganze Zeit«, meinte Rachel.
»Wer geht denn bitte in so einem Outfit zum Strand?«, fragte ich.
»Keine Ahnung, ein FBI-Agent?«
»Der ist ein bisschen zu jung fürs FBI, oder?«
Rachel riss die Augen auf. »Was, wenn du so etwas wie eine Mafia-Prinzessin bist?«
»Was?«
»Ja! Stell dir vor, du bist die Tochter eines gefährlichen Mafia-Bosses, deine Eltern kommen bei einem Mordanschlag ums Leben, doch du überlebst wie durch ein Wunder, hast aber dein Gedächtnis verloren. Sie stecken dich in ein Zeugenschutzprogramm, denn die Mörder deiner Eltern sind hinter dir her. Sie haben nur nicht mit dem jungen, attraktiven Superagent Mister Sexy-007 gerechnet, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, dich um jeden Preis zu beschützen. Aus dem Verborgenen beobachtet er dich und verliert dabei sein Herz.«
»Du solltest Bücher schreiben«, schlug ich vor.
Rachel überlegte. »Gar keine schlechte Idee.«
»Hey, worum geht’s?«, fragte Grayson.
»Um den Typen dort hinten«, meinte Rachel und nickte in die Richtung des fremden Jungen.
»Wer?«
Wir schauten uns nach ihm um, doch er war bereits verschwunden.
»Niemand«, sagte ich. »Bestimmt nur so ein Entführungsopfer.«
»Okay, und was soll das jetzt heißen?«, fragte Hudson.
»Du weißt schon, einer von den Teens, die gegen ihren Willen von ihren Eltern hierher in den Urlaub verschleppt werden«, erklärte ich. »Er sah jedenfalls nicht aus, als hätte er Spaß.«
Grayson hob die Schultern. »Wahrscheinlich, weil er nichts von der geilen Strandparty weiß, die heute Abend steigt. Seid ihr am Start?«
»Bei Partys immer!«, meinte Rachel und verpasste mir einen Stoß. »Nicht wahr?«
»Immer«, stimmte ich ihr zu, war gedanklich aber noch bei dem Typen. Dank ihm hatte mich die seltsame Unruhe ergriffen, die mich jedes Mal überkam, wenn ich an meine verlorene Vergangenheit erinnert wurde. Und das gefiel mir ganz und gar nicht.
Was die Party anging, hatte Grayson nicht übertrieben. Fast die gesamte Schülerschaft hatte sich um ein mannshohes Strandfeuer versammelt, ein paar Bierfässer waren angekarrt worden, Musik dröhnte und mir war von den vielen verkohlten Marshmallows, die ich schon verputzt hatte, ganz flau im Magen.
»Marshmallow?«, fragte jemand hinter mir.
Ich drehte mich um. Es war Robby, der mir einen Stock mit brutzelnden Marshmallows unter die Nase hielt.
»Nein danke!«, lehnte ich ab.
Rachel ergriff meine Hand und zog mich mit sich durch die Reihen der Feiernden in Richtung Meer. Einige Meter von den Wellen entfernt zog sie sich ihr Shirt über den Kopf.
»Was hast du vor?«, fragte ich.
»Baden!«
»Aber du …« Sie trug ja nicht mal einen Bikini.
Ein paar Mädchen rannten lachend und schreiend an uns vorbei, warfen ihre Klamotten von sich und stürmten nur in Unterwäsche in die Brandung.
»Wartet auf uns!«, rief Grayson und schlüpfte aus seinen Shorts.
Seine Anwesenheit erklärte Rachels plötzlichen Anflug von Übermut. Normalerweise war sie nicht der Typ dafür, sich Hals über Kopf in die eisigen Wellen zu stürzen. Schon gar nicht ohne ihren schicken neuen Bikini von Versace, den sie mir erst kürzlich vorgeführt hatte.
»Komm schon, Mia!«, forderte sie mich auf und ließ ihren Rock fallen. »Raus aus den Sachen. Trau dich!«
»Keine Lust«, lehnte ich ab. Ich musste ja niemandem imponieren und dem Gekreische der Mädchen nach zu urteilen, hatte das Wasser Nordpoltemperatur.
»Dann halt das für mich.« Sie gab mir ihre Klamotten und rannte los.
Ich blieb allein am Strand zurück. In meinem Rücken feierten sie rund um das Lagerfeuer, vor mir eroberten sie die Wellen. Jemand hielt mich wohl für einen menschgewordenen Kleiderständer, denn ich bekam weitere Klamotten zugeworfen und auch einen Becher mit Bier in die Hand gedrückt. Ich schnupperte daran und verzog angeekelt den Mund. Irgendetwas war in diesem Bier. Pfefferminzschnaps? Wer kam denn auf so eine Idee?
Nachdenklich schaute ich dabei zu, wie sich Rachel, Grayson und die anderen gegenseitig nass spritzten und bei jeder Welle laut quiekten und lachten. Vielleicht hätte ich mich doch anschließen sollen. Es kam mir manchmal vor, als würde ich mich selbst sabotieren. Zu allem, was Spaß machte, musste mich Rachel überreden, als würde ich mich unterbewusst dagegen wehren, wirklich in Palm Beach anzukommen.
»Mia!«, rief mir Robby vom Lagerfeuer aus zu. »Lust zu tanzen?«
Normalerweise hätte ich abgelehnt, aber ich wollte mir nicht länger selbst im Weg stehen. »Klar!«, rief ich. Kurz entschlossen hob ich den Becher an und leerte das Bier-Pfefferminzschnaps-Gemisch in einem Zug. Anschließend legte ich die Klamottensammlung ab. Ich rannte zurück zur Party, verlor Robby im Getümmel aber aus den Augen. Weit konnte er nicht gekommen sein, also suchte ich nach ihm, fand dabei jedoch jemand ganz anderen: Unter die Feiernden hatte sich Sexy-007 gemischt, der Typ von der Promenade.
Erst aus der Nähe erkannte ich, wie treffend die Bezeichnung sexy war. Der zarte Stoff seines Hemdes setzte die Konturen seines definierten Oberkörpers perfekt in Szene, und die Art, wie er sich bewegte, war von einer geradezu raubtierhaften Anmut. Dazu kamen die pechschwarzen Haare im Kontrast zu seiner blassen Haut, Gesichtszüge wie gemalt, hohe Wangenknochen und ein bedrohliches Funkeln im Blick. Ich versank in seinen grün schimmernden, unergründlichen Augen, die forschend auf jede Bewegung in seiner unmittelbaren Umgebung reagierten.
Es konnte doch kein Zufall sein, dass ich ihm nun schon zum zweiten Mal an diesem Tag begegnete. Schicksal vielleicht? So ein Quatsch. Mein Leben spielte doch nicht in einem dieser schnulzigen Liebesstreifen, die sich Dorothy jeden Abend antat. Verfolgte er mich etwa? So ernst, wie er wirkte, sah er jedenfalls nicht nach einem Partygast aus. Zumindest nicht nach einem, der sich amüsierte – oder auch nur wusste, wie das ging.
»Hey!«, rief ich ihm zu, aber da tauchte er bereits in der Menge unter.
Ich folgte ihm. Wenn er mich wirklich stalkte, wollte ich das gar nicht erst ausufern lassen und ihn direkt zur Rede stellen. Bei meiner Vergangenheit hatte ich schon genug Probleme, ich brauchte nicht auch noch einen Typen, der mir heimlich nachstellte.
Ich schlängelte mich durch die Leute, vorbei an ein paar grölenden Footballspielern, an knutschenden Pärchen und wild tanzenden Headbangern, bis ich den Partystrandabschnitt einmal komplett durchquert hatte, ohne den Fremden einzuholen.
Genervt schaute ich mich um. Ich hätte wetten können, ihm dicht auf den Fersen gewesen zu sein. Nicht nur, dass ich ihm völlig umsonst gefolgt war, jetzt war mir auch noch speiübel. Ich hätte nach den vielen Marshmallows wohl besser keinen Pfefferminzschnaps trinken sollen.
Ich seufzte, wandte mich wieder den Feierwütigen zu und schrie erschrocken auf, weil jemand direkt vor mir stand.
Zu meiner Erleichterung war es Rachel.
»Alles okay bei dir?«, fragte sie.
Sie hatte sich ihre Sachen über die klitschnasse Unterwäsche gezogen, was dafür sorgte, dass sich ihr BH unter ihrem Shirt abzeichnete.
»Da war nur wieder …«, begann ich.
Rachel lachte laut auf, weil Grayson sie von hinten gepackt hatte, zu sich heranzog und ihren Hals küsste. Offenbar waren sich die beiden im Wasser nähergekommen.
»Was hast du gesagt?«, fragte Rachel.
»Nichts«, wehrte ich ab. »Nur, dass ich jetzt nach Hause gehe.«
So schlecht, wie mir war, hielt ich das für die beste Idee. Es käme bestimmt nicht gut, meinen Magen vor der versammelten Schule am Strand zu entleeren.
Rachel war so mit Grayson beschäftigt, dass sie nicht antwortete, also wandte ich mich zum Gehen.
»Warte, ich bringe dich nach Hause!«, bot sie an.
»Schon gut«, lehnte ich ab. Ich wollte ihr die Party nicht vermiesen. »Es ist ja nicht so weit. Wir sehen uns dann morgen, okay?«
Rachel war schon wieder mit Grayson zugange und hatte mich entweder nicht gehört oder nicht den Atem, um mir zu antworten. Ich beließ es dabei und ging.
Ab heute kann man mich mit Pfefferminze jagen
Es war nur ein Katzensprung vom Strand bis zu mir nach Hause. Ich musste über den North Ocean Boulevard, dann nach links und durch ein paar schmale Gassen, an den vielen schicken Villen vorbei, von denen die Turners eine bewohnten.
Ich war schon fast angekommen, als mich ein mulmiges Gefühl ergriff. Mein Herz schlug heftiger, ich wurde nervös, lief schneller und schaute mich immer wieder um. Entdecken konnte ich aber niemanden. So kurz der Weg auch war, ich bereute allmählich, dass ich keine Begleitung hatte. Es war bereits nach dreiundzwanzig Uhr, weit und breit war keine Menschenseele zu sehen und von Straßenlaternen hielten die Anwohner wohl auch nicht viel.
Als ich um die nächste Ecke bog, hallten Schritte hinter mir. Ein flüchtiger Blick über meine Schulter reichte aus, um zu bestätigen, was ich schon befürchtet hatte: Mister Sexy-007 war mir auf den Fersen.
Ich überlegte, ob ich rennen sollte, entschied mich aber dagegen. Auch wenn ich Angst hatte, überwog meine Wut. Was war das denn für ein Idiot, der unschuldigen Mädchen nachstellte? Während andere im Urlaub Vögel beobachteten, tat er das mit Frauen, oder was? Wahrscheinlich turnte es ihn auch noch an, wenn seine Opfer Angst bekamen. Diese Freude wollte ich ihm garantiert nicht machen.
Ich wich in eine Seitenstraße aus, schlüpfte schnell hinter eine Hecke und wartete, bis er auf meiner Höhe angekommen war. Dann trat ich ins Freie.
»Hör auf, mir nachzulaufen, du Perversling!«, brüllte ich ihn an und stieß ihn grob von mir.
Völlig überrumpelt, blieb ihm keine Zeit zu reagieren. Er stolperte auf die Straßenmitte und wäre beinahe gestürzt.
»Was fällt dir eigentlich ein?«, setzte ich nach.
Ich lief auf ihn zu, um ihn erneut wegzustoßen. Doch diesmal war er vorbereitet und packte blitzschnell meine Handgelenke. Erschrocken zerrte ich daran.
»Jetzt beruhig dich erst mal«, bat er in einem warmen, durchdringenden Tonfall.
»Beruhigen?!« Ich versuchte, mich aus seinem Griff zu winden, kam aber nicht frei, sodass ich schließlich aufgab und zu ihm aufschaute.
Im fahlen Mondlicht wirkte sein Teint noch blasser. Sein pechschwarzes Haar hing in Strähnen vor seinen schmalen jadegrünen Augen und ich war regelrecht betäubt von seinem einnehmenden Blick, der tief in mein Inneres vordrang und dabei Dinge zu sehen schien, von denen selbst ich nichts wusste.
Wie ein Serienmörder sah dieser Typ nicht aus. Ganz im Gegenteil. Er wirkte freundlich, aber auch gefährlich. Woran das lag, konnte ich schwer festmachen. Vielleicht, weil er so gelassen blieb, als wäre es nicht das erste Mal, dass sich jemand aus dem Hinterhalt auf ihn gestürzt hatte. Wenn ich darüber nachdachte, sprach das dann doch für einen Serienmörder.
Er musterte mich ausgiebig, als würde er jede meiner Bewegungen genauestens studieren. Was er sah, schien etwas in ihm auszulösen, denn ein zufriedenes Lächeln schlich sich auf seine Lippen.
»Was grinst du jetzt so blöd?«, knurrte ich. »Lass mich sofort los!«
Er ließ auf der Stelle von mir ab, hob entschuldigend die Hände und trat einen Schritt zurück. »Hör zu …«, begann er.
In diesem Moment ging in einer der Villen das Licht an und ich hörte, wie gegenüber ein Fenster geöffnet wurde.
»Jetzt wirst du –«, begann ich, stockte aber, weil der Fremde verschwunden war. Verwundert schaute ich mich nach ihm um.
»Ruhe da draußen!«, rief jemand.
Ich verdrehte die Augen. Das war ja mal eine super Reaktion auf den Hilferuf einer in Not geratenen Frau. Obwohl ich mir inzwischen nicht mehr ganz so sicher war, ernsthaft in Gefahr gewesen zu sein. Der Typ war mir wirklich nicht wie ein Perverser vorgekommen.
Ich rieb mir die Handgelenke und machte mich auf den Heimweg. Er hatte ganz schön fest zugepackt, und wenn er es darauf angelegt hätte, wäre es ihm bestimmt nicht schwergefallen, mich zu verschleppen. Vielleicht war es nicht die beste Idee gewesen, mich ihm allein entgegenzustellen. Zu meinem Glück war es gut ausgegangen.
Zu Hause angekommen, schlüpfte ich auf Zehenspitzen durch die Tür und schloss sie leise hinter mir. Es war ziemlich spät geworden. Im Wohnzimmer flimmerte zwar noch der Fernseher, aber die Lichter waren bereits aus.
Ich machte einen großen Schritt über die quietschende Diele, schlich zur Treppe und stieß mir auf dem Weg dorthin den kleinen Zeh an dem blöden Sideboard, das es schon öfter auf mich abgesehen hatte. Es verrutschte knarzend, ich biss mir auf die Lippe, um einen Aufschrei zu unterdrücken, hüpfte auf einem Fuß und fegte beim Versuch, mich festzuhalten, die Schlüsselschale zu Boden. Klirrend verteilte sich der Inhalt über den Flur.
Im Wohnzimmer schraken Josh und Dorothy vom Sofa auf. Offenbar waren sie dort eingeschlafen.
»Mia?«, fragte Dorothy verschlafen.
Josh gähnte. »Wie viel Uhr ist es?«
»Ähm … Neun?«
»Du hättest um zehn zu Hause sein sollen.« Dorothy kam zu mir gelaufen. Offenbar nahm sie mir nicht ab, dass es erst neun Uhr war. Das Lügen musste ich wohl noch üben.
Dorothy war eine hübsche Frau mit schmaler Figur, glatten blonden Haaren, die sie meist zu einem Zopf hochgebunden trug, und kleinen Segelohren, die dadurch erst richtig zur Geltung kamen. Wirklich wütend hatte ich sie noch nie erlebt. Sie war unheimlich verständnisvoll und mitfühlend. Auch diesmal wirkte sie keineswegs böse auf mich, eher enttäuscht, was es mir nicht leichter machte.
Mein schlechtes Gewissen meldete sich sofort. Ich ging in die Hocke und sammelte eilig den heruntergefallenen Kram ein. Dorothy half mir dabei.
»Es ist wichtig, dass wir ein Team bilden«, erklärte sie. »Wir wollen dir vertrauen, aber dafür musst du uns und unseren Regeln auch vertrauen. Verstehst du?«
»Sorry, ich habe einfach nur die Zeit aus den Augen verloren«, murmelte ich schuldbewusst.
»Wofür haben wir dir denn ein Handy besorgt, wenn du es nicht benutzt, um uns in solchen Fällen Bescheid zu geben?«
Josh schlürfte in Richtung Küche. »Ich mache uns erst mal einen Tee.«
»Das ist eine gute Idee«, meinte Dorothy und stellte die Schüsselschale zurück an ihren Platz. »Kommst du?«, forderte sie mich auf.
Ich schielte zu Treppe. Eigentlich wäre ich viel lieber auf mein Zimmer gegangen. Ich war müde, mir war noch immer übel vom Pfefferminzschnaps und wahrscheinlich roch mein Atem nach Bier, was die beiden nicht unbedingt mitbekommen mussten. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Dorothy ein Nein akzeptieren würde, also folgte ich ihr. Josh hatte bereits den Wasserkocher angeschaltet und drei Tassen mit Teebeuteln ausgestattet. Natürlich handelte es sich um Pfefferminztee, wie hätte es auch anders sein können. Ich unterdrückte den Drang zu würgen.
Wir setzten uns an den Tisch und Dorothy legte ihre Hand auf meinen Arm. »Dann erzähl mal«, bat sie.
Verwundert schaute ich von ihr zu Josh und wieder zurück. »Was soll ich erzählen?«
»Wo du warst, wieso es so spät geworden ist …«, schlug Josh vor, lehnte sich an die Küchenzeile und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Warst du denn mit Freunden unterwegs?«, fragte Dorothy. »Gibt es vielleicht jemanden, den du ganz besonders gerne magst?«
»Ähm …« Die ganze Sache kam mir suspekt vor. Was wollten sie denn von mir hören? Ich hatte erwartet, dass sie mir Hausarrest aufbrummen würden. Stattdessen fühlte ich mich wie bei einem Verhör.
»Ich war mit Rachel am Strand«, erklärte ich.
»Und diese Rachel magst du ganz besonders gern?«, hakte Dorothy nach. »Also, für uns ist das in Ordnung, wenn du –«
»Was? Nein! Also, klar das ist es völlig in Ordnung, aber ich stehe auf Jungs, okay?« Konnte es noch peinlicher werden? Wie dieses Gespräch so eine Richtung einschlagen konnte, war mir schleierhaft. Wie kamen sie denn auf diese Gedanken?
Josh stellte die Teetasse vor meine Nase.
»Wir haben das Gefühl, dass du Mauern baust«, erklärte Dorothy.
Ob sie das aus einem Erziehungsratgeber hatte? Gab es denn Bücher über den Umgang mit Vollwaisen im Teeniealter, die einem vom Staat aufgedrückt worden waren? Wahrscheinlich. Schließlich gab es Bücher für alle Eventualitäten.
»Du verschließt dich vor dem Leben und auch vor uns«, fuhr Dorothy fort. »Wir wollen dir nur helfen, dich besser einzufinden. Das verstehst du doch, oder?«
»Ich … ich verschließe mich nicht«, behauptete ich. »Also … nicht wirklich. Vielleicht ein bisschen. Aber ich weiß auch nichts von früher! Wie soll ich denn mit meinem alten Leben abschließen, wenn ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann? Mir erzählt ja niemand irgendetwas.«
Es tat gut, das rauszulassen. Trotzdem bereute ich es. Die beiden gaben sich so viel Mühe, mir ein Zuhause zu bieten, ich wollte ihnen keine Vorwürfe machen oder das Gefühl geben, zu wenig für mich zu tun.
»Was willst du denn wissen?«, fragte Josh.
Dorothy warf ihm einen mahnenden Blick zu, wandte sich wieder an mich und lächelte milde. »Der Arzt hat gesagt, dass du dich nicht unter Druck setzen darfst. Dein Gedächtnis kann durchaus zurückkommen, aber dafür musst du dir Zeit lassen. Es bringt nichts, wenn man dir alles erzählt. Hast du denn mit Doktor Scott über diese Dinge gesprochen?«
Doktor Scott war mein Therapeut. Ich besuchte ihn einmal pro Woche und eigentlich tat ich nichts weiter, als ihm von meinem Alltag zu berichten. Viele Fragen stellte er nicht und Antworten bekam ich auch keine. Genauso gut hätte ich einen Smiley an meine Zimmerwand malen und mit dem reden können. Der würde dann wenigstens nicht so grimmig gucken, nach altem Mann müffeln und mir einreden wollen, meine sarkastischen Sprüche und Gedanken wären nur ein Bewältigungsmechanismus, durch den ich meine Probleme auch nicht in den Griff bekommen würde.
»Der weiß doch nichts von meinen Eltern …«
»Sie waren ein ganz bezauberndes Paar«, versicherte mir Dorothy zum gefühlt tausendsten Mal.
So freundlich sie auch war und so viel Mühe sie sich auch gab, diese Worte schon wieder zu hören, machte mich wütend. »Das habt ihr mir schon so oft gesagt«, knurrte ich. »Aber was ist mit mir?«
Ich konnte die beiden gar nicht anschauen.
»Was meinst du?«, fragte Josh.
»Was waren meine Hobbys? War ich gut in der Schule? Hatte ich viele Freunde? Wieso hatte ich kein Handy oder ein Insta-Profil? Oder habe ich eins, kann mich aber nicht daran erinnern? Vielleicht bin ich ja ein berühmter TikTok-Star? Ich meine, es muss doch jemanden geben, mit dem ich reden kann. Jemanden aus meiner Vergangenheit.«
»Über diese Dinge wissen wir leider nichts«, sagte Josh. »Es ist zehn Jahre her, dass wir mit deinen Eltern Kontakt hatten. Wir wussten nicht einmal, dass wir in ihrem Testament für deine Vormundschaft vorgesehen waren.«
»Aber wir sind sehr glücklich, dich bei uns zu haben!«, fügte Dorothy eilig hinzu.
»Laut Jugendamt waren deine Eltern und du viel unterwegs. Ihr hattet lange keinen festen Wohnsitz. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso es dir an Bindungen zu deinem vorherigen Leben fehlt.«
Das hatte ich alles schon hundertmal gehört und auch bei Version 101 klang es nicht weniger weit hergeholt als Rachels Theorie, dass ich eine Mafia-Prinzessin sein könnte und vom FBI beobachtet wurde.
Ich nahm die Teetasse in die Hände, bekam den Pfefferminzduft in die Nase und verzog angeekelt das Gesicht.
»Kann es sein, dass du getrunken hast?«, fragte Josh.
»Ähm … Nein?« Zu lügen war wirklich nicht meine Stärke. Ich sollte mir von Rachel Nachhilfe geben lassen. Die leierte ihrem Vater regelmäßig die Kreditkarte aus der Tasche, indem sie ihm von Schulbällen bis hin zu Kostümen für erfundene Theaterstücke alles auftischte, was sie aus dem Hut zaubern konnte.
Dorothy presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. »Am besten, du schläfst dich erst einmal aus. Morgen können wir weiterreden.«
Eigentlich hatte ich kein großes Interesse daran, das Gespräch am nächsten Tag fortzusetzen, aber wenn mich das aus der Küche brachte, wäre ich auch bereit gewesen, ihnen meine linke Niere zu versprechen.
»Okay«, stimmte ich zu und stand auf.
Vom Flur aus warf ich noch einen kurzen Blick zurück. Josh war an Dorothy herangetreten, rieb ihr die Schultern und sie seufzte schwer. Offenbar waren die beiden wirklich besorgt um mich. Dabei hatte ich das Gefühl gehabt, mich schon ganz gut eingelebt zu haben. Den Umständen entsprechend gut. Zumindest gab ich mir die größte Mühe, es auf alle so wirken zu lassen. Einschließlich auf mich selbst.
Ich nahm die Treppe nach oben und verschwand in meinem Zimmer, das vor Kurzem noch Joshs Büro gewesen war. Es gab einfach so viele Fragen, die mich quälten. Wie hatte ich früher gelebt? Im Auto oder in einem Wohnwagen? Oder waren meine Eltern so etwas wie Airbnb-Fanatiker gewesen, die von einer verrückten Unterkunft in die nächste gezogen waren?
Mit einem Seufzen ließ ich mich rücklings auf mein Bett fallen. Ich liebte Palm Beach wirklich. Aber ich hasste es, ohne Gedächtnis zu sein. Ich hasste dieses ständige Gefühl, etwas ganz Wichtiges vergessen zu haben. Wie wenn man etwas zu Hause liegen gelassen hatte, aber nicht mehr wusste, was es war. Handy, Schlüssel, ein Schulbuch. Ich kam einfach nicht darauf und das brachte mich zur Weißglut.
Frustriert zog ich mir die Decke über den Kopf. Vielleicht würde sich dieses Gefühl legen. Irgendwann. Wenn nur genug Zeit vergangen war.
Es gibt Schlimmeres als Hausarrest
Als ich am nächsten Morgen die Stufen nach unten nahm, stieg mir der Duft nach frischen Pancakes in die Nase. Josh machte die besten Pancakes der Welt! Sowieso war er ein toller Koch. Ganz im Gegensatz zu Dorothy, die es schaffte, selbst einen einfachen Salat zu versalzen.
Ich nahm die letzten Stufen mit einem Satz und bremste gerade noch rechtzeitig ab, um einen Zusammenstoß mit dem Sideboard zu vermeiden. Mir war es noch immer ein Rätsel, wieso Dorothy das Teil mitten in den Durchgang gestellt hatte.
»Ich hoffe, du hast Hunger!«, rief mir Josh zu.
Dorothy kam gerade in ihrem Jogginganzug von draußen herein. Sie zog sich die Stöpsel aus den Ohren und das Schweißband von der Stirn.
»Guten Morgen, Mia«, begrüßte sie mich außer Atem. »Hast du gut geschlafen?«
»Wie ein Baby«, sagte ich.
»Sei froh, dass ich dich nicht aus dem Bett geholt habe. Nachdem du gestern so spät nach Hause gekommen bist, hätte ich dich zwingen sollen, mit mir joggen zu gehen.«
»Dazu hättest du mich knebeln und fesseln und hinter dir herschleifen müssen.«
Sie lächelte süffisant. »Warte nur ab, irgendwann wecke ich noch mal den Sportsgeist in dir.«
»Kaffee, Liebling?«, fragte Josh aus der Küche.
»Liebend gern«, antwortete sie.
Eigentlich gab es keinen Grund, aus dem es mir so schwerfallen sollte, mein altes Leben loszulassen. Besser, als in einer Villa in Palm Beach zu wohnen, hätte ich es doch nicht treffen können. Ich lebte bei tollen Menschen, hatte ein tolles Zuhause in einer tollen Gegend. Alles war toll.
Irgendwie … vielleicht … zu toll.
Ich schüttelte diesen Gedanken ab, setzte ein Lächeln auf und lief in die Küche. Josh stand im Pyjama am Herd, hantierte mit der Pfanne und schwang sie in die Luft, um den Pancake zu wenden – der herumwirbelte und neben dem Herd auf der Arbeitsplatte landete.
»Oh … den esse ich«, sagte er verlegen.
Auf dem Esstisch standen bereits gefüllte Kaffeetassen und ein ganzer Stapel Pancakes. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, ich setzte mich, türmte gleich ein halbes Dutzend davon auf meinen Teller und übergoss sie großzügig mit Ahornsirup.
»Einen Kater hat unsere Schwerverbrecherin wohl nicht«, meinte Josh.
»Ich war nicht mal eine Stunde zu spät«, verteidigte ich mich.
Er wuschelte mir durchs Haar, was ein seltsam beklemmendes Gefühl in mir auslöste. War das ein Déjà-vu? Erinnerte ich mich, dass auch früher jemand mein Haar auf diese Weise zerzaust hatte? Ich wusste es nicht.
»Auch wenn es nur fünf Minuten gewesen wären, über deine Strafe reden wir noch«, drohte er an.
»Das eine Mal können wir doch durchgehen lassen«, meinte Dorothy.
»Du weißt, was Doktor Scott gesagt hat«, ermahnte er sie mit erhobenem Pfannenwender. »Regeln und Struktur sind das Wichtigste.«
»Du hast recht«, räumte sie ein. »Aber übertreiben muss man es nicht. Drei Tage Hausarrest wären angemessen, denke ich.«
In dem Moment vibrierte mein Handy. Ich warf einen Blick darauf.
»Ist die Nachricht von deiner Freundin? Dieser Rachel?«, fragte Dorothy neugierig.
»Nein.« Die Nachricht war nicht von ihr, sie war von Robby. Wahrscheinlich hatte er meine Nummer von Rachel. Er fragte, ob wir uns am Pier treffen wollten.
Dorothy schielte auf mein Handy. »Ui, wer ist denn dieser Robby? Magst du ihn?«
Offenbar sollte es beim Frühstück genauso peinlich weitergehen, wie der Abend zuvor geendet hatte. »I-ich denke, er ist ganz nett.«
»Dann solltest du dich mit ihm treffen!«
»Schatz!«, warnte sie Josh eindringlich.
»Ach, stimmt ja, Hausarrest. Aber der kann doch auch nach dem Wochenende anfangen, oder?«
Josh seufzte. »Wir können wirklich froh sein, dass Mia so ein braves Mädchen ist. Bei deinen Erziehungsmethoden wärst du mit allem anderen überfordert.«
»Sie findet ihn nett, Josh«, erinnerte Dorothy ihn.
»Also, es ist nicht so, dass …« Ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen sollte. Auf der einen Seite wollte ich nicht, dass sie glaubten, ich würde auf Robby stehen, auf der anderen Seite hatte ich aber auch keine große Lust, das Wochenende im Haus verbringen zu müssen.
»Schon gut, du musst uns das nicht erklären, wir waren schließlich auch mal jung«, wiegelte sie ab.
Josh setzte sich hin. »Jetzt iss erst mal deine Pancakes und dann kannst du dich mit deinen Freunden treffen. Aber ab Montag gibt es keinen Strand, kein Eis an der Promenade und erst recht keine Partys mehr.«
»Einverstanden«, sagte ich und machte mich über meine Pancakes her.
Mit einem mulmigen Gefühl traf ich auf dem Parkplatz am Pier ein. Warum Robby diesen Treffpunkt vorgeschlagen hatte, wollte er mir nicht verraten. Es sei eine Überraschung, hatte er geschrieben.
Ich schaute noch einmal auf mein Handy. Weder er noch Rachel hatten bisher auf meine Nachrichten reagiert.
Das mulmige Gefühl breitete sich in meiner Magengegend aus und ich rieb mir den Bauch. Vielleicht hatte ich doch einen Kater und hätte nicht so viele Pancakes essen sollen. Wahrscheinlicher war allerdings, dass ich Angst hatte, was mich erwarten würde. Im schlimmsten Fall war es Robby in Anzug und Krawatte, mit einem Dutzend roter Rosen und Pralinen. Mich schauderte bei dem Gedanken. Ich hatte seit der Party schon genug Peinlichkeiten erlebt. Das hätte ich nicht auch noch ertragen.
Endlich vibrierte mein Handy. Rachel hatte auf meinen Hilferuf reagiert. Ich rief ihre Nachricht auf und überflog ihre Antwort, die lediglich aus einer Reihe Emojis bestand. Hauptsächlich Herzen und Figuren, die Händchen hielten, seltsamerweise ein Bikini und eine Aubergine. Das war wirklich hilfreich …
Ich schnaubte und ließ das Handy wieder in meiner Hosentasche verschwinden.
»Mini!«, rief jemand.
Ich schaute mich um. Ein Mädchen mit dicken braunen Flechtzöpfen lief über den Parkplatz, warf einen Blick unter eines der Autos und drehte sich dann suchend im Kreis. »Miiiniii!«, rief sie noch einmal.
»Suchst du jemanden?«, stellte ich die wohl dämlichste Frage, die einem in so einer Situation in den Sinn kommen konnte. Was sollte sie denn sonst machen? Echolot?
»Mein Hund ist weggelaufen. Strubbliges Fell, ungefähr so groß.« Sie hielt ihre Hände hüftbreit auseinander. »Hast du ihn gesehen?«
»Nein, sorry.« Ich warf einen Blick zum Pier. Robby wartete wahrscheinlich schon auf mich, aber das Mädchen wirkte ziemlich verzweifelt und ich machte mir Sorgen, dass ihr Hund auf die Straße rennen könnte.
»Wie heißt du?«, fragte ich.
»Santana«, stellte sie sich vor.
»Mia«, entgegnete ich. »Soll ich dir beim Suchen helfen?«
»Oh, liebend gern! Danke! Er war eben noch da und plötzlich war er weg. Bestimmt versteckt er sich unter einem Auto vor der Hitze.«
So heiß war es an dem leicht bewölkten Vormittag zwar nicht, aber ich trug ja auch kein Zottelfell.
»Mini heißt er?«
»Genau.«
Ich ging in die eine Richtung und Santana in die andere. Immer wieder rief ich den Hund, schaute unter jedes Auto, ohne Erfolg.
»Ich glaube, dort hinten hat sich was bewegt!«, rief mir Santana zu.
Ich lief zu ihr.
»Gleich unter dem Van«, sagte sie mit gesenkter Stimme. »Schleich du dich von der Seite an und ich mich von vorne, okay?«
Ich legte die Stirn in Falten. »Wieso rufen wir deinen Hund eigentlich die ganze Zeit, wenn er so schreckhaft ist, dass wir ihn umzingeln müssen?«
»Sicher ist sicher«, sagte sie.
Ich zuckte mit den Schultern. Was wusste ich schon? Ich hatte keinen Hund und auch keine Erfahrung mit dem Einfangen von Hunden. Auf Zehenspitzen schlich ich um den Van, während Santana die andere Richtung einschlug. Ich duckte mich, um unter das Auto schauen zu können, als plötzlich die Seitentür aufgeschoben wurde. Erschrocken richtete ich mich auf und traute meinen Augen kaum, als ich Mister Sexy-007 im Van hocken sah. Das konnte nur ein schlechter Scherz sein!
Ich wich zurück, doch Santana packte mich wie aus dem Nichts von hinten und der Junge im Van hatte meine Arme ergriffen, bevor ich mich von ihr befreien konnte. Mit einem Ruck zog er mich zu sich und ich landete mit dem Gesicht voran im Van.
»Loslassen!«, schrie ich, schlug mit der freien Hand nach ihm und trat wild um mich, in der Hoffnung, Santana zu treffen.
Zu meiner Verwunderung ließ er tatsächlich von mir ab.
»Das läuft ja super!«, beschwerte sich Santana.
Ich warf mich auf den Rücken, wollte aufspringen und fliehen, doch sie versperrte mir den Weg und stieß mich zurück, sodass ich mit dem Ellbogen aufschlug.
»Autsch!«, stieß ich aus.
»Als hätte ich dich nicht gewarnt«, fuhr der Junge sie an. Er hockte neben mir und machte noch immer keine Anstalten, mich festzuhalten. »Sieh zu, dass sie still ist.«
»Was soll das?«, warf ich den beiden entgegen. Ich versuchte vergebens, wieder auf die Beine zu kommen. Santana warf sich über mich.
»Wer seid –«, sagte ich noch, da drückte sie mir schon ihre Hand auf den Mund. Ich trat erneut um mich, wollte sie von mir stoßen und riss panisch die Augen auf, als ihr Begleiter die Tür zuzog.
»Am besten, du schläfst jetzt erst mal für eine Weile.« Santana wedelte mit ihrer Hand vor meinem Gesicht und flüsterte etwas in einer fremden Sprache. Eine seltsame Müdigkeit umfing mich, alles verschwamm, dann wurde es dunkel.
Ich hörte die beiden reden, konnte sie aber nicht verstehen. Ihre Stimmen klangen fern und dumpf. Erst nach und nach wurden sie wieder klarer, statt Dunkelheit sah ich verschwommene Kleckse, blinzelte und erkannte meine Knie. Offenbar lag ich nicht mehr im Van, sondern saß auf einem Stuhl.
Panik ergriff Besitz von mir. Wer waren die beiden? Was hatten sie mit mir vor? Ich spürte ein Seil um meine Handgelenke, mit dem ich in meinem Rücken an die Stuhllehne gefesselt war. Zudem steckte ein Knebel in meinem Mund. Aufschauen wollte ich nicht. Noch wussten meine Entführer nicht, dass ich aufgewacht war, und das sollte auch erst einmal so bleiben. Vielleicht bekam ich ja mit, was sie dazu getrieben hatte, mich zu verschleppen, wenn ich mich ruhig verhielt.
»Das hätte viel schneller gehen müssen«, meinte Santana.
Ich hörte, wie sie auf und ab ging. »Was, wenn uns jemand gesehen hat?«
»Ich habe dir gesagt, dass du ihr sofort den Mund zuhalten musst.«
»Ich war in Panik!«, maulte sie. »Man entführt nicht alle Tage jemanden auf offener Straße.«
»Beim nächsten Mal klappt es bestimmt besser«, meinte er in erschreckend gelassenem Tonfall.
»Beim nächsten Mal?«, warf sie ihm schrill entgegen. »Wen willst du als Nächstes verschleppen, Ashton? Deinen Paketboten, weil deine letzte Bestellung eine Macke hatte? Den Lieferjungen, weil die Pizza kalt bei dir angekommen ist?«
»Hegst du irgendeinen Groll gegen Lieferanten?«, fragte er.
»Kann schon sein, aber das tut hier nichts zur Sache! Wichtig ist jetzt, dass wir … warte mal, ich glaube, sie ist wach.«
Na super! Gerade, wo es spannend geworden war. Ich hob den Kopf und schaute mich um. Wir waren in einem dieser heruntergekommenen Hotelzimmer mit dreißig Jahre altem Fernseher, der garantiert nicht funktionierte, Betten mit Münzeinwurf und Wänden wie Papier. Wahrscheinlich gehörte auch ein ziemlich gruseliger Typ an der Rezeption dazu, der für ein paar Dollar wegschaute, wenn jemand eine ohnmächtige Geisel in eines der Zimmer schleppte.
»Hey, alles gut?«, fragte mich Santana freundlich. Sie beugte sich zu mir herunter.
Ich zerrte an meinen Händen und ruckelte am Stuhl. »Gnmpf iff gwwwt!«, maulte ich sie an.
»Was hat sie gesagt?«, fragte sie an ihren Komplizen gerichtet. Ashton hatte sie ihn genannt.
»Keine Ahnung«, sagte er.
Santana wandte sich wieder mir zu. »Warte, ich nehme dir den Knebel raus, dann kannst du reden.«
»Denk nicht mal dran«, drohte Ashton. »Sie könnte sonst was sagen.«
»Wir können sie ja bitten, still zu sein.«
»Und darauf hoffen, dass sie mir nicht so was wie ›Stirb!‹ an den Kopf wirft?«
Verwundert schaute ich von ihm zu ihr. Die beiden hatten mich entführt, aber sie tat jetzt besonders nett und er schob Panik, weil er Angst hatte, beleidigt zu werden? Was stimmte mit ihnen nicht?
Santana schmunzelte. »›Fuck you‹ wäre viel lustiger.«
»Nichts davon ist lustig«, grummelte er.
»Ein bisschen schon.« Sie schaute wieder zu mir. »Hör zu, wir können dir den Knebel leider noch nicht abnehmen. Aus Sicherheitsgründen. Aber ich kann dir das hier geben.«
Sie zog etwas aus ihrer Hosentasche. Ein geflochtenes schwarzes Lederarmband mit kleinen Anhängern. Auf die Schnelle erkannte ich nur einen Totenschädel und eine Katze. Als sie mir das Teil am Handgelenk befestigen wollte, wehrte ich mich allein schon aus Trotz. Die beiden waren doch verrückt! War das eine Art perverses Vorspiel? Oder hatte ich es mit Insassen einer Irrenanstalt auf der Flucht zu tun?
Mich gegen das Armband zu wehren, brachte natürlich nichts. Ich konnte mich kaum bewegen, geschweige denn verhindern, dass mich Santana schmückte wie einen Weihnachtsbaum. Sie hätte mir eine Krone aufsetzen und einen Schnurrbart ins Gesicht malen können, ohne dass ich dagegen etwas hätte tun können.
Santana richtete sich auf und nickte zufrieden. »Jetzt kann sie wenigstens niemand mehr aufspüren.«
»Niemand aus der Bruderschaft, allerdings sehr wohl die Polizei«, korrigierte Ashton sie.
Santana winkte ab. Dabei sah ich, dass sie dasselbe Armband trug. Wir liefen jetzt also im Partnerlook herum. Na ja, sie lief, ich saß noch immer gefesselt auf einem Stuhl.
»Um die Polizei müssen wir uns vorerst keine Sorgen machen«, meinte sie. »Alle glauben, dass sie sich mit diesem Jungen trifft. Hast du sein Handy noch?«
Ich riss erschrocken die Augen auf. Die beiden redeten von Robby! Hatten sie ihm etwas angetan?
»Das habe ich auf dem Parkplatz in eine Hecke geworfen«, sagte er. »Sicher ist sicher.«
Robby hatte mir also gar nicht geschrieben. Die Turners und Rachel dachten, dass ich mich mit ihm traf, und würden mich so schnell nicht vermissen.
»Okay, dann lass uns loslegen«, schlug Santana vor.
Das gefiel mir ganz und gar nicht, ich wehrte mich noch einmal gegen die Fesseln. »Lss dhh Fnghh vn mhhhr!«
Santana ging vor mir in die Hocke, Ashton baute sich hinter ihr auf.
»Ich verstehe kein Wort, Emily«, sagte sie. »Aber ich verspreche dir, dass alles gut werden wird.«
Emily? Konnte es sein, dass das Ganze eine Verwechslung war? Die beiden waren jedenfalls nicht vom FBI und ich war keine Mafia-Prinzessin. Was aber, wenn ich vor meinem Gedächtnisverlust tatsächlich einen anderen Namen gehabt hatte? Wenn ich wirklich in einer Art Zeugenschutzprogramm steckte?
»If bn nifft Emhily!« Mit dem Knebel bekam ich keinen geraden Satz zustande. Doch selbst wenn, hätten sie mir wohl kaum zugehört. Ich musste fliehen, bevor sie umsetzten, was auch immer sie mit mir vorhatten. Ich rüttelte heftig am Stuhl und tatsächlich gelang es mir, ihn zu bewegen. Allerdings war ich keine Superheldin, die das stabile Holz mit ein bisschen Krafteinsatz zersplittern lassen konnte. Der Stuhl wackelte, ich verlor das Gleichgewicht und kippte zur Seite weg.
Ein heftiger Schmerz schoss mir durch den Oberarm bis hinauf in den Schädel, weil der Aufschlag meinen Arm zwischen Lehne und Boden eingequetscht hatte.
Ashton stöhnte, als wäre er derjenige, der auf der Seite gelandet war.
In Filmen sahen solche Entfesselungsversuche immer viel unproblematischer aus. Da beschwerte sich niemand, wenn er ungebremst auf den Boden knallte, im besten Fall lösten sich dadurch sogar die Fesseln und eine spektakuläre Flucht begann. Ich lag bloß wie eine überfressene Raupe auf dem Boden, schrie in den Knebel und wand meine Handgelenke im festgezurrten Seil.
»Okay, das reicht jetzt«, sagte Ashton. »Sie bricht sich noch alle Knochen.«
Er packte die Stuhllehne und hievte mich wieder in eine aufrechte Position. Anschließend ging er vor mir in die Hocke. »Wir wollen dir nur helfen«, versprach er.
Ich hielt ihn und Santana zwar immer noch für übergeschnappt, aber die Art, wie er mich durchdringend anschaute, hatte etwas Beruhigendes an sich. Da war dieses sanfte, kaum merkliche Lächeln auf seinen Lippen, das ich nicht einordnen konnte. Aber es gab mir das Gefühl, er würde mich kennen, mich vielleicht sogar verstehen. Besser, als ich mich selbst verstehen konnte. Es war merkwürdig und auch beängstigend, diese Gedanken zu haben, nur ausgelöst vom Schwung seiner Lippen. Aber so fühlte ich in diesem Moment. Ich glaubte ihm, dass er nichts Böses im Sinn hatte. Auch wenn diese ganze Entführungssache nicht gerade für seine Unbescholtenheit sprach. Und dann hatte er mir auch noch nachgestellt. Die beiden hatten das von langer Hand geplant und egal, wie vertrauenswürdig er auch wirkte, er war trotzdem ein Verbrecher.
Ich schnaubte wütend durch die Nase. »Du knnst mif ml am Arshhh lckn!«
Ashtons Augen weiteten sich. Unsicherheit flackerte darin auf. »Ich …«, stammelte er. »Ich glaube, ich weiß …«
»Nein, weißt du nicht!«, fiel ihm Santana ins Wort. Sie packte ihn an der Schulter, zog ihn von mir weg und drängte ihn zu einem der Betten. Vom Nachttisch schnappte sie sich rosafarbene Hello-Kitty-Kopfhörer. »Denk nicht darüber nach«, forderte sie ihn auf. »Das kann alles und nichts geheißen haben, also vergiss es einfach.«
Sie legte ihm die Kopfhörer an.
»Ich versuche es«, sagte er leise und blickte stur zu Boden.
Mit diesen rosa Kopfhörern und dem grimmigen Gesichtsausdruck sah es schon verdammt niedlich aus, wie er am Bettrand hockte und Löcher in den Fußboden starrte.
Ich verdrehte die Augen. Jetzt fand ich meinen Entführer auch noch niedlich! Das war bestimmt der schnellste Fall von Stockholm-Syndrom, den die Welt je gesehen hatte.
»Und jetzt zu uns beiden«, sagte Santana und griff in ihre Tasche. Mein Herz schlug schneller. Ein zweites Mal würde ich bestimmt nicht so viel Glück haben und mit Schmuck überrascht werden.
Santana zog ihre Hand wieder hervor und ich atmete erleichtert aus. Sie hielt bloß ein Stück Kreide hoch. Damit begann sie einen Kreis um mich zu ziehen.
»Wss sll dss?« fragte ich.
Ich wurde immer besser mit dem Knebel. Noch ein paar Stunden, und ich könnte mich als Bauchrednerin versuchen. Allerdings hoffte ich, dass ich das Ding nicht mehr ganz so lange ertragen musste. Es war schon ziemlich durchgeweicht und ich spürte Spucke in meinen Mundwinkeln. Von Sabber kam in Filmen auch nie etwas vor, da mussten Entführungsopfer ja nicht einmal auf die Toilette. Ich schmetterte den Gedanken sofort ab. Wenn ich jetzt daran dachte zu pinkeln … Doch es war schon zu spät. Meine Blase drückte bereits.
Santana war mit ihren seltsamen satanistischen Kreisen und irgendwelchen Runen beschäftigt, die sie fein säuberlich um meinen Stuhl zeichnete, und Ashton konnte mich durch die Kopfhörer nicht hören.
»Iff muff auhfs Klllh!«, sagte ich eindringlich und so deutlich wie möglich.
»Es dauert nicht lange«, versprach Santana.
Entweder hatte sie mich nicht verstanden oder sie ignorierte die drohende Gefahr, dass ich ihr Ritual vollpinkelte.
»So, fertig«, sagte sie zufrieden und wandte sich Ashton zu. Sie schnipste vor seinem Gesicht, woraufhin er aufschaute und sie ihm eine Stelle der Kreise, Linien und Runen zeigte.
Er nickte, ging dorthin und legte seine Hand flach auf eine Rune am Rand des Kreises.
Die beiden würden sich noch wundern, wenn sie gleich ihre Dämonenbeschwörung durchziehen und feststellen müssten, dass ich mich dadurch nicht in einen gefallenen Engel oder so was in der Art verwandeln würde. Schließlich war ich nicht diese Emily, für die sie mich hielten.
Im ersten Moment gefiel mir der Gedanke, sie enttäuschen zu müssen, dann bekam ich es mit der Angst zu tun. Was würden sie mit mir anstellen, wenn sie keine Verwendung mehr für mich hatten? Wer konnte schon sagen, wie lange sie bereits durchs Land reisten, angebliche Emilys entführten und versuchten, etwas Dämonisches in ihnen zu wecken? Von genau so etwas hörte man doch ständig in den Nachrichten – durchgeknallte Serienmörder, die Dutzende Opfer auf dem Gewissen hatten.
Santana legte ihre Hand ebenfalls auf eines der Symbole und begann etwas zu murmeln, das sich nach einer uralten Sprache anhörte. Ich wackelte wieder mit dem Stuhl, auch wenn ich nicht wusste, was das bringen sollte, denn beim ersten Mal war ich auch nicht sehr weit gekommen.
Als plötzlich ein gleißendes Licht unter Ashtons Hand aufloderte, durch die Kreidelinien schoss und sich mit einem zweiten, von Santana ausgehenden Licht verband, hörte ich jedoch auf, mich zu wehren.
Was ging hier vor? War das irgendeine Art Trick? Eine Leuchtkreide, die auf Körpertemperatur reagierte? War ich vielleicht gar nicht wirklich entführt worden, sondern einem fiesen Prank auf den Leim gegangen? Was hätte ich nicht alles dafür gegeben, wenn im nächsten Moment ein Kamerateam hinter einem Vorhang hervorgesprungen wäre.
Leider passierte nichts dergleichen. Mein Atmen ging schneller, mir wurde schwindelig und das Licht blendete so stark, dass ich blinzeln musste.
Mir war mit einem Mal, als würde ein Film vor meinen Augen ablaufen. Ich sah Joshs Pancakes, Robbys Nachricht, die Schlüsselschale, wie sie zu Boden stürzte. Dann Ashton, im Dunkeln auf der Straße, die Party, das schmelzende Vanilleeis in meiner Hand. Mein Leben schien sich rückwärts und im Zeitraffer vor mir abzuspielen. Mein erster Schultag an der neuen Schule in Palm Beach, meine erste Begegnung mit den Turners, meine Ankunft am Flughafen. Alles drehte sich und hielt dann so abrupt inne, dass ich das Gefühl hatte, gegen eine Wand gelaufen zu sein. Die Bilder, die bis eben an mir vorbeigerast waren, stoppten unmittelbar vor einem Gesicht. Es war dunkel, roch modrig, ich befand mich vor einem fensterlosen Kellerloch. Und mir gegenüber stand … Cedric.
Die Hello-Kitty-Kopfhörer stehen dir
Ich hing wie benebelt in den Fesseln. In meinem Kopf herrschte Chaos, als hätte jemand darin eine Tür aufgestoßen, aus der die Erinnerungen der letzten sechzehn Jahre unsortiert herausgeplatzt waren wie Luftschlangen aus einer Scherzartikeldose.
»Du kannst die Kopfhörer jetzt abnehmen«, hörte ich Santana sagen, während sie den Knebel aus meinem Mund löste.
»DU KANNST DIE …«, wiederholte sie lauter, weil Ashton nicht reagierte. »Ach, vergiss es.«
»Cedric …«, stammelte ich angeschlagen.
Er war eingesperrt gewesen, in dem Kerkerloch in den Katakomben, unterhalb der Villa meiner Familie – dort, wo meine Erinnerungen endeten. Ich war kurz davor gewesen, ihn zu befreien, Antworten zu finden und dem wahren Drahtzieher hinter der Bruderschaft der Offenbarung auf die Spur zu kommen. Und dann?
Ich blickte auf.
»Alles gut«, sagte Santana. »Cedric ist noch im Gefängnis. Er stellt für niemanden mehr eine Gefahr dar.«
Ashton zog sich die Kopfhörer von den Ohren und ließ sie um den Hals hängen. Er musterte mich, als hätte ich mich gerade überraschend in den Raum teleportiert und wäre nicht von ihm an einen Stuhl gefesselt und festgehalten worden.
Ihn anzuschauen, ihn wahrhaft wiederzusehen, ließ alles um mich herum verstummen. Sogar das Chaos in meinem Kopf legte sich für einen Moment. Ashton war einfach zu perfekt. Wie gemalt. Das Leuchten seiner Augen, seine dichten, langen Wimpern, der Schwung seiner Lippen. Ich konnte kaum glauben, dass er mich geküsst hatte. Zwei Monate lag das zurück und noch immer war mir, als könnte ich ihn schmecken.
»Hey«, sagte er leise.
»Hey«, antwortete ich mit belegter Stimme. Mein Herz schlug schneller.
Es war seltsam. Befremdlich. Auf der einen Seite kam es mir vor, als hätten wir uns gerade erst geküsst, auf der anderen Seite lagen so viel Zeit und ein fremdes Leben zwischen damals und diesem Moment.
Was war passiert, nachdem ich Cedric gefunden hatte? Wo war er? Diese Gedanken wirbelten das Chaos in meinem Kopf neu auf. Ich wurde ungeduldig, wollte aufstehen, war aber noch gefesselt.
»Könnt ihr mich bitte losmachen?«, drängte ich und zerrte an meinen Händen.
»Klar, immer mit der Ruhe.« Santana friemelte am Seil herum.
Ich wurde nur noch nervöser. »Ihr versteht das nicht! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Cedric ist … ich weiß es gar nicht. Er ist nicht er. Also, er war …« Endlich waren meine Hände frei, ich sprang auf und bemerkte erst jetzt, dass meine Füße an die Stuhlbeine gebunden waren.
Die Erkenntnis kam zu spät. Ich ruderte zwar noch mit den Armen, konnte aber nicht verhindern, vornüberzukippen.
Ashton fing mich auf.
Wie ein Tropfen Wasser hing ich in seinen Armen, die Wange an seine muskulöse Brust gepresst, seinen unwiderstehlichen Duft in der Nase. Und verdammt noch mal, ich sabberte ihn an! Nicht, weil er verboten gut aussah und so verführerisch wie Schokoladensoufflé und Salted Caramel roch, sondern wegen des blöden Knebels, durch den mir die Spucke im Mund zusammengelaufen war.
»Warte«, sagte Santana und löste die Fesseln.
»Du …«, begann Ashton.
»Ich weiß, ich sabbere«, unterbrach ich ihn. Seine unverblümte Art, die peinlichsten Dinge offen auszusprechen, war mir wieder nur zu gut vertraut. Ich hievte mich mühsam in eine aufrechte Position und wischte mir verlegen über die Mundwinkel. »Verbring du mal ein paar Stunden mit einem Knebel zwischen den Zähnen.«
Nachdem ich mir sicher war, nicht mehr wie ein tollwütiger Werwolf mit Schaum vor dem Maul auszusehen, schaute ich zu Ashton auf. Die Art, wie er sanft lächelte, wie er mich anschaute, so durchdringend und einnehmend, verschlug mir den Atem. Selbst mit den rosa Hello-Kitty-Kopfhörern um den Hals, die bei vielen anderen lächerlich ausgesehen hätten, wirkte er einfach nur zum Anbeißen. Ich wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Allerdings waren zwei Monate vergangen. Zwei Monate, in denen alles Mögliche passiert sein konnte. Vielleicht bereute er unseren Kuss sogar. Ich hätte das gut verstehen können, weil er … nun ja, er war. Und ich nun mal ich.
»Cedric!«, stieß ich erneut aus, um wieder einen klaren Kopf zu gewinnen. Ich schaute zu Santana. Keine Ahnung, was sie und Ashton zusammengeführt hatte und wie sie auf meine Spur gekommen waren, aber sie mussten wissen, was in den Katakomben passiert war. »Er war dort unten eingesperrt. Unter unserem Familienanwesen«, erklärte ich.
»Wer?«, fragte Ashton.
»Du fängst am besten ganz von vorne an«, schlug Santana vor.
Ich atmete tief durch. »Nachdem wir telefoniert haben, war ich in der Gruft. Erinnerst du dich an das Klopfgeräusch?«
»Nein, keine Ahnung«, gab sie zu. »Du meinst die Katakomben, in denen wir das schwarze Grimoire gefunden haben?«
»Genau! Ich bin dem Geräusch nach, habe eine Geheimtür entdeckt und dahinter war Cedric gefangen.«
»Was?«, stieß Santana fassungslos aus.
»Das kann unmöglich sein. Er wurde verhaftet«, meinte Ashton.
»Eben nicht!«, widersprach ich. »Der Cedric, der uns umbringen wollte, war ein anderer. Ein Klon oder so. Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls nicht mein Bruder. Er … er muss schon eine ganze Weile dort festgesessen haben und jetzt sind zwei Monate vergangen!« Mein Inneres zog sich zusammen. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, was in der Zwischenzeit mit ihm passiert war. Mir wurde ganz anders, ich hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren und schwankte leicht.
»Wir sollten uns setzen«, schlug Ashton vor.
»Gute Idee«, sagte Santana und deutete auf einen kleinen Tisch in einer Ecke des Hotelzimmers. Darauf lag eine Supermarkttüte mit Chips, Pepsidosen und ungesundem Süßkram.
Santana ging zum Tisch, Ashton wollte ihr folgen, doch ich hielt ihn am Arm auf, weil ich den Moment nutzen wollte, ihm etwas zu sagen, ohne dass Santana zuhörte. Fragend schaute er mich an.
Für mich war das Thema unheimlich beschämend, was man mir wahrscheinlich ansah, denn meine Ohrläppchen fühlten sich plötzlich ganz heiß an und leuchteten wahrscheinlich so rot wie Bremslichter.
»Du …«, begann ich und schaute zu Boden, weil es mir nicht gelang, ihn direkt anzuschauen. »Du musst mich nicht … am Arsch lecken.«
Wo war das nächste Loch, in das ich kopfüber springen konnte? Nie im Leben hätte ich geglaubt, mal gezwungen zu sein, so etwas zu einem Jungen zu sagen. Und dann auch noch zu ihm!
Ashton schwieg, also hob ich den Blick. Er wirkte ernst und musterte mich ausgiebig. Was hätte ich denn tun sollen? Genau das hatte ich durch den Knebel zu ihm gesagt. Ich konnte das doch nicht ignorieren und darauf hoffen, dass ihm das ebenfalls gelang. Im schlimmsten Fall wäre ihm irgendwann klar geworden, was meine genuschelten Worte zu bedeuten hatten, und er hätte mir die Hose heruntergezogen, um meinem Befehl Folge zu leisten. Schließlich musste er alles tun, was ich von ihm verlangte. Allein der Gedanke daran ließ die Hitze, die mir zu Kopf gestiegen war, noch einmal auflodern.
»Dann ist ja gut«, sagte er schlichtweg, zog sich die Kopfhörer vom Hals und warf sie aufs Bett. »Das sind … Santanas. Noise Cancelling, damit ich dich nicht hören kann. Du weißt schon …«
»Ja, das habe ich mir gedacht.« Es war seltsam, wie angespannt die Stimmung zwischen uns war, was mich in meiner Vermutung bestärkte, dass er den Kuss von damals bereute. Was hatte er in Venedig zu mir gesagt? Dass er mich ganz nett fand? Jemanden, den man nett findet, küsst man nicht. Es sei denn, einem rauscht gerade eine Wagenladung Adrenalin durch die Adern. Ich wollte ihn darauf ansprechen, fand aber nicht die richtigen Worte.
»Kommt ihr?«, fragte Santana.
»Klar!« Ich war erleichtert, dass sie mich erlöst hatte und ging zum Tisch. Ashton brachte den Stuhl mit, auf dem sie mich gefesselt hatten, und setzte sich zu uns.
»Falls du Hunger hast.« Santana deutete mit einem Kopfnicken zur Supermarktausbeute, die ein bisschen nach dem Einkauf eines Kindes aussah, das zwanzig Dollar auf der Straße gefunden hatte. »Ashton ist auf der Fahrt hierher kurz in einen Laden gesprungen und … na ja …« Ihr Blick huschte über den Haufen bunter Schokoriegel, Cookies und Lollys, dann beugte sie sich zu mir vor. »Ich glaube, er ist nicht sehr häufig in der Außenwelt unterwegs.«
Ich schmunzelte, nahm mir einen Oreokeks, war aber zu aufgewühlt, um ernsthaft ans Essen denken zu können. Also hielt ich ihn nur in der Hand und starrte auf den Tisch. Meine Angst um Cedric war riesig. Er könnte längst tot sein oder schrecklich leiden, während ich in diesem Hotelzimmer saß und Kekse naschte.
»Okay, die Kurzfassung«, begann Santana und öffnete eine Dose JellyBelly. »Nachdem meine Mom mein Handy eingestrichen hatte, weil ich pausenlos versucht habe, dich zu erreichen, bin ich zu deinen Leuten und habe erfahren, dass ein paar Wächter aufgetaucht sind, um das Urteil des Tribunals zu vollstrecken. Zur Strafe für das Wirken eines verbotenen Zaubers haben sie dein Gedächtnis gelöscht und dich fortgeschickt.«
»Das ist totaler Schwachsinn!«, stieß ich aus. »Ich war gerade dabei, Cedric zu befreien, als mich jemand von hinten niedergeschlagen hat. Das waren bestimmt keine Wächter, und wenn, dann stecken die in der Sache mit drin.«
Ob Seth Cardeles, der uns und den Cedric-Doppelgänger verhaftet hatte, mit der Bruderschaft der Offenbarung unter einer Decke steckte? Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Er schien es mit den Gesetzen der Zwischenwelt peinlich genau zu nehmen. Jemand wie er arbeitete nicht mit einem verschwörerischen Geheimbund zusammen.
»Mir kam das auch merkwürdig vor«, meinte Santana. »Du hättest das nicht mit dir machen lassen, ohne dich wenigstens von mir zu verabschieden. Als deine Familie vorhatte, dir dein Gedächtnis zu nehmen, bist du auch zu mir gekommen. Und das mitten in der Nacht. Deswegen habe ich Ashton aufgesucht. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte.«
»Sie wollten mich hierherschicken«, meinte ich nachdenklich. »Nach Florida, zu den Turners. Es war Tante Sophias Vorschlag! Steckt sie etwa hinter allem?«
»Zuzutrauen wäre es ihr«, meinte Santana.
»Jedenfalls ist die Bruderschaft noch aktiv«, sagte Ashton. »Dieser Schmugglerring war nur die Spitze des Eisbergs und es muss einen Grund dafür geben, dass sie dich und offenbar auch Cedric am Leben gelassen haben.«
»Während sie keine Probleme damit hatten, Ashton zu töten«, ergänzte Santana. »Das spricht doch eigentlich auch dafür, dass Sophia diese Bruderschaft anführt. Immerhin ist sie eine Seymour. Da fällt es ihr bestimmt nicht leicht, ein Familienmitglied zu ermorden.«
»Na ja, sie hatte zuerst vor, mich umzubringen, um Ashton zu töten. So unheimlich schwer kann es ihr also auch nicht fallen.«
Ashton verengte den Blick. »Wenn wirklich sie die Anführerin der Bruderschaft ist und nicht Cedric, wie wir bisher geglaubt haben, steckt sie vielleicht auch hinter den ominösen Todesfällen, die damals die Schwestern der Schatten heimgesucht haben.«
»Welche Todesfälle? Und welche Schwestern?«, hakte ich nach.
»Wusstest du das nicht?«, fragte Santana erstaunt. »Das ist Sophias Hexenzirkel gewesen, der sie wegen ihrer Hochzeit mit deinem Onkel rausgeschmissen hat. Danach sind die Schwestern komplett ausgestorben. Sie wurden alle von seltsamen Unfällen oder Krankheiten heimgesucht. Das zog sich über Jahre hin, weswegen es unter uns Hexen zwar immer noch viele Gerüchte gibt, aber niemand wirklich an einen Zusammenhang glauben will.«
»Und statt der Schwesternschaft der Schatten führt sie jetzt die Bruderschaft der Offenbarung an?« Mir wollte das nicht wirklich in den Kopf gehen. Sophia war mir nie sympathisch gewesen, aber dass sie einen ganzen Hexenzirkel ausgerottet haben soll? Andererseits hatte sie auch kein Problem mit Ashtons Tod gehabt. Im Gegenteil. Sie war ganz heiß darauf gewesen, sein Ableben für sich zu nutzen. Bei dem Gedanken ging mir ein Licht auf.