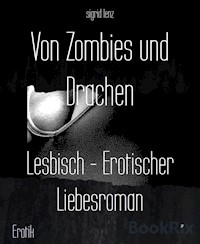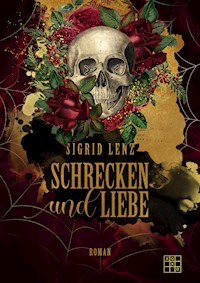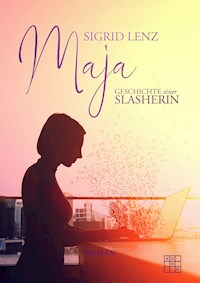Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vier Frauen werden mit einem Verbrechen in der Nachbarschaft konfrontiert. Jede von ihnen hat eine Vergangenheit als Anorexie-Patientin. Bei jeder von ihnen hat sich die Krankheit anders entwickelt, keine konnte sie vollständig überwinden. Gemeinschaft sieht sich einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt. Steigende Zweifel kollidieren mit unerwarteten Ereignissen. Die Situation verschärft sich, als die wahren Täter Verdacht schöpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sigrid Lenz
Emma – Frauen-WG mit Gepäck
Krimi
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-095-8
E-Book-ISBN: 978-3-96752-595-3
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Satz: XOXO Verlag
unter Verwendung der Bilder:
Stockfoto-Nummer: 508771171
von www.shutterstock.com
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1
Ich habe einen Mord gesehen, und zwar nicht den langsamen, unaufhaltsamen Selbstmord, dem sich Frauen und Männer, die unter dieser unseligen Krankheit leiden, verschrieben haben, sondern den Mord an einem nahestehenden Menschen. Eine Tat, weitaus unverständlicher und von größerer Verzweiflung geprägt, als jemand, der sich Zeit seines Lebens hauptsächlich mit seinen ureigensten Angelegenheiten beschäftigt hat, jemals in der Lage wäre zu verstehen.
Da die absurden Dinge zu grausam sind, als dass eine einzige Person sie schildern könnte, ziehe ich es vor, als Beobachter im Hintergrund zu stehen und den Schauplatz einigen mehr oder weniger aktiven Figuren zu überlassen, die mit Unglauben, aber auch mit Verständnis auf das Geschehen reagieren, das ihr Leben direkt oder indirekt, aber in jedem Falle nachhaltig verändern wird.
Alles begann an einem ruhigen Abend im Spätsommer. Niemand konnte die Turbulenzen erahnen, die allein durch den bevorstehenden Wechsel der Jahreszeiten, die herbstlichen Stürme, die sich ankündigten, aber dennoch aus einem unersichtlichen Grund weigerten loszubrechen, ausgelöst wurden.
September war es, und unsere Hauptperson verbrachte das Tagesende wie gewohnt, allein, wenn auch nicht gerade einsam, in ihrem Refugium, das der wohlmeinende Betrachter von außerhalb noch am ehesten als Dachwohnung bezeichnete.
»Wie ein funkelnder Stern, der in einem rotgoldenen Meer versinkt«, dachte Emma, während sie ihr Glas gegen die Sonne hielt, die ihre letzten Strahlen durch die schmalen Ritze der Rollläden aufblitzen ließ.
Schon seit langem wusste sie, dass dieses Funkeln die einzige Lichtquelle in ihrem Leben verkörperte, die ihr noch geblieben war. Sie schloss langsam die Augen, und ihre Lippen empfingen den samtenen Geschmack des Weines. Doch das warme Gefühl, das normalerweise bei diesen ersten Schlucken nach einer halbwegs trockenen Phase der Arbeit in ihr aufstieg, blieb an diesem Tag aus.
Es war die Sache mit der Vorahnung.
Im Grunde glaubte Emma nicht an Hellseherei oder an all die anderen möglichen Manifestationen des Übersinnlichen - aber ob sie nun dem Einfluss der Gestirne, den weiblichen Hormonen oder dem Wechsel der Jahreszeiten unterlag – eines ließ sich nicht leugnen. Jeden Monat um die Zeit des Vollmonds tauchten tief aus ihrer Seele diese verrückten Bilder auf, diese undeutlichen Erscheinungen, mit denen sie, meistens, nicht das Geringste anzufangen wusste.
Nur ein einziges Mal hatte sie es gewusst. Dieses eine Mal war sie sich sicher gewesen, dass etwas geschehen werde, etwas, wovor sie sich unbändig fürchtete.
Der Geruch von Tod lag damals in der Luft -- so einfältig diese Phrase auch klingen mochte.
Und nun war es wieder so weit.
Der schwere Duft der Spätsommerblüten, die dem zu Ende gehenden Sommer den letzten Glanz schenkten, der Nebel in den frühen Morgenstunden und die Dunkelheit, die sich von Nacht zu Nacht um früheres Hereinbrechen bemühte, das alles erschien ihr wie damals, zu der Zeit, als Mutter ihren letzten Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Eine Gefangene war sie gewesen, im Dunst dieser sterbenden Welt, und nicht nur für sie hatte das Herabfallen der letzten Blätter das Ende ihres Daseins, wie es sich bislang darstellte, bedeutet. Der Vater war ihrer Mutter innerhalb nur weniger Wochen gefolgt, und hatte sie, 29-jährig, und eigentlich – so sollte man glauben – auch erwachsen, zurückgelassen.
Das war nun drei Jahre her und hatte selbstverständlich, so versuchte sie sich selbstkritisch zu überzeugen, nicht das Geringste mit Vorahnungen zu tun.
Aber trotzdem hätte sie schwören können, dass es dieselbe Stimmung war, die sie gefangen hielt, dieselbe Angst, dieselbe Überzeugung – das Wissen, dass der Tod gegenwärtig war. Sie stellte ihr Glas ab und starrte auf die gegenüberliegende Wand ihres Dachzimmers, deren Anstrich im Widerschein des laufenden Fernsehers bläulich flackerte. »Unsinn«, sagte sie zu sich selbst. »Nun hast du dir wirklich langsam den letzten Rest deines Verstandes aus dem Hirn gesoffen. Es wäre ja nun auch wirklich eine tolle Entschuldigung für mein verkorkstes Leben, wenn ich als Wahrsagerin auftreten könnte, und am besten auch noch nette Unterhaltungen mit Verstorbenen führte, die mir dann erzählen könnten, wer als nächstes abberufen wird.«
Sie presste ihre Lippen aufeinander und versuchte, das Unwohlsein, das sich ihrer bemächtigte, aus ihren düsteren Gedanken zu verbannen. Natürlich funktionierte es nicht, das hatte es noch nie.
Der einzige für sie begehbare Weg bestand seit langer Zeit in der absoluten, kompromisslosen Verdrängung. Und ihm folgte sie entschieden und konsequent, auch bis zum bitteren Ende.
Unten klappten Türen. Laute Stimmen klangen herauf. Aus reiner Gewohnheit holte Emma den Kopfhörer hervor, doch im letzten Moment stockte sie und lauschte. Unüberhörbar, wie immer, die Stimme des kleinen Freddy, des Sohnes von Motte, ihrer ältesten Freundin. So leise und zurückhaltend, wie die anderen in der Regel waren, so munter und selbstbewusst drängelte er sich zumeist in den Vordergrund. Und in diesem Augenblick protestierte er lautstark. Wahrscheinlich hatte den Kleinen wieder niemand zum Mittagsschlaf überreden können, und nun kämpfte er mühsam darum, auch weiterhin wach bleiben zu dürfen.
»Sei lieb, Schätzchen«, erklang die Stimme von Motte, der gestressten Mutter, mittlerweile bereits leicht gereizt. »Jetzt isst du noch schnell dein Brot und dann bist du sicher so müde, dass du gleich einschläfst.«
»Nein, Käse haben, nur Käse«, quengelte Freddy ungebrochen weiter.«
»Da hast du deinen Käse, mein Süßer.«
‚Natürlich‘, dachte Emma, als sie den vertrauten Klang identifizierte. Natascha, das zweitjüngste Mitglied ihrer fünfköpfigen Wohngemeinschaft, gab dem Kleinen immer nach. Da konnte das unvermeidliche Donnerwetter nicht mehr lange auf sich warten lassen.
»Musst du ihm den Käse immer ohne Brot geben«, schimpfte Motte wie erwartet los.
»Jetzt isst er doch nichts Vernünftiges mehr, und ich stehe wieder als Rabenmutter da, die ihr Kind nicht anständig ernähren kann.«
»Lass ihn doch«, versuchte die Dritte im Bunde, Nataschas ältere Schwester, Caro, zu beschwichtigen. »Meist wissen Kinder ganz gut, was sie brauchen.«
»Na, du hast die Weisheit gepachtet«, fuhr Motte sie an und warf einen langen Blick über Caros knochige Gestalt.
Das genügte für die so kritisch Begutachtete, um sich aus dem Gespräch zurückzuziehen und sich ganz dem Auspressen einer Zitrone zu widmen, die mit einem Glas Wasser und etwas Süßstoff ihre komplette Abendmahlzeit darstellte.
Ihre Schwester Natascha dagegen klapperte beim Vorbereiten des Salates kräftig mit Geschirr und Besteck, und versuchte zwischendurch Freddy kleine Stückchen Tomate zuzustecken. Dabei blickte sie immer wieder verstohlen zu Motte hinüber, in der Hoffnung, dass diese ihre Wiedergutmachungsversuche bemerken würde. Motte ließ sich auf einen Stuhl fallen und winkte müde ab.
»Das hat keinen Sinn mehr. Entweder du gibst ihm das Gemüse zuerst, oder er rührt es nicht mehr an.«
Sie seufzte. »Tut mir leid, Leute. Ich schätze, ich brauche mal eine Pause.«
Sie fuhr sich durch die kurzen, blonden Haare und setzte leise hinzu.
»Manchmal fühle ich mich dem Kleinen einfach nicht gewachsen.«
»Ach was.« Natascha hob Freddy in die Luft, während dieser noch zufrieden an seinem Käse knabberte und wirbelte ihn herum, dass er vor Vergnügen jauchzte.
»Käse enthält Calcium. Jetzt brauchst du dir wenigstens um seine Knochen keine Sorgen zu machen.«
»Pass auf, dass er sich nicht verschluckt.« Motte fing den Kleinen auf und strich ihm durch die schwarzen Locken.
»Quatsch, der ist clever!« Damit warf Natascha ihre langen, kastanienbraunen Haare zurück und machte sich am Radiosender zu schaffen. »Überall nur Werbung oder Nachrichten, ist ja nicht auszuhalten«, schmollte sie.
»Süße 17 sollte man eben nochmal sein«, bemerkte Motte zu Caro, die an ihrem Zitronenwasser nippte. Endlich lächelte auch diese wieder.
»Nicht für alles Geld der Welt«, erwiderte sie und strich Freddy über die goldbraunen Wangen. »Auch so alt, besser gesagt jung, wie der Süße hier, möchte ich nicht mehr sein. Dieser irrsinnige Druck, unter dem heute schon die Allerkleinsten stehen. Da wird bereits in der Krabbelgruppe gefördert und ausgesondert, dass einen das kalte Grausen überkommen kann.«
Sie legte den Kopf schief. »Allerdings glaube ich, dass dieser Kandidat hier für heute genug hat. Er kann die Augen ja kaum noch offen halten.«
»Das tut er doch nur, um sich wieder ums Zähneputzen schummeln zu können«, jammerte Motte, während sie den Kleinen hochnahm und vorsichtig die Treppe hinauf trug.
»Ich geh dann auch auf mein Zimmer«, sagte Caro zu Natascha und nahm ihr Glas.
»Für morgen muss ich noch eine Ernährungsberatung vorbereiten. Ausgerechnet Pankreatektomie. OPs an der Bauchspeicheldrüse kommen bei uns fast nie vor. Die werden alle in Kliniken geschickt, die besser ausgestattet sind. Schon in der Schule bin ich damit immer durcheinander gekommen.«
»Wurden Kopf oder Schwanz des Organs entfernt?«, erkundigte sich Natascha interessiert. »Dann musst du vielleicht einen Diabetes beachten.«
»Ich weiß, ich weiß!«, knurrte Caro. »Dieses ganze Elend hängt mir so richtig zum Hals heraus. Den ganzen Tag nur Kranke, denen du doch nicht helfen kannst. Im Gegenteil. Du machst alles nur noch schlimmer, indem du ihnen die Sachen verbietest, die sie gerne zum Trost naschen würden.«
Sie rückte ihre schmale Brille gerade und sah auf.
»Entschuldige bitte, Natascha. Ich wollte dir wirklich nicht deine Ausbildung vermiesen. Mir geht es einfach im Augenblick nicht so besonders.«
»Schon gut«, antwortete ihre Schwester. »Ich weiß ja bereits, dass es kein Zuckerschlecken ist. Und das Praktikum im Krankenhaus hat auch überhaupt nichts von dem, was ich mir erträumt habe. Keine schnuckeligen Oberärzte weit und breit. Aber am Ende haben wir doch eine schöne Arbeit, die auch irgendwie ihren Sinn hat. Ich meine, Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, während sie gesund werden, und dann auch noch dafür zu sorgen, dass sie es auch bleiben – das ist doch toll.«
Caro schüttelte ihren rotblonden Pagenkopf. »Das ist ja auch gut, wenn du das glauben kannst. Ansonsten wären die ganzen Umstände, der Ortswechsel, der Umzug von Nürnberg, die Trennung von Mama und Paps und der Eintritt in unser merkwürdiges Frauengespann nicht unbedingt sinnvoll gewesen.«
»Du weißt genau, dass ich es bei ihnen nicht mehr aushalten konnte, genau so wenig wie du. Und warum sollte ich nicht von der besten Diätassistentin, die ich kenne, alles lernen, was nötig ist, um einen ebenso fabelhaften Abschluss hinzulegen?«
Caro lachte. »Bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau hinunter. Du bist immerhin erst ein knappes Jahr dabei. Zu meiner Zeit waren wir da schon in der Halbzeit, aber seit die Ausbildung verlängert worden ist, wird der Spaß nun erst richtig losgehen.«
»Ich werde das schon auf die Reihe kriegen«, versprach Natascha und blickte aus dem Fenster. »Diese dumme Krankheit habe ich schließlich auch im Griff.«
Caro lächelte sie an. »Ich weiß, du führst Tagebuch über die tägliche Kalorienzufuhr und gehst in jeder freien Minute joggen.«
Natascha warf ihre Haare zurück. »Na und? Das ist immerhin eine astreine Möglichkeit. Jetzt halte ich mein Gewicht, bekomme wieder meine Tage, und…«, sie sah vielsagend in Caros Richtung, »ich lebe auch nicht von Zitronenwasser.«
Caro wechselte peinlich berührt das Thema. »Lassen wir es gut sein. Durchs Reden wird auch nichts besser.«
»Ich weiß schon«, beeilte Natascha sich einzuwerfen. »Ihr redet nicht mehr über die Anorexie. Das war ein vergeblicher Therapieversuch zu viel, und deshalb habt ihr euch entschlossen, aus dem Thema ein Tabu zu machen.«
»Es geht doch nur darum, dass jede sich ihr Leben nach ihrem ureigensten Gusto einrichten kann, ohne dass ihr ständig die Hölle heiß gemacht wird«, erklang Mottes Stimme vom Treppenabsatz.
Freddys sandige Jeans in den Händen kam sie die letzten Stufen herab.
»Glaub mir, Natascha, so ist es am besten. Emma und ich kennen uns schon seit einer halben Ewigkeit, und wir haben seit unserem Krankenhausaufenthalt wirklich so ziemlich alles an Selbsthilfegruppen, Seminaren und Kursen versucht, um diese vermaledeite Essstörung loszuwerden. Ganz zu schweigen von den zahllosen Büchern, Filmen und Erfahrungsberichten zu diesem Thema. Und du siehst, wir stehen immer noch am Anfang. Nur, dass alles mittlerweile so kompliziert geworden ist, dass wir nicht anders konnten, als uns auszuklinken.«
»Man muss abwarten können«, warf Caro ein und erhob sich. »Entweder die Sache regelt sich früher oder später von selbst, oder du gehst daran kaputt, auf welche Weise auch immer.«
Natascha blickte nach oben. Sie lauschte auf den schwachen Laut knarzender Dielen.
»Unsere Lehrerin in der Berufsfachschule für Ernährungsmedizin hat gesagt, dass ein magersüchtiger Mensch vergleichbar sei mit einem Haus, dessen Fassade von klaffenden Rissen durchzogen ist. Du kannst sie kitten, übertünchen, überpinseln, versuchen, was auch immer du möchtest, diese Risse kommen doch immer wieder zum Vorschein.«
»Sehr aufbauend«, meinte Motte trocken. »Aber das ist doch alles gar nichts gegen das schier unlösbare Problem, eine Spielplatz-Jeans zu waschen, ohne die Waschküche dabei in einen Sandkasten zu verwandeln. Hat einer von euch noch Buntwäsche?«
Natascha und Caro schüttelten die Köpfe und sahen zu, wie Motte leise vor sich hin pfeifend in ihrer engen Stretch-Hose die Kellertreppe hinunter stakste.
»Übrigens – das wollte ich dir schon sagen, seit du hierher gezogen bist…« Caro stockte, wobei Natascha sie skeptisch anblickte.
»Ich glaube, dass du von uns Vieren die Einzige bist, die eine wirkliche Chance hat, diese Sache endgültig abzuhandeln. Und das nicht nur, weil du um so vieles jünger bist als wir. Dein Fehlverhalten hatte daher noch nicht die Zeit und Gelegenheit, sich gründlich zu manifestieren.«
Natascha sah verlegen zu Boden und wartete, bis Caro fortfuhr.
»Ich weiß, dass du das nicht glauben kannst, oder willst – aber ich glaube doch, dass du in Vielem versuchst, mich nachzuahmen, ohne dir dessen bewusst zu sein. Vielleicht, weil ich so früh von zu Hause wegging, und Mama und Paps dir Gott-weiß-was über mich erzählt haben…«
Sie ging ein paar Schritte auf und ab. »Aber vor allem ist es doch so, dass laufend neue Möglichkeiten zur Behandlung ausgedacht und erprobt werden. Erkenntnisse ändern sich ständig, und du bist in der Lage, sie zu deinem Vorteil zu nutzen.«
Sie lächelte ein wenig bitter.
»Wenn ich daran denke, was man mir so alles versucht hat weiszumachen. Fängt schon mit der Hauptschuld der Mutter als allem Übel an. Gottlob hast du das noch nicht mitbekommen, aber ich glaube, dass der unterschwellige Vorwurf war, der jeden Ansatz einer Familientherapie durchzog, was Mama mir nie verzeihen konnte.«
Caro lachte trocken. »Und jetzt heißt es, das wäre alles Unsinn, am Verhalten der Mutter liegt natürlich nicht das Geringste, zumindest nicht mehr, als an allem Anderen. Sie sei lediglich in der Beschützer-Rolle besonders gefragt.«
Caro drehte sich noch einmal zu Natascha um. »Als Frau bist du eben so oder so die Leidtragende. Aber von nun an lässt du das Thema bitte ruhen, mach das für dich aus. Jede muss für sich allein entscheiden, ob sie hungern will, sich vollstopfen, oder ob sie sich in Einsamkeit und Alkohol flüchtet.«
Zwei Stockwerke höher legte Emma ihren Kopfhörer beiseite. Als das Gespräch in der Essecke begann, eine ernsthaftere Richtung einzuschlagen, hatte sie entschlossen ihren Schutz vor dem Lärm der auch durch Mauern und Fußböden dringenden Wirklichkeit aufgesetzt, und das Gespräch unter Schwestern und Freundinnen durch bellende Filmmusik und hanebüchene Dialoge ersetzt.
Sicher, der Alkohol mochte vielleicht nicht mehr seine ausreichend notwendige Wirkung entfalten, aber das Vorabendprogramm bot Trost und Hilfe und auf volle Lautstärke aufgedreht, auch die ersehnte Ablenkung. Über lange Jahre gesammelte Erfahrungen hatten gezeigt, dass amerikanische Krimi-Serien das beste Rezept gegen Übel aller Art darstellten, und die Tatsache, das diese mittlerweile auch im Vorabendprogramm liefen, war nichts anderes als ein Wink des Himmels. Auf jeden Fall in Emmas Augen.
Magnum oder Simon&Simon boten ausreichend ohrenbetäubende Action, gepaart mit komischen Situationen, die natürlich nach ein paar Gläsern hochprozentiger Flüssigkeit noch komischer waren.
Unterstützt von derart aufbauenden Gedanken, schlurfte sie zu dem kleinen Schränkchen neben dem Bett, in dem sich ihre bevorzugte und hauptsächliche Nahrungsquelle befand. Emma musste sich ein wenig bücken, da beide Möbelstücke in die Dachschräge eingebettet waren. Eine dunkle und mit Ornamenten verzierte Tür gab quietschend nach und erinnerte Emma daran – so wie buchstäblich jeden Tag von Neuem – dass es allerhöchste Zeit war, sich darum zu kümmern.
Sie schob das Schloss mit dem Ellbogen wieder zu, hielt in ihren Händen ein großes Glas und eine Flasche Wodka. Beim Einschenken wunderte Emma sich, dass es ihr noch nie aufgefallen war, wie vollkommen die Holzverkleidung mit der Einrichtung harmonierte. Ihre Eltern mussten das ganze Haus mit derselben, oder zumindest mit ähnlichen Holzsorten ausgestattet haben – und sie hatte sich nie zuvor Gedanken über diese Tatsache gemacht.
Der Wodka brannte in ihrem Hals, als eine Welle der Rührung Emma übermannte. Mit Tränen in den Augen, die allerdings auch ohne weiteres von dem Genuss der hochprozentigen Flüssigkeit ausgelöst wurden, strich sie über den dunklen Fensterrahmen, während sie die wilde Verfolgungsjagd, der sich die Detektive hingaben, nur über Kopfhörer, aber dafür doppelt so laut, wahrnahm.
Dafür, dass die Eltern ihr das Haus vererbt hatten, verzieh sie ihnen allerhand, wenn auch lange nicht alles.
Das Haus war ihr Auffangbecken, ihr Nest. Ihre Eltern hatten im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, ihr das Leben, das von Anfang an zu schwierig war, zu erleichtern. Und nun waren die Freundinnen da, oder eher die Schicksalsgenossinnen.
Eigentlich war es eine brillante Idee, Caro und Motte spontan zu bitten, bei ihr einzuziehen. So konnten sie gemeinsam das Haus in Schuss halten und sich nebenbei ein wenig gegenseitig betreuen.
Emma zog kurz entschlossen den Rollladen ein Stück in die Höhe und öffnete das Fenster einen Spalt. Der Himmel war eben dabei, sich zu verdunkeln und die Straßenlaternen warfen bereits ihr kaltes Licht in den verwilderten Garten. Durch die Baumwipfel hindurch sah sie die kleine Stadtvilla der Jagdbachs. Es war ihr, als käme ein schwüler Wind, der den Geruch von faulenden Früchten und Blüten mit sich trug, aus dieser Richtung.
Sie schauderte und schloss hastig wieder das Fenster, ein weiteres Mal bestätigt in ihrer Überzeugung, dass es gesünder und weitaus sicherer sei, dieses verriegelt zu belassen. Sie blickte in die Höhe und beobachtete, wie der Mond hinter einer Wolke hervorkam. Er leuchtete fahl und unheilverkündend in der Dunkelheit.
In dieser Nacht schlief Emma schlecht. Der Wodka brannte und trieb ihr noch immer die Tränen in die Augen, aber er half nicht. Um vier Uhr am Morgen endlich erwachte sie aus einem leichten Halbschlaf und warf die Bettdecke zur Seite.
Der Mond tauchte die Welt in ein milchiges Licht. Emma erhob sich, blickte in den Spiegel und glaubte für einen Moment diesen Mond, auf ihrem eigenen Hals sitzend, wieder zu entdecken.
Ein rundes, kalkweißes Gesicht, umrahmt von strähnigen, graubraunen Haaren, die ungewaschen herabhingen.
‚Zweiunddreißig Jahre alt und schon grau‘, dachte sie bitter. ‚Das kommt auch nur von den vielen Sorgen, die allesamt völlig unnötig sind.«
Ihr Schädel brummte, und sie half ihm erst einmal mit einem guten Schuss Gin in ein wenig Orangensaft.
Danach schlüpfte Emma in ihre dunkelgraue Jersey-Hose und ein schwarzes Sweatshirt, worauf sie leise die Treppe hinunter schlich.
Zu oft schon war es ihr passiert, dass die knarzenden Stufen den kleinen Freddy geweckt hatten, eine Tatsache, über die Motte sich regelmäßig alles andere als erfreut zeigte. Also gab Emma sich alle Mühe, ein Mäuschen zu sein, während sie, wie jeden Morgen, den Kaffee vorbereitete, den großen Tisch möglichst ohne Klappern deckte und ihn liebevoll mit Servietten und Blumen dekorierte.
Gerade nahm Emma den letzten Schluck ihres Frühstücks aus dem Glas zu sich, da vermeinte sie, draußen Stimmen zu hören.
Emmas Herz pochte, und sie hätte beinahe die Vase fallen lassen, aus der sie eben die verblühten Astern aussortierte.
Noch nie hatte jemand, zumindest, soweit sie sich erinnern konnte, in diesem ruhigen Ort, den frühmorgendlichen Frieden gestört. Normalerweise gehörten die Stunden ihr allein, und sie liebte es, in der Stille zu wirken, den Bewohnern ihres Hauses eine Mahlzeit, die einzige Mahlzeit, die sie alle zusammen einnahmen, zu bereiten.
Emma sah auf die bunte Küchenuhr an der Wand. Es war noch nicht einmal fünf Uhr, aber die Stimmen waren noch nicht verklungen.
Einen Moment lang kämpfte sie mit sich, aber die Gewissheit, dass die hohen Bäume des alten Gartens sie zu schützen vermochten, gab ihr Mut. Und so nahm sie den Obstkorb und wollte, wie an jedem Morgen im Herbst, die späten Äpfel von dem knorrigen Apfelbaum pflücken, an dessen Pflanzung sie sich noch erinnern konnte.
»In aller Herrgottsfrühe solche Extrawünsche«, erklang es plötzlich nicht weit von ihr.
Emma fuhr zusammen, bis ihr klar wurde, dass es die Stimme ihrer Nachbarin, Frau Jagdbach, einer schlanken und attraktiven Frau Mitte Vierzig, sein musste, deren Mann vor knapp zwei Jahren das Zeitliche gesegnet hatte.
Emma erzitterte, aber sie erkannte, dass Jacqueline Jagdbach nicht sie gemeint haben konnte, sondern ihre zwanzigjährige Tochter Germaine, die seit einem furchtbaren Autounfall vor einem halben Jahr an den Rollstuhl gefesselt war, immer noch unter sehr starken Schmerzen litt und der ständigen Pflege ihrer Mutter bedurfte.
»Das gibt es doch nicht, dass du mich jetzt in die Apotheke schickst. Seit einer halben Sunde füttere, massiere und tröste ich. Und was ist mit mir? Ich habe überhaupt kein Leben mehr!«
Eine Autotür knallte und Frau Jagdbach fuhr mit quietschenden Reifen aus der Einfahrt.
Emma lauschte in die Stille hinein, ohne sich rühren zu können. Wie aus weiter Ferne ertönte ein leises Seufzen, ein Geräusch, fast wie ein Schluchzen. Sie bückte sich automatisch nach zwei herabgefallenen Äpfeln und ging leise zurück ins Haus. Emma fröstelte. Graue Nebelschwaden durchzogen den Garten und verwandelten ihn in eine Landschaft des Unwirklichen. Sie stellte den Obst -Korb, ohne sich weiter darum zu kümmern, auf den Tisch, ergriff ihr leeres Glas und ging damit hinauf in ihr Dachgeschoss.
Nachdem sie das Gefäß erneut gefüllt hatte, schloss sie die Tür zu dem anliegenden kleinen Zimmer auf, das ihr als Arbeitszimmer diente, und begann mit ihrer eintönigen Schreibarbeit.
Am frühen Morgen fiel es ihr immer noch am leichtesten, die endlosen Listen an Adressen, Warenbeständen oder auch für sie unverständlichen Buchstabenfolgen abzutippen, zu formatieren und auf die jeweils gewünschte Art auszudrucken. Eine stumpfsinnige und unbefriedigende Tätigkeit, aber dennoch eine Möglichkeit, ihre Zeit zu verbringen, und sich der Illusion hinzugeben, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, so klein und unbedeutend dieser auch aussähe.
Konzentriert arbeitete Emma durch, bis im Haus das Leben zu erwachen begann und damit die Zeit für eine erste Pause anbrach.