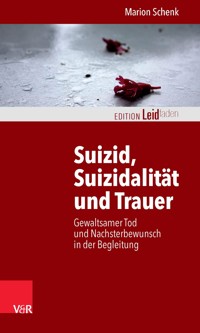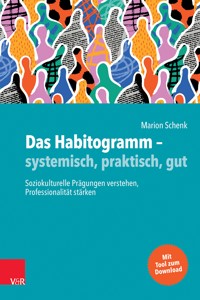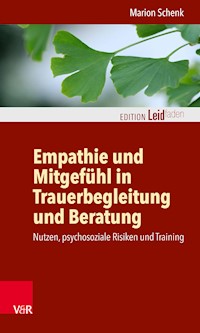
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition Leidfaden – Begleiten bei Krisen, Leid, Trauer
- Sprache: Deutsch
Trauerbegleitung und Beratung sind ohne Empathie und Mitgefühl undenkbar. Dennoch treffen Fachpersonen und ehrenamtlich Tätige immer wieder Situationen an, in denen Mitgefühl fehlt oder Empathie Mitleid auslöst. Um selbst psychisch und physisch gesund zu bleiben und andere dabei zu unterstützen, ist es nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, Möglichkeiten kennenzulernen, die angemessenes Mitgefühl fördern. Denn Mitleiden führt langfristig zu Überforderung im Gegensatz zu Mitgefühl, das nicht nur beim Gegenüber, sondern auch bei einem selbst angenehme Gefühle freisetzt. Theoretische Hintergründe zu Faktoren, die Mitgefühl einschränken und Mitleid erzeugen, sowie anschauliche Falldarstellungen aus der Praxis bilden die Basis, um die Kernkompetenz "angemessenes Mitgefühl" in sozialer Arbeit entwickeln zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDITION Leidfaden
Hrsg. von Monika Müller, Petra Rechenberg-Winter, Katharina Kautzsch, Michael Clausing
Die Buchreihe Edition Leidfaden – Begleiten bei Krisen, Leid, Trauer ist Teil des Programmschwerpunkts »Trauerbegleitung« bei Vandenhoeck & Ruprecht, in dessen Zentrum seit 2012 die Zeitschrift »Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer« steht. Die Edition bietet Grundlagen zu wichtigen Einzelthemen und Fragestellungen im (semi-)professionellen Umgang mit Trauernden.
Marion Schenk
Empathie und Mitgefühl in Trauerbegleitung und Beratung
Nutzen, psychosoziale Risiken und Training
Mit 10 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Bildnachweis: Abb. 1, 2, 4, 5 Schematische Darstellung © Marion Schenk; Abb. 3, 9 Originalfoto https://pixabay.com, Veränderung © Marion Schenk; Abb. 6, 7, 8, 10 Originalfoto © Marion Schenk
Umschlagabbildung: Eileen Kumpf/Shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2198-2856
ISBN 978-3-647-99457-4
Inhalt
IEinführung
IITheoretische Betrachtungen zu Empathie und Mitgefühl
1Grundlegende Abläufe und Zusammenhänge
1.1Reize und die Subjektivität menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns
1.2Reizantworten
1.2.1Empathie allgemein
1.2.2Facetten der Empathie
1.2.3Selbstempathie und Impathie
1.3Reaktionen auf Reizantworten
1.3.1Selbstmitleid und Mitleiden mit anderen
1.3.2Unbewusste Abwehrmechanismen und willentlichbewusste Abwehr
1.3.3Mitgefühl allgemein
1.3.4Selbstmitgefühl
1.3.5Mitgefühl mit anderen
1.3.6Prosoziales Verhalten
1.4Auswirkungen von Mitleid, Abwehr und Mitgefühl
1.5Wissenschaftliche Untersuchungen zu Empathie und Mitgefühl
1.5.1Neurophysiologische Unterschiede
1.5.2Biochemische Unterschiede
1.6Empathie und Mitgefühl als Reiz-Raum-Reaktions-Modell
2Mitgefühl im Kontext der Gesellschaft
2.1Gesellschaftlicher Stellenwert von Mitgefühl
2.2Mitgefühl in der Sozialwirtschaft
2.3Mitgefühl bei Krankheit, Sterben, Tod und Trauer
2.4Mitgefühl bei Suizidalität und Suizid
IIIEinflussfaktoren auf Qualität und Quantität von Mitgefühl und Auswirkungen fehlenden Mitgefühls
1Psychische und physische Verfassung
1.1Bedürfnisse
1.2Bindung und Beziehung
1.3Krankheit, Sterben, Tod und Trauer
1.4Emotionale und körperliche Überforderung
2Kognitive Haltung
2.1Erfahrungen, Sichtweisen, Einstellungen, Überzeugungen, Haltung sich selbst und anderen gegenüber
2.2Unwissenheit
3Psychische Störungen
3.1Depression
3.2Angststörung
3.3Persönlichkeitsstörungen
3.4Belastungsreaktionen sowie Belastungs- und Anpassungsstörungen
3.5Verhaltens- und Entwicklungsstörungen
3.6Abhängigkeits- und andere psychische Erkrankungen
4Suizidalität
5Abwehr als Schutzmechanismus
5.1Abwehrmechanismen
5.1.1Projektion
5.1.2Rationalisierung
5.1.3Regression
5.1.4Reaktionsbildung
5.1.5Verdrängung
5.1.6Verleugnung
5.1.7Verschiebung
5.1.8Übertragung und Gegenübertragung
5.2Kontaktstörungen
5.2.1Konfluenz
5.2.2Introjektion
5.2.3Deflexion
5.2.4Retroflexion
5.2.5Egotismus
6Antisoziales Verhalten
7Weitere Ursachen für fehlendes Mitgefühl
8Mitgefühl fördernde Faktoren
IVFalldarstellungen aus der Praxis zu Empathie und Mitgefühl
1Fälle aus Beratung und Trauerbegleitung, die Einflussfaktoren auf Mitgefühl zeigen
1.1Kinder waren nie eine Option – Teil A
1.2Michael hat keine Zeit – Teil A
1.3Sie liebt mich nicht mehr – Teil A
1.4Begleiten bis zum Ende und dann der Nächste – Teil A
1.5Stefanie hat sich nicht das Leben genommen – Teil A
1.6Ich halte das nicht mehr aus – Teil A
1.7Ich bin schuld – Teil A
1.8Ich habe so mit ihr gelitten – Teil A
1.9Ich will doch nur ihr Bestes – Teil A
1.10 Antisoziales Verhalten versus Mitgefühl
2Fälle aus Beratung und Trauerbegleitung, die zeigen, welche Interventionen Mitgefühl und prosoziales Verhalten fördern können
2.1Kinder waren nie eine Option – Teil B
2.2Michael hat keine Zeit – Teil B
2.3Sie liebt mich nicht mehr – Teil B
2.4Begleiten bis zum Ende und dann der Nächste – Teil B
2.5Stefanie hat sich nicht das Leben genommen – Teil B
2.6Ich halte das nicht mehr aus – Teil B
2.7Ich bin schuld – Teil B
2.8Ich habe so mit ihr gelitten – Teil B
2.9Ich will doch nur ihr Bestes – Teil B
VZusammenfassung
Literatur
I Einführung
Empathie und Mitgefühl in der sozialen Arbeit sind Fähigkeiten, die nicht nur Betreuten und Begleiteten zugutekommen. Angemessenes Mitgefühl stärkt auch das Miteinander in Teams und es trägt zur psychischen Stärkung von Beratern und Trauerbegleiterinnen bei. Wenn Menschen Mitgefühl in einer angemessenen Form zeigen können, werden sie sich langfristig nicht überfordern, weil sie weder mitleiden noch Abwehr entwickeln und entgegen ihrer Natur strikt auf Distanz gehen müssen. In diesem Band werden Fragen wie »Welches Maß an Mitgefühl ist angemessen?« und »Wie finde ich in der jeweiligen Situation eine adäquate Art und Weise, mitfühlend zu reagieren?« Antworten finden.
Empathie und Mitgefühl werden sowohl in der Literatur als auch im Alltag häufig synonym verwandt. In diesem Buch wird differenziert und es werden tendenzielle Unterschiede aufgezeigt. Insbesondere geht es um Faktoren, die Mitgefühl einschränken können; um verschiedene durch empathische Impulse ausgelöste Reaktionen und um ihre Wirkung auf Empfänger.
Dem österreichischen Psychologen Viktor Frankl (1905– 1997) wird ein Zitat zugeschrieben, welches Inhalt und Anliegen des Buches kurz und knapp verdeutlicht: »Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit«1. Er beschreibt mit Raum den begrenzten Moment, in dem äußere Reize zu einer Resonanz, einem Mitschwingen im Menschen führen. Durch Reizen aller Sinne entsteht neurophysiologisch Wahrnehmung, die in Verbindung und Wechselwirkung mit unbewussten mentalen, somatischen und emotionalen Impulsen Reaktionen auslöst. Weshalb dieser Raum im Rahmen empathischer Prozesse wichtig ist, werden die späteren Ausführungen zeigen.
Im theoretischen Teil werden Zusammenhänge und Wirkungsweisen verschiedener Reaktionen erläutert. Das Augenmerk wird unter anderem auf die unterschiedlichen Qualitäten von Mitfühlen und Mitleiden als Reaktionen gelegt. Aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse im Wechselspiel mit biochemischen Prozessen untermauern die vorgestellten Betrachtungen zu Empathie und Mitgefühl.
Im praktischen Teil ergänzen Falldarstellungen die theoretischen Ausführungen. Sie verdeutlichen Einflussfaktoren auf Wahrnehmen und Verarbeiten von Reizsignalen, wodurch die im jeweiligen Fall vorgestellten unterschiedlichen, individuell gefärbten empathischen Empfindungen und daraus resultierende Reaktionen verständlich werden. Konkrete Interventionen aus Trauerbegleitung und Beratung zeigen, wie angemessenes Mitgefühl für sich und andere entwickelt werden kann.
1In vielen Quellen wird das Zitat Viktor Frankl aufgrund seiner Erfahrungen während der Zeit als Häftling im KZ Auschwitz zugeschrieben. Es scheint aber, dass Frankl Gedanken aufgegriffen hat, die auf den persischen Mystiker Rumi (1207–1273) zurückgehen (Quelle: Südwestfunk, SWR 2, Sendung vom 01.12.2011: »Innere Freiheit oder Die Möglichkeit zwischen Reiz und Reaktion«, Autorin: P. Mallwitz. http://docplayer.org/33372995-Suedwestrundfunk-swr2-leben-manuskriptdienst-innere-freiheit-oder-die-moeglichkeiten-zwischen-reiz-und-reaktion.html – Zugriff am 17.05.2020).
II Theoretische Betrachtungen zu Empathie und Mitgefühl
1 Grundlegende Abläufe und Zusammenhänge
Für professionelle und ehrenamtliche Tätigkeiten in der sozialen Arbeit sind neben fachlicher Kompetenz auch Fähigkeiten im Gestalten zwischenmenschlicher Beziehungen von Bedeutung. Grundlage dafür ist, auf empathische Impulse hin adäquates Mitgefühl entwickeln zu können. Das Beleuchten dieses Teils beruflicher Kompetenz ist sinnvoll, da er einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Arbeit mit Menschen, aber auch auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden in Trauerbegleitung, Betreuung und Beratung hat.
Für Empathie und Mitgefühl werden in der Literatur unterschiedliche Betrachtungsweisen und Definitionen angeboten, die sich teilweise überschneiden und die irritieren können. Für eine Auseinandersetzung mit dem Thema und Umsetzung vorgestellter Maßnahmen in die Praxis ist es unerlässlich, gebräuchliche Begriffe zu konkretisieren und eine Spezifikation und Unterscheidung von Empathie und Mitgefühl vorzunehmen. Es stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung, die die im jeweiligen Abschnitt aufgegriffenen Beschreibungen strukturieren und Zusammenhänge visualisieren.
1.1 Reize und die Subjektivität menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns
Menschen reagieren auf innere und äußere Reize. Signale im Menschen, auf die er reagiert, können aufgrund von Erinnerungen aus der Vergangenheit, Gedanken in der Gegenwart, Emotionen und Körpersignalen entstehen. Auch aus seiner Umwelt, vor allem von anderen Personen, empfängt der Mensch Impulse, die er mit seinen Sinnen und durch Resonanz aufnimmt.
Menschen, ihr Denken, Handeln und Fühlen, werden in Kindheit und Jugend durch wichtige Bezugspersonen und deren Vorerfahrungen, Sichtweisen, Meinungen, Haltungen, Werte, Überzeugungen und andere unbewusste Maßstäbe geprägt. Die Art, wie Menschen auf Situationen reagieren, verändert die neuronale Struktur ihres Gehirns. Jedes Mal, wenn auf Umstände reagiert wird, wird auch die Wahrnehmung trainiert, in zukünftigen Situationen ähnlich zu empfinden und spätere Momente entsprechend zu erleben. Denken und Fühlen als Primärfunktionen des Gehirns beeinflussen bereits bestehende Hirnstrukturen und bilden die Grundlage für unbewusste kognitive und emotionale Muster. Tilgung und Generalisierung stellen dabei Programme dar, die diese Musterbildung im Sinn automatischer Abfolgen ermöglichen. Neue Signale aufgrund aktueller Situationen werden mit bereits abgespeicherten Erfahrungen abgeglichen und so verändert, dass die bestehende neuronale Vernetzung zu einem bestimmten Aspekt – beispielsweise Resonanz auf die Befindlichkeit anderer Menschen – erweitert werden kann. Dieses Lernen dient dazu, dass in ähnlichen Situationen entsprechende Verknüpfungen unbewusst aktiviert werden können. Diese Automatismen dienen der Optimierung sich wiederholender Prozesse, wodurch im Gehirn Kapazität geschaffen wird für bewusste Reaktionen, die aktuelle oder plötzlich abweichende eventuell bedrohliche Situationen erfordern.
Jeder Mensch erlebt aufgrund dieser automatisierten Abläufe im Gehirn Situationen ganz unterschiedlich, und Erfahrungen werden ganz individuell und divergent zu den Erfahrungen anderer Menschen im Gehirn abgespeichert. Dieses Phänomen wird auch mit »Man sieht, hört und fühlt, was man glaubt« beschrieben. Durch individuell angeeignete Erfahrungsmuster können Wahrnehmen und Empfinden deshalb nur subjektiv sein. Emotionales Mitschwingen und gedankliches Hineinversetzen in andere Menschen schaffen es daher nur, eine Ahnung und Idee oder Annahme zur Situation bzw. zum Befinden des Gegenübers zu entwickeln.
Bei der Betrachtung menschlicher Phänomene wie Empathie und Mitgefühl ist es nicht möglich, allgemeingültige Maßstäbe festzulegen. Selbstverständlich sind auch für diese zwischenmenschlichen Abläufe gesellschaftlich angestrebte Normen ausschlaggebend. Dennoch können aufgrund der Subjektivität und der sich daraus ergebenden Individualität der Einzelnen
•die Wahrnehmung der Situation eines Leidenden,
•die durch Resonanz ausgelösten aufsteigenden empathischen Impulse,
•die sich daraufhin entwickelnden Reizantworten wie Gedanken und Gefühle,
•die Reaktionen des Senders, seine Haltung und sein Verhalten, auf diese innerpsychischen Vorgänge und
•die empfundene Wirkung der Reaktion beim Empfänger
von gesellschaftlich geprägten Erwartungen abweichen.
Auch wenn das Nachempfinden einen generellen, bei jedem Menschen ähnlich ablaufenden intrapsychischen Vorgang darstellt, ist es wesentlich, sich diese Subjektivität von Wahrnehmung, Verarbeitung von Reizen und Reaktionen aufgrund individuellen Herangehens an Situationen bewusst zu machen.
1.2 Reizantworten
Der aufgrund der Befindlichkeit einer anderen Person ausgelöste Reiz wird durch Resonanz auf das Gegenüber übertragen. Die dabei entstehenden inneren Schwingungen und Regungen sind ganz individuell gefärbte Reizantworten.
1.2.1 Empathie allgemein
In der Literatur wird Empathie in der Regel dem Einfühlungsvermögen gleichgesetzt. Im Rahmen von Empathie wird auch von Mitfühlen, Zuwendung, Barmherzigkeit, Altruismus, sozialer Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Menschlichkeit gesprochen. Die Reizantwort »Empathie« wird in diesem Band als die Fähigkeit definiert, durch Resonanz die Befindlichkeit eines anderen Menschen, der sich in einer für ihn belastenden Situation befindet, unwillkürlich zu spüren und wahrzunehmen.
Empathie geht auf den altgriechischen Wortstamm »pathos« zurück, was Leid und Schmerz bedeutet, und löst beim Gegenüber eine emotionale Wahrnehmung der aktuellen (Not-)Lage eines Leidenden aus. Diese Fähigkeit ist hirnphysiologisch angelegt und wird im Verlauf der Sozialisierung ausgebaut. Kinder beginnen etwa ab dem sechsten Lebensmonat, Stimmungen anderer wahrzunehmen.
Eine empathische, auf andere gerichtete Wahrnehmung benötigt die Unterscheidung zwischen Ich und Du, die ungefähr mit dem dritten Lebensjahr möglich wird. Noll-Brinckmann (1999) weist darauf hin, dass empathische Prozesse nicht mit identifikatorischen gleichgesetzt werden können, da es sich nur um ein temporäres, partielles Wahrnehmen der Resonanz auf eine beobachtete andere Person handelt.
Die emotionale Verfassung einer anderen Person wird unbewusst vor allem anhand ihrer Mimik, Gestik, Körperhaltung und Sprache sowie ihres Tonfalls und Geruchs aufgenommen. Diese spezifischen Signale des Gegenübers stellen für die menschlichen Sinnesorgane Augen, Ohren und Nase sensorische Reize dar, die empfangen, über Nervenbahnen weitergeleitet und im Gehirn verarbeitet werden.
1.2.2 Facetten der Empathie
Aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, unterschiedlicher Wahrnehmung und dadurch unwillkürlich ausgelöster Reizantworten kann sich Empathie auf verschiedenste Art und Weise zeigen und in ihren Facetten qualitativ divergent darstellen. Das Miterleben einer Situation, in der sich ein anderer Mensch befindet, schließt körperliches, kognitives und emotionales Mitempfinden ein (Bion, 2009).
Emotionale Empathie
Affektive oder emotionale Empathie ist keine Emotion (Ekman, 2010), sondern das Wahrnehmen einer Gefühlsregung als Widerhall auf den emotionalen Zustand eines anderen Menschen. Die Wahrnehmung der Befindlichkeit des Gegenübers ergänzt und beeinflusst für einen Moment das eigene Empfinden.
Kognitive Empathie
Erinnerungen aus der Vergangenheit erzeugen unbewusst Signale, in welcher Situation sich der andere befindet, welche Gedanken, Absichten und Einschätzungen bei ihm vorliegen können. Diese intuitive gedankliche Perspektivübernahme wird in der Literatur als kognitive oder mentale Empathie bezeichnet.
Das verstandesmäßige Nachvollziehen der Lage eines anderen Menschen und emotionale Distanz bezeichnet Ciaramicoli (2001) als »funktionale Empathie«. Das Funktionalisieren von Empathie ist beispielsweise bei Personen mit psychischen Störungen, insbesondere Persönlichkeitsstörungen, anzutreffen und wird von ihnen, teils bewusst, teils unbewusst, zu Manipulation, Missbrauch und Kränkung genutzt. Andere Menschen werden gedemütigt oder öffentlich bloßgestellt, um das eigene Ich bzw. das Selbstwertgefühl zu stabilisieren.
Somatische Empathie
Das Wahrnehmen der Situation, in der sich ein anderer Mensch befindet, zusammen mit der emotionalen Berührung beeinflusst auch den Körper. Unter somatischer oder physischer Empathie (Noll-Brinckmann, 1999; Bion, 2009) werden zum einen die unbewusst ausgelösten Impulse wie Muskelanspannung verstanden, die die Mimik im Gesicht und die Körperspannung verändern. Zum anderen zählen dazu die wahrgenommenen körperlichen Empfindungen wie etwa ein Druck im Bauchraum, auch »Bauch-Hirn« oder »enterales Nervensystem« genannt, in dem sich ungefähr ebenso viele Nervenzellen befinden wie im Gehirn.
Soziale Empathie
In der neueren Literatur wurde der Begriff der sozialen Empathie (Pelz, 2017) eingeführt, die es möglich macht, das Verhalten komplexer Systeme zu deuten. Es wird darunter die Fähigkeit verstanden, sich auf Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Altersgruppen, aber auch auf verschiedene Temperamente und Charaktere einzustellen, was besonders für Personen in Leitungspositionen und mit Führungsaufgaben unerlässlich ist. Da es sich um komplexe Abläufe mit Bewusstmachung dessen handelt, was in einem selbst, in anderen und im Außen abläuft, wird für diesen Begriff auch die Bezeichnung »soziale Kompetenz« verwendet.
Narrative Empathie
Zum Verständnis der Falldarstellungen ist die Erwähnung einer weiteren, wie Breithaupt (2009) es nennt, »Kultur der Empathie« sinnvoll. Mit narrativer Empathie bezeichnet er den Prozess, in dem zu zwei beteiligten Parteien, zwischen denen empathische Reaktionen ablaufen – beispielsweise Trauernder und Trauerbegleiter –, eine dritte, möglichst neutrale Person – beispielsweise eine Supervisorin – dazukommt. Diese ermöglicht eine gedankliche, bewusstseinsverändernd wirkende Betrachtung einer Szene dieser zwei Parteien. Diese dritte Person schafft durch das Vorstellen und Anbieten alternativer Sichtweisen und Hypothesen für Helfende eine neue Erfahrung. Dadurch können Berater und Trauerbegleitende Wahrnehmungen reflektieren, das Gegenüber und seine Reaktionen neu bewerten und die eigene Haltung gegenüber Klientinnen und Klienten verändern. Solchermaßen Unterstützte können so zukünftige Reaktionen bewusst in eine andere Richtung – zum Beispiel mit mehr Mitgefühl – lenken.
1.2.3 Selbstempathie und Impathie
Im Raum zwischen Reiz und Reaktion werden unwillkürliche, resonanzbedingte Impulse als Reizantwort in bewusstes Wahrnehmen verwandelt, dem Einstufung der Situation und Selbstregulation folgen. Selbstempathie oder »Ich-bezogene Empathie« gelingt, wenn durch Ausbalancieren belastender Impulse angenehme Emotionen es ermöglichen, im nächsten Schritt eine nutzbringende Reaktion – Mitgefühl – für einen Leidenden zu planen und zu ergreifen. Können resonanzbedingte Wahrnehmungen nicht gesteuert werden, kann es zum emotionalen Überfluten – Mitleid – kommen, oder die Belastung muss durch andere Mechanismen – Abwehr – ausbalanciert werden.
Die im Konzept von Neubrand (2012) beschriebene Fähigkeit, die sie »Impathie« nennt, wird von ihr mit »sich selbst mit einer annehmenden Haltung zu begegnen und sich mit all seinen teils widersprüchlichen Gedanken, Gefühlen […] wahrzunehmen und zu verstehen, ohne sich dabei von einzelnen Erlebensweisen davontragen zu lassen«, definiert. Wenn »Impathie« über das Wahrnehmen empathischer Signale und ihre Regulation hinausgeht, regen neueste neurowissenschaftliche Untersuchungen an, diesen komplexen, bewussten Vorgängen des sich selbst liebevollen Zuwendens den Begriff »Selbstmitgefühl« zuzuordnen.
1.3 Reaktionen auf Reizantworten
Auf erste wahrnehmende Reizantworten durch innerpsychische und physische Vorgänge wie Erinnern, Fühlen und Spüren entwickeln sich Reaktionen wie Konzentrationsfähigkeit, Einstufung und Bewertung der Situation, Handlungsabsicht, Körperorientierung, Bewegungsplanung, Entscheidung sowie Worte, Verhalten, Motorik als Handlungsumsetzung. Diese Reaktionen auf Signale anderer Menschen in einer belastenden Situation und entstandene innerpsychische Impulse aufgrund der Resonanzfähigkeit des Menschen können individuell unterschiedlich ausfallen. Sie können aufgrund fehlender Reflexion unbewusst zu Abwehr und durch fehlende Abgrenzung zu Mitleid führen. Es können aber auch bewusste Denkprozesse angestoßen werden, die ein Vergegenwärtigen der Situation, einen kognitiven Perspektivwechsel von sich zum Gegenüber und Einschätzen sinnvoller Maßnahmen für angemessenes Mitgefühl ermöglichen.
1.3.1 Selbstmitleid und Mitleiden mit anderen
Eine der Reaktionen auf empathisches Berührtsein ist Mitleid bzw. Mitleiden. Mitleid wird nicht nur umgangssprachlich, sondern auch in älterer Fachliteratur dem Mitgefühl gleichgestellt.
Das Ausmaß emotionalen Berührtwerdens ist individuell unterschiedlich. Be- oder Überlastung sind Zeichen beschränkter emotionaler Regulierungsmöglichkeiten und eingeschränkten kognitiven Abgrenzens. Ursachen von Selbstmitleid bzw. des Mitleidens mit anderen können symbiotische Beziehungen mit Abhängigkeit und unreflektierte Erfahrungen sein. Betroffene können sich belastenden Impulsen aus der Vergangenheit nicht entziehen. Stattdessen werden diese durch aktuelle äußere Reize verstärkt. Die emotionale Überflutung beim Selbstmitleid oder Mitleiden mit anderen zieht empathischen Stress nach sich.
Emotionales Mitleid
Emotionales Mitleid kann als ein Überschwemmtwerden von Emotionen durch empathische Impulse und inneren Schmerz verstanden werden. Das eigene Leid oder das des Gegenübers, durch wahrgenommene belastende Emotionen ausgelöst, wird als unerträglich empfunden. Eine Ausdrucksweise belastender Gefühle beim Mitleid können neben leidvoller Mimik und hilfloser Gestik unkontrollierte Tränenausbrüche sein, die zeigen, dass der emotionale Druck nicht bewusst gesteuert werden kann. Der innerpsychische Schockzustand kann auch zum Erstarren führen, sodass Tränen blockiert sind. Diese Starre kann vom Gegenüber als emotionale Kälte missverstanden und als Abweisung empfunden werden.
Kognitives Mitleid
Mitleid äußert sich neben der Komponente der emotionalen Belastung auch durch destruktives gedankliches Bewerten. Schmerzhaft erlebte frühere Erfahrungen werden mit dem als katastrophal interpretierten Erleben der aktuellen Situation verknüpft. Kognitives Mitleid, sich selbst oder anderen gegenüber, trägt unbewusst Energie von Nicht-wahrhaben-Wollen und Beseitigenwollen im Sinne von »Oh, wie schrecklich!«, »Das will ich nicht!« oder »Das darf nicht sein« in sich. Es kann nicht zu konstruktivem Verhalten führen, welches dem Leidenden hilft. Destruktive Denkschleifen mit Schwarz-Weiß-Denken, Katastrophisieren, übertriebener Verallgemeinerung, Beziehen äußerer Umstände auf die eigene Person, Tunnelblick, aber auch leidvolles Klagen oder Zuweisen von bzw. Gedanken an Schuld können Ausdruck kognitiven Mitleids sein. Häufig ist eine chronische Belastung aus schmerzhaften Gefühlen, dysfunktionalen Gedanken und passivem Widerstand entstanden, sodass Menschen quasi in ihrem Leid verstrickt sind. Belastende Erlebnisse aus der Vergangenheit werden so über Jahrzehnte immer wieder aktiviert – ein Teufelskreis entsteht.