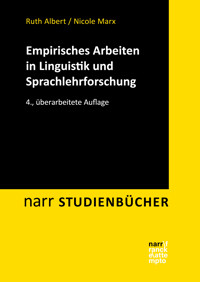
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr STUDIENBÜCHER
- Sprache: Deutsch
Das Studienbuch bietet eine systematische Anleitung für Studierende, die eine quantitativ vorgehende empirische Untersuchung im Bereich Linguistik/Sprachlehr- und -lernforschung planen. Jeder einzelne Schritt wird ausführlich erklärt: das Finden einer genau definierten Untersuchungsfrage, das Beachten wissenschaftlicher Gütekriterien, die Auswahl einer geeigneten Stichprobe, häufige Ansätze (Beobachtung, Befragung, Testen, Interventionen und Nutzung von Textkorpora), häufig eingesetzte Erhebungsinstrumente, die Datenaufbereitung und Datenauswertung, die Präsentation der Ergebnisse und das Schreiben des Forschungsberichts. Zu allen Kapiteln gibt es Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen sowie ausführliche Hinweise auf weiterführende Literatur. Für die vierte, komplett überarbeitete Auflage wurden insbesondere neue Forschungstendenzen bei empirisch vorgehenden Untersuchungen beachtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ruth Albert / Nicole Marx
Empirisches Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung
4., überarbeitete Auflage
Prof. Dr. Ruth Albert lehrte Deutsch als Fremdsprache am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Philipps-Universität Marburg.
Prof. Dr. Nicole Marx lehrt Sprachliche Bildung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381115228
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-8105
ISBN 978-3-1234-5678-9 (Print)
ISBN 978-3-381-11523-5 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur vierten Auflage
Das vorliegende Buch bietet eine systematische Anleitung zum Planen, Durchführen und Schreiben einer quantitativ vorgehenden empirischen wissenschaftlichen Arbeit in der Sprachlehrforschung oder Linguistik, in der jeder einzelne Schritt genau erläutert wird. Der Linguistik und Sprachlehr- und -lernforschung1 (die in vielen Ländern explizit „angewandte Linguistik“ genannt wird) ist gemeinsam, dass sie sich mit Sprachen beschäftigen und mit den Prozessen, in denen man Sprachen lernt. Obwohl es in den letzten Jahren viele methodische Entwicklungen gab, sodass die beiden Wissenschaften oft unterschiedliche Herangehensweisen vorziehen, scheint uns die Schnittmenge noch groß genug zu sein, um eine Einführung für beide Wissenschaften zu schreiben. In dieser, der vierten Auflage des Studienbuches, haben wir noch mehr Beispiele aus der Sprachlehrforschung einbezogen, weil entsprechende Fächer im Moment häufiger studiert werden.
Wir richten uns besonders an Studierende linguistischer oder sprachdidaktischer Fächer, die ihre Bachelor-, Master-, Examens- oder Doktorarbeit schreiben und die eine quantitative Studie durchführen möchten, und haben uns deshalb auf die Beschreibung der Verfahren beschränkt, die Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler tatsächlich häufig benutzen, verweisen jedoch im Text und in unserem kommentierten Literaturverzeichnis auf nützliche weiterführende Literatur.
Wir beschränken uns hier aus unterschiedlichen Gründen auf Studien, die quantitative Daten erheben, denn ein Bedarf an generalisierbaren Ergebnissen quantitativ vorgehender Forschung besteht nach wie vor. Auch wenn in vielen Kontexten eine Kombination qualitativer und quantitativer Methoden angebracht – geradezu notwendig – ist, würde eine Einführung in beide Perspektiven in einem so kurz bemessenen Studienbuch eine nicht zu vertretende Reduktion der wichtigen Inhalte und Überlegungen bedeuten. Wir empfehlen auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit qualitativer Forschungsmethodik und geben im Literaturverzeichnis einige Hinweise dazu, wo Sie weitere Informationen finden können. Gute Hinweise zu Mixed Methods-Designs finden Sie bei Hagenauer et al. (2023) und zu den wissenschaftstheoretischen Grenzen bei Riemer (2008).
Dieses Buch kann keine Wunder bewirken. Es ersetzt nicht die Besprechung mit der Betreuerin oder dem Betreuer der Arbeit darüber, was genau untersucht werden soll, welche Methoden zur Datenerhebung eingesetzt werden können und wie bei der Analyse der erhobenen Daten vorzugehen ist. Wir erklären häufig benutzte Verfahren und warnen vor häufig vorkommenden Fehlern. Die Aufbereitung der Daten und statistische Analyse als „Handwerkszeug“ können wir anleiten, den Gesamtprozess sollte man mit den Betreuenden durchsprechen.
Wenn man ein Buch für Personen mit recht verschiedenem Hintergrundwissen schreibt, dann tut man gut daran, bei der Darstellung der einzelnen Methoden Beispiele zu wählen, die man verstehen kann, ohne dass vorher komplizierte linguistische Hypothesen oder lerntheoretische Annahmen erklärt werden müssen. Deshalb haben wir hier mit möglichst einfachen und meist auch erfundenen Beispielen gearbeitet.
Die einzelnen Kapitel enden jeweils mit Übungsaufgaben, die es Ihnen ermöglichen sollen zu überprüfen, ob Sie das Gelesene schon selbstständig auf eine neue, konkrete Aufgabenstellung anwenden können. Erfahrungsgemäß ist man recht sicher, dass man die Aufgabe genau so gelöst hätte, wie es im Lösungsteil angegeben ist, wenn man unmittelbar nach dem Lesen der Aufgabe die Lösung nachliest. Wenn man die Aufgabe aber tatsächlich zu lösen versucht, ergeben sich doch Fragen. Wir raten Ihnen deshalb, die Aufgaben wirklich erst ohne die Lösungshinweise im Anhang zu bearbeiten.
Im Literaturverzeichnis finden Sie eine Liste kommentierter weiterführender Literatur. Sollten wir etwas nicht in diese Liste aufgenommen haben, finden Sie die Quelle direkt in einer Fußnote. Im Literaturverzeichnis sowie im Text richten wir uns an die Zitationskonventionen von APA7, die zur Zeit des Entstehens dieses Buchs gültige Version des Publication Manuals der American Psychological Association (APA). Viele Zeitschriften in der Sprachlehrforschung richten sich derzeit nach APA, und die Konvention ist in allen gängigen Literaturverwaltungsprogrammen aufgenommen. Andere Stile sind aber auch möglich, und Sie sollten sich vor dem Verfassen Ihres Forschungsberichts informieren, welche für Ihr Institut oder die Zeitschrift, bei der Sie einen Artikel einreichen, gelten.
Zum Thema Gendern: Wir wollten einen möglichst leicht lesbaren Text schreiben, sodass wir uns entschieden haben, in Bezug auf die angemessene Berücksichtigung beider Geschlechter bei den Personenbezeichnungen wie folgt vorzugehen: Wenn eine geschlechtsneutrale Form (wie z. B. „Lehrkraft“ oder „die Studierenden“) nicht existiert, verwenden wir für die Personen, die forschen, im Text immer die grammatikalisch feminine Form, für die Teilnehmer immer die grammatisch maskuline Form. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint.
Dieses Buch wird durch zusätzliches Material im Internet ergänzt, das man unter der Adresse
http://narr-studienbuecher.de/index.php/14-roksprocket-mosaic/52-empirisches-arbeiten-in-linguistik-und-sprachlehrforschung
abrufen kann.
Ein großer Dank gilt neben den in den ersten drei Auflagen erwähnten Personen den Lektoren dieser Auflage, Tillmann Bub, Barbara Landwehr und Lena Fleper, für ihr sorgfältiges Lektorieren. Wir danken auch den Studierenden unserer Seminare und Workshops für wertvolle Hinweise, die zur Verbesserung des Manuskripts beigetragen haben, sowie den Mitarbeiterinnen Anna Gorsch und Leonie Twente für ihre sehr wertvollen Hinweise zu dieser Auflage. Wir denken in Dankbarkeit an den verstorbenen Co-Autor des Vorgängerbuchs aus dem Jahr 2002, Cor J. Koster, dessen gute Ideen wir übernehmen durften.
Diese 4. Auflage ist eine vollständig überarbeitete Version der 3. Auflage aus dem Jahr 2016 und berücksichtigt einige neuere Forschungstendenzen und natürlich, dass auch wir immer weiter dazu lernen.
1Zur Einführung
Themen SprachlehrforschungManche Sprachlehrpersonen fragen sich Dinge wie beispielsweise:
Wie lehrt man am besten Vokabeln? Sollte man den Schülern Vokabeln mit Hilfe von Texten beibringen, indem man ihnen eine Übersetzung der unbekannten Wörter eines Textes gibt, oder sollte man die Schüler die Bedeutung der Wörter aus dem Text heraus selbst erraten lassen?
Würden die weniger begabten Schüler mehr lernen, wenn ich die Gruppe aufspalte in eine mit den besseren und eine mit den schlechteren Schülern?
Sind Schüler, die zu Hause zwei Sprachen sprechen, tatsächlich im Schnitt besser beim Lernen des Englischen als diejenigen, die zu Hause nur Deutsch sprechen, oder ist das nur ein Eindruck, den ich aufgrund meiner eigenen Schülergruppe habe?
Themen LinguistikLinguistinnen interessieren sich für ganz andere Fragestellungen, wie beispielsweise:
Unterscheidet sich das Versprachlichen von Aspekt im Deutschen (ich bin gerade dabei, spazieren zu gehen vs. Ich bin am Spazieren) durch Personen, deren Erstsprachen grammatikalisierten Aspekt haben (wie z. B. das Russische) von der Verwendung durch Personen, deren Erstsprache Aspektinformationen nur lexikalisch wiedergibt?
Wie unterscheidet sich die gesprochene von der geschriebenen Sprache in Bezug auf den Gebrauch von Steigerungspartikeln?
Worin unterscheidet sich die Sprache der Boulevardpresse von der seriöser Zeitungen?
Einige dieser Fragen können sehr leicht beantwortet werden, weil auf diesem Gebiet schon viel Forschung betrieben wurde. Trotzdem kann man der Meinung sein, dass man selbst mehr darüber herausfinden möchte, oder vielleicht ist die vorhandene Forschung zu einer bestimmten Frage für die eigene Situation nicht besonders relevant, oder man hat einfach Spaß an der Überprüfung von Vermutungen und Annahmen.
Forschung kann von unterschiedlichen Personen in ganz unterschiedlichen Kontexten betrieben werden. Alles, was man braucht, ist Neugier, eine Menge Geduld, ein paar Kenntnisse über Forschungsparadigmen und Statistik und eine gehörige Portion gesunden Menschenverstand. Zusätzlich muss man über die möglichen Fallen Bescheid wissen, die einen bei einem Forschungsprojekt erwarten. In diesem Buch wollen wir Neugier wecken, erste Kenntnisse über Forschungsparadigmen und Statistik anlegen und vor möglichen Fallen warnen – die Geduld und den Menschenverstand müssen Sie selbst beisteuern.
1.1Empirische vs. nicht-empirische Forschung
εμπειρία – auf Erfahrung beruhendEmpirische Forschung heißt wörtlich „auf Erfahrung beruhende Forschung“. Gemeint ist damit, dass eine systematisch zu erfassende Erfahrung die Grundlage bildet, um eine Frage zu beantworten. Das Ziel ist es, eine Gruppe oder ihr Verhalten durch die Analyse von bestimmten Merkmalen zu beschreiben. Diese Merkmale werden durch Verfahren („Erfahrungen“) wie Tests, Beobachtung oder Befragung untersucht. In nicht-empirische Wissenschaftennicht-empirischen Wissenschaften wie z. B. der Philosophie, der Literaturwissenschaft oder der Mathematik werden dagegen Erkenntnisse durch den Rückgriff auf logische Schlüsse gewonnen; diese sind oft nicht empirisch überprüfbar, sondern in sich schlüssig.
Die systematisch erhobenen Erfahrungen, die die empirischen Untersuchungen beschreiben, betreffen teils direkt beobachtbare und messbare Merkmale (z. B. Körpergröße in Zentimetern), teils nur indirekt beobachtbare, – sogenannte latente Variablenlatente Merkmale (z. B. Motivation zu lernen oder Einstellungen einer Sprache gegenüber). Latente Merkmale sind übrigens in der Sprachlehrforschung besonders bedeutsam, weil viele Untersuchungsobjekte oder Konstrukte, die uns interessieren, nicht direkt wahrnehmbar sind.
1.2Forschungsparadigmen
Forschungsparadigmen werden gewöhnlich in unterschiedliche (dichotome) Kategorien unterteilt. Für die Linguistik und Sprachlehrforschung sind insbesondere drei Differenzierungen relevant: deduktiv vs. explorativ, qualitativ vs. quantitativ, und experimentell vs. nicht-experimentell. Alle Möglichkeiten sind unterschiedlich miteinander kombinierbar – allerdings hat es sich eingebürgert, dass bestimmte Paradigmen fast nur gemeinsam auftreten. Auch deswegen gibt es manchmal Verwirrung darüber, welches Paradigma eigentlich gerade eingesetzt wird. Wir gehen nun kurz auf jede Unterscheidung ein.
1.2.1Exploratives vs. deduktives Vorgehen
Explorative ForschungExploratives (auch: interpretatives) empirisches Arbeiten hat das Ziel, ein Phänomen zunächst zu erkunden, um Hypothesen erst aufstellen zu können und zur Theoriebildung beizutragen. Deswegen ist das explorative Arbeiten in einem neu entstehenden Forschungsbereich sinnvoll und wichtig – damit erlangt man überhaupt Informationen zu einer Gruppe oder einem Verhalten. Explorative Studien arbeiten oft zunächst mit kleineren Gruppen von Informanden oder kleineren Mengen von Daten und fokussieren spezifische Aspekte der interessierenden Situation. Da Forschungsergebnisse aber meist nur dann für die praktische Anwendung verwertbar sind, wenn sie generalisierbar sind, wird meist anschließend für weitere Studien plädiert.
Deduktive ForschungDeduktives (auch: analytisches, nomologisches) empirisches Arbeiten hat dagegen als Ziel das hypothesenprüfendPrüfen von Hypothesen (mehr dazu im nächsten Kapitel) und die Verallgemeinerung von Aussagen. In hypothesenprüfenden Studien hat man eine Idee, wie sich eine Gruppe verhalten wird, und man prüft diese Idee wissenschaftlich. Ein konkretes Beispiel: Sie vermuten, dass Schüler der vierten Klasse, die zu Hause kein Deutsch sprechen, im Deutschen genauso komplexe syntaktische Strukturen verwenden wie Schüler, die zu Hause nur Deutsch sprechen. Dies ist eine Hypothese (wenn noch keine wissenschaftliche, s. Kapitel 2). Sie planen dann eine Untersuchung, um diese Hypothese zu belegen oder zu widerlegen – sie also zu testen.
1.2.2 Qualitative vs. quantitative Verfahren
Die Unterscheidung in qualitative und quantitative Verfahren ist eine recht einfache, auch wenn diese Verfahren oft mit explorativen und deduktiven Vorgehensweisen verquickt werden. Es handelt sich darum, ob wir unsere erhobenen Informationen quantitative Daten(Daten) quantifizieren können. Wenn wir das Vorkommen von Merkmalen zählen – das gilt auch für Kategorien wie z. B. „Geschlecht“ (männlich, weiblich, divers, keine Antwort) oder Herkunftsland (Deutschland, Kanada, Niederlande etc.) – dann sind die Daten quantitativ.
Wenn wir eine Verhaltensweise aus der Perspektive der Beforschten nachvollziehen wollen und keine quantifizierbaren Daten daraus ableiten, dann arbeiten wir qualitative Datenqualitativ. Qualitative Verfahren setzen tendenziell eher Befragungen, insbesondere Interviews, ein. Da sie sich generell auf die Verbalisierung der Aktanten verlassen müssen, sind bestimmte Personengruppen mit diesem Ansatz schwieriger zu beforschen. So ist die Befragung von sehr jungen Lernenden (die ein eher niedriges Reflexionsvermögen haben), von Immigranten mit wenigen Kenntnissen der Befragungssprache (die u. U. Schwierigkeiten mit der Verbalisierung ihrer Meinungen in dieser Sprache haben), oder von Personenkreisen, für die die Datenschutzrichtlinien besonders stringent sind und die man deswegen oft nicht umfangreich befragen darf (Minderjährige, Geflüchtete, Personen mit Behinderung), oft weniger aussichtsreich.
1.2.3 Experimentelle vs. nicht-experimentelle Verfahren
Schließlich kann eine Studie experimentell oder nicht-experimentell angelegt werden. Nicht-experimentelle Forschung beobachtet nur etwas, ohne dass die Forscherin versucht, das Verhalten ihrer Informanden zu beeinflussen. Meinungsumfragen sind ein typisches Beispiel dafür („Wie viele Menschen beantworten eine bestimmte Frage mit ja, wie viele mit nein?“). Oft werden Antworten miteinander in Verbindung gesetzt, um zu sehen, ob Zusammenhänge aufzufinden sind (z. B. ob die durchschnittliche Anzahl an gelernten Sprachen mit dem Alter der Befragten steigt, oder ob das Genus im Deutschen häufiger korrekt gebraucht wird bei Studierenden mit bestandener C1-Prüfung oder bei Studierenden ohne Prüfung). Experimentelle Forschung ist dadurch charakterisiert, dass etwas (beispielsweise die Menge Alkohol, die man zu sich nimmt, oder die Art und Weise, wie man lernt) manipuliert wird, d. h. von der Forscherin kontrolliert wird. Auf diese Möglichkeit gehen wir im Kapitel 8 gesondert ein.
1.2.4 Auswahl eines Forschungsparadigmas
Welches Paradigma letztendlich gewählt wird, hängt vom Erkenntnisinteresse, von den Forschungsfragen und vom Stand der Forschung ab. Das bedeutet: Das Paradigma muss so ausgewählt werden, dass es zum Forschungsinteresse und Forschungskontext passt. Das soll auch dann gelten, wenn bestimmte Forschungsansätze gerade in einer Community in „Mode“ sind: Dass die Betreuerin oder sehr viele andere Forschende mit z. B. explorativen, nicht-experimentellen Verfahren arbeiten, die qualitative Daten erheben,1 bedeutet nicht, dass man selbst so vorgehen muss. Die Auswahl jeder Vorgehensweise muss sehr sorgfältig anhand der verfügbaren Informationen und der genauen Fragestellung der Untersuchung getroffen werden.
Übrigens wird oft auf eine Kombination (TriangulationTriangulation genannt) unterschiedlicher Daten, Designs oder Forschungsparadigmen zurückgegriffen, um ein möglichst vollständiges Bild von den untersuchten Merkmalen zu erzielen. Ebenso ist es möglich, in einer einzigen Studie sowohl quantitative als auch qualitative Verfahren zu verwenden, je nachdem, was man untersuchen will (Mixed Methods-Designs). Für größere Arbeiten ist eine solche Kombination oft durchaus sinnvoll, für kleinere Arbeiten, wie im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit, ist dies meist nicht notwendig. Wir gehen in Kapitel 2 etwas detaillierter darauf ein.
Wenn auch wir hier, wie üblich, die unterschiedlichen Arten von Forschung getrennt behandeln, bedeutet das nicht, dass es keine Grauzonen zwischen den Ansätzen gibt. In dieser Einführung versuchen wir einen verständlichen Zugang zu den Themen zu geben, sodass Sie eine erste Orientierung gewinnen. Dabei beschäftigen wir uns – wie im Vorwort erklärt – im Weiteren nicht mit qualitativer Forschung. Wenn Sie sich besonders dafür interessieren, empfehlen wir Ihnen als Einführung die Werke von Altrichter et al. (2018) sowie Friebertshäuser et al. (2013).
1.3Wann eigentlich empirisch arbeiten?
Bei aller Begeisterung für die Empirie: Nicht jede Art von Forschungsfrage, die man sich als Linguistin oder Sprachlehrforscherin stellt, erfordert eine empirische Untersuchung oder ist überhaupt sinnvoll mit einer empirischen Untersuchung zu beantworten. Angenommen, Sie wollten herausfinden, wie das Partizip II der regelmäßigen Verben im Deutschen gebildet wird, so ist die richtige Antwort durch die eigene Introspektion (wenn Sie eine kompetente Sprecherin des Deutschen sind und regelmäßige Verben erkennen können) oder durch Nachschlagen in Grammatiken erheblich schneller und zuverlässiger zu finden als z. B. mit einer Befragung oder einer Beobachtung von Sprechern des Deutschen. Insofern ist die Frage nicht trivial, ob eine Forschungsfrage eine empirische Untersuchung erfordert.
Die Introspektion einer Sprachwissenschaftlerin als kompetenter Sprecherin der zu untersuchenden Sprache ist für große Teile der Sprachbeschreibung die sinnvollste Methode der Datengewinnung. Sie ist jedoch nicht anwendbar, wenn man befürchten muss, dass nicht alle Sprecher dieser Sprache zu denselben Ergebnissen kämen, wenn sie ihren eigenen Sprachgebrauch reflektierten. Das kann daran liegen, dass es regionale oder soziolektale Unterschiede gibt oder dass ein Unterschied zwischen Sprachnorm und Sprachgebrauch zu vermuten ist. Es kann auch sein, dass man sein eigenes Verhalten gar nicht gut genug kennt, um es beschreiben zu können (etwa beim Geben von Hörersignalen wie hmhm), oder dass man das sprachliche Verhalten von Gruppen beschreiben möchte, zu denen man nicht gehört (z. B. Kinder im Erstspracherwerb oder erwachsene Zweitsprachenlernende auf einem bestimmten Sprachniveau).
Ebenso kann es sein, dass das zu untersuchende Phänomen äußerst komplex ist, sodass man bei einer Introspektion niemals alle Komponenten beachten könnte. Das ist z. B. in der Wirklichkeit des Fremdsprachenunterrichts immer so. Aber auch in der „reinen Linguistik“ gibt es sehr komplexe Phänomene zu untersuchen. Dazu gehört vor allen Dingen die Beschreibung des Ablaufs von Gesprächsformen, z. B. Kommunikation vor Gericht oder in der Schule, Verkaufsgespräche, Verhandlungsgespräche, Arzt-Patienten-Gespräche u. a. m. Für diese Untersuchungen gibt es eine spezielle linguistische Methode, die Gesprächsanalyse (Konversations-analyseKonversationsanalyse). Sie beruht auf speziellen Verfahren der Datenerhebung und der Datenaufbereitung, darunter besonders die Transkription der Gespräche nach festgelegten Notationen, die nicht nur den Wortlaut der Äußerungen, sondern auch Betonungen, Gleichzeitig-Sprechen, Pausen, Tonhöhenverlauf und vieles andere mit berücksichtigen. Da es für diese Art empirischer Forschung bereits gute deutschsprachige Einführungen gibt (z. B. Brinker & Sager, 2006; Deppermann, 2008; Henne & Rehbock, 2019), und für die Gesprächsforschung mehrere Sonderbedingungen gelten, soll dieses Thema hier nicht weiter aufgegriffen werden. Wir beschäftigen uns also mit der nicht konversationsanalytisch ausgerichteten, quantitativen empirischen Forschung im Bereich Linguistik und Sprachlehrforschung.
1.4Zum Aufbau des Studienbuchs
Empirische Forschung im Bereich Linguistik und in weiten Teilen der Sprachlehrforschung folgt den üblichen Regeln der empirischen Sozialforschung, d. h. die dort geltenden Gütekriterien und die dort geltenden Methoden werden von Linguistinnen und Sprachlehrforscherinnen genauso benutzt wie z. B. von Soziologinnen oder Psychologinnen auch. Das Ziel des StudienbuchsZiel dieser einführenden Darstellung ist, einen Überblick über gängige Methoden zu geben und die Lesenden in die Lage zu versetzen, selbst eine empirische Untersuchung in diesem Bereich zu planen und durchzuführen. Dazu wird das Vorgehen bei einer empirischen Forschungsarbeit von der ersten Grobplanung bis zur Niederschrift des Forschungsberichts beschrieben.
Um die Planungs- und Durchführungsschritte deutlicher darzustellen, teilen wir das Buch in vier „Schritte“ auf.
In Schritt 1: PlanungsphaseSchritt 1 besprechen wir, wie man seinen Untersuchungsgegenstand abgrenzen kann und was zur Vorplanung einer Studie gehört, dann beschreiben wir die Gütekriterien für empirische Sozialforschung allgemein. Hier gehen wir in einem gesonderten Kapitel auf die Stichprobenziehung ein, die besonders zentral für valide Ergebnisse ist.
In Schritt 2: DatenerhebungSchritt 2 fokussieren wir gängige Erhebungsmethoden und die damit verbundenen Instrumente der Datenerhebung. Gegenstand unserer Untersuchungen ist im allerweitesten Sinne menschliches Verhalten, nämlich Sprachverhalten, Kommunikationsverhalten oder Lernverhalten. Um über dieses Verhalten mehr zu erfahren, gibt es drei verschiedene Herangehensweisen. Zunächst einmal kann man das zu untersuchende Verhalten dort untersuchen, wo es natürlicherweise stattfindet. Das ist in der Sprachlehrforschung das am weitesten verbreitete der angewandten Verfahren. Man beobachtet das Unterrichtsgeschehen einfach im „normalen“ Unterricht, oder man beobachtet das (Lern- oder Sprech-) Verhalten einzelner Personen in Fallstudien. Zur Beobachtung gehören, streng genommen, auch die Korpusanalyse und das Testen, die wir aber auf Grund von deren Besonderheiten in separaten Kapiteln behandeln. Die zweite Möglichkeit ist die Befragung. Hier stört die Forscherin nicht den Prozess, über den sie etwas aussagen will, sondern sie bittet die am Prozess Beteiligten um Auskünfte. In diesem Fall wird die Wirklichkeit durch bewusste Prozesse derjenigen gefiltert, die befragt werden. Das ist vor allem dann problematisch und erfordert besonders ausgefeilte Techniken, wenn Normen im Spiel sind. Die dritte Möglichkeit der Verhaltensbeobachtung ist das Experiment oder – in Lehr-/Lernkontexten – die Intervention. Dabei versuchen wir, alles auszuschließen oder konstant zu halten, was für die Untersuchungsfragestellung keine Rolle spielt. Störende Einflüsse kann es trotzdem geben.
Im Schritt 3: Datenanalysedritten Teil des Buchs geht es um die Aufbereitung und statistische Auswertung der Daten, die man erhoben hat. Wichtig: Geisteswissenschaftlerinnen fangen beim Wort „Statistik“ oft an zu schwitzen. Es gibt aber keinen Grund, vor Statistik Angst zu haben – wie wir in den Kapiteln 9–13 zeigen werden. Die eigentliche Rechenarbeit übernehmen heutzutage Computerprogramme, wichtig ist nur zu verstehen, was vom Programm berechnet wird und warum es so berechnet wird, damit man das richtige Verfahren auswählen kann. Der in dieser Einführung behandelte Teil der Statistik ist nur der, den man als Sprachwissenschaftlerin/Sprachlehrforscherin tatsächlich häufig braucht.
Schritt 4: ForschungsberichtDas letzte Kapitel erläutert, wie Sie Ihre unternommenen Planungen, erhobenen Daten und die daraus gewonnenen Ergebnisse in einem Forschungsbericht präsentieren können.
Sie müssen die Kapitel natürlich nicht in dieser Reihenfolge bearbeiten. Es kann durchaus sinnvoll sein, vor der Lektüre des dritten Teiles zuerst die Ausführungen zu statistischer Signifikanz zu lesen (Kapitel 13) oder zu den Skalenniveaus (Kapitel 7) zu behandeln, bevor Sie mit Kapitel 3 beginnen. Letztendlich müssen wir in einem gedruckten Buch alles linear präsentieren; der Forschungsprozess ist dagegen oft iterativ (rekursiv), und man sollte sich durchaus bereits in der Planungsphase mit Skalenniveaus und Statistiken befassen, um spätere Probleme zu umgehen.
Aufgabe
Nehmen wir an, Sie sollten Forschung auf einer Reihe von Gebieten, die unten in etwa beschrieben werden, betreiben. Welche Art der Forschung wäre am besten geeignet (deduktiv, explorativ, experimentell, nicht-experimentell, qualitativ, quantitativ)? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
Der Einfluss eines Partybesuchs in der Nacht vor einer Prüfung auf die Ergebnisse dieser Prüfung
Die Beziehung zwischen Sprachlaborübungen und Aussprache
Welche Ansichten von de Saussure heute noch für die Linguistik relevant sind
Die Fremdsprachenkenntnisse niederländischer Geschäftsleute
Der Nutzen von Korrekturen der Grammatikfehler von Fremdsprachenlernern
Die Verwendung von Höflichkeitsformen bei internationalen Verhandlungen
Arten der Selbstkorrektur beim L1-(Erst-) und L2-(Fremd-/Zweit-) Spracherwerb
Ein Vergleich des stillen und des lauten Lesens bei der Entwicklung der Lesefähigkeit
Welches Testverfahren am besten für die Diagnostik von Wortschatzkenntnissen in einer anschließenden Studie bei einer bestimmten Personengruppe eingesetzt werden sollte.
Schritt 1: Planungsphase
Das Interesse ist geweckt – mit hoher Motivation kann das Forschungsprojekt starten! Aber: Bevor es an die Datenerhebung – oder gar an das Zusammenschreiben – gehen kann, sind sehr viele Überlegungen durchzuführen und sehr viele Entscheidungen abzuwägen. Wie so häufig in der empirischen Wissenschaft, gibt es selten Entscheidungen, die eindeutig richtig oder falsch sind. Jeder Teil eines empirischen Projektes muss sorgfältig und in Relation zu allen anderen Teilen abgewägt werden. Damit sind viele Teile des Planungsprozesses nicht linear zu bestimmen, sondern als Teil des Gesamtprojekts.
In diesem Schritt besprechen wir die ersten Entscheidungen, die zu treffen sind, bevor man sich konkret für ein Forschungsdesign entscheidet und dieses dann aufbaut.
Im Kontrast zu früheren Auflagen haben wir uns entschieden, dem Thema „Stichprobe“ ein eigenes Kapitel (Kapitel 3) zu widmen. Das liegt daran, dass die Zusammensetzung einer Stichprobe ganz besondere Überlegungen benötigt, die gesonderte Aufmerksamkeit verdienen.
2Planung einer empirischen Studie
Hat man sich dafür entschieden, ein empirisches Forschungsprojekt durchzuführen – und hier ist es unwesentlich, ob das Projekt ein sehr kleines ist (wie zum Beispiel eine Studie im Rahmen einer Seminararbeit, die einen Fragebogen einsetzt) oder ein größeres (wie ein Dissertationsprojekt, das eventuell unterschiedliche Forschungsmethoden und mehrere Erhebungsinstrumente verwendet) –, ist der wichtigste Schritt die Planung. Wenn man versucht, in der Planungsphase Zeit zu sparen, zum Beispiel weil man schnell Daten erheben möchte, verliert man erheblich mehr Zeit bei der Auswertung und Interpretation, weil unpassende Untersuchungsteilnehmer ausgewählt wurden, weil die Daten nicht das Phänomen abbilden, das sie abbilden sollen, oder weil man nicht weiß, was man mit den gesammelten Daten anfangen soll. In solchen Fällen – und das passiert häufiger, als man denkt – muss man völlig neu beginnen. Wir gehen im Folgenden auf erste Entscheidungen ein, bevor wir zentrale Themen der Forschungsplanung besprechen.
2.1Erste Überlegungen
Bevor man ein passendes Untersuchungsdesign auswählt, sind sehr viele Entscheidungen notwendig. Die folgenden Fragen sind nicht nacheinander „abzuarbeiten“, sondern werden gleichzeitig und in Relation zueinander beantwortet:
Sind forschungsethische Bedenken zu berücksichtigen?
Wie grenze ich die Studie durch eine Exploration der vorhergehenden Forschung zum gleichen Untersuchungsgegenstand ein?
Welche Konstrukte sind zentral und müssen definiert werden?
2.1.1 Forschungsethik
In der Sprachlehrforschung machen wir uns oft kaum Gedanken darüber, dass wir Menschen durch eine Forschungsstudie schädigen könnten. Manchmal denkt man deswegen, ethische Fragen seien nicht so wichtig wie für medizinische oder pharmazeutische Forschungsstudien. So ganz stimmt das aber nicht, denn erstens können trotzdem Schäden entstehen (wenn Teilnehmer z. B. durch eine Testung nervös oder sogar ängstlich werden, ist das kein sorgsamer Umgang mit ihnen), und zweitens sind die Vorgaben für „ethische Forschung“ in den letzten Jahren deutlich umfangreicher geworden.
Während des gesamten Forschungsprozesses muss man sich immer wieder fragen: Was für Konsequenzen können die getroffenen Entscheidungen für die untersuchten Personen und die durch sie vertretene Gruppe haben? Das betrifft dann nicht nur den Prozess der Stichprobenauswahl oder der Datenerhebung, sondern auch, was mit den Daten später passiert. Auch wenn man keinen Ethikantrag stellen muss (was aber immer häufiger erforderlich wird), sollte man sich deswegen immer Gedanken zur Forschungsethik machen.
Das Thema Ethik ist komplex. Wir geben hier daher nur zwei kleine Beispiele und empfehlen eine vertiefte Lektüre zu Forschungsethik, wenn Sie selbst mit selbst- oder auch fremderhobenen Daten (Sekundärdaten) arbeiten.1
Beispiel 1: Jemand will wissen, ob Kinder in einem bestimmten Alter Partikelverben korrekt verwenden. Er kann zwar Daten von vielen Kindern einsammeln. Das erfordert aber viel Zeit – von den Kindern, aber auch von ihren Eltern (die die ganze Zeit mindestens dabei sein müssen oder auch Erhebungen durchführen, indem sie z. B. Beobachtungsbögen ausfüllen). Die Forschungsfrage kann man aber genauso gut (vermutlich noch besser) durch Rückgriff auf bereits bestehende Daten beantworten, indem man in einem öffentlichen Korpus recherchiert. Es wäre unethisch, neue Personen durch weitere Erhebungen zu belasten, wenn passende Daten bereits bestehen.2
Beispiel 2: Jemand will herausfinden, wie der Englischunterricht an Grundschulen bewertet wird, und erstellt dafür einen (anonymisierten) Fragebogen für Eltern. Er führt dies an zwei Grundschulen durch und erhält mehr als 100 Antworten von den Eltern, die er dann auswertet. Es wäre trotzdem nicht ethisch, die Ergebnisse zu publizieren – denn es wäre schnell ersichtlich, um welche Lehrkräfte es sich handelt. (An den meisten Grundschulen gibt es nur eine Englischlehrkraft, sodass insgesamt nur zwei Personen eine „Bewertung“ erhalten – das könnte unglückliche Konsequenzen für sie haben.)
Die meisten Hochschulen haben inzwischen Stellen, die zur Forschungsethik beraten. Nehmen Sie möglichst das Angebot wahr, bevor Sie zur Datenerhebung kommen. Das hilft, unbeachtete Konsequenzen für die Zielgruppe zu vermeiden.
2.1.2 Exploration
Forschungsstudien beginnen mit einem Wunsch, etwas Unklares klarzustellen. In der Sprachlehrforschung hat man den Vorteil, dass sich viele interessante Themen direkt aus der Praxis ergeben. Als Lehrperson wird man täglich mit Fragen und Problemen konfrontiert, die sich hervorragend für kleinere oder größere Projekte eignen: Fällt es Schülern in bestimmten sprachlichen Kontexten leichter, französische Possessivpronomen korrekt zu verwenden? Hilft es, wenn Schüler anstatt des regulären Sprachunterrichts jede Woche eine Stunde lang Grammatik mit Hilfe einer Lernapp üben? In welchen Situationen schafft es Janet, ein Adverbial ins Vorfeld zu setzen, ohne vor das Verb noch das Subjekt zu stellen („Heute lerne ich Deutsch“ anstatt *„Heute, ich lerne Deutsch“1)? Und hat Pierre, der aus Frankreich kommt, mit dieser Struktur mehr Probleme als Marijke aus den Niederlanden?
Aber auch wenn man nicht in der beruflichen Praxis steht, trifft man auf erforschenswerte Bereiche: durch das eigene persönliche Umfeld, durch Seminarthemen oder durch Literaturrecherche. Wichtig dabei ist, dass man weiß, was genau untersucht werden soll. Das Formulieren eines ErkenntnisinteresseErkenntnisinteresses ist der erste Schritt dazu und ein zentraler Bestandteil der Explorationsphase.
Zum Einschränken des Erkenntnisinteresses gehören drei zentrale Leitlinien: Erstens muss das Projekt machbar sein, zweitens muss es auf der Basis des relevanten Informationsstandes der Forschung aufgebaut werden, und drittens muss vor Beginn der Datenerhebung deutlich sein, zu welchem Zweck die Daten erhoben werden sollen.
Machbar zu sein bedeutet mehreres. So muss das Projekt so weit eingegrenzt werden, dass es auch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und in der zur Verfügung stehenden Zeit Durchführbarkeitdurchgeführt werden kann. Ist es dagegen zu weit eingegrenzt, läuft man Gefahr, dass die Ergebnisse nicht mehr valide sind (s. Kapitel 2.5). Hierzu gehören viele Überlegungen, z. B. zur Größe und Auswahl der untersuchten Gruppe. Möchte man herausfinden, ob es einen Unterschied zwischen Chinesen und Russen in der benötigten Unterrichtszeit zum Erreichen des GER A1-Niveaus in Deutsch gibt, kann man unmöglich sämtliche chinesischen und russischen Lerner testen, aber auch nicht einen chinesischen und einen russischen Lerner, die man zufällig kennt. Und ebenso braucht man eine Gruppe von Menschen, die zur Forschungsfrage passt – möchte man den bilingualen Spracherwerb untersuchen, hilft es wenig, wenn man keinen Zugriff auf junge Lerner hat (mehr zum Thema Stichproben lesen Sie in Kapitel 3). Ebenso wenig ist es für die meisten Untersuchungen sinnvoll, „Sprachkenntnisse“ generell überprüfen zu wollen: Man wählt einen bestimmten, eingegrenzten Bereich aus und versucht, diesen genau zu untersuchen. So könnte man sich dafür entscheiden, Genuskongruenz in der Nominalphrase oder Erfolg beim Verstehen von Richtungsanweisungen oder das Gesamtergebnis in einem Spracherhebungsverfahren bei Kindergartenkindern einer bestimmten Herkunft zu untersuchen.
Machbar zu sein bedeutet aber auch, dass alles, was man für die Untersuchung braucht, auch vorhanden oder zu beschaffen ist. Möchte man physiologische Reaktionen durch Personen mit unterschiedlichen Erstsprachen messen, während sie Videosequenzen auf Englisch ansehen, dann kann die Studie nur dann durchgeführt werden, wenn die Forscherin auch eine zuverlässige Möglichkeit hat, solche Reaktionen zu messen (z. B. elektrodermale Aktivität, Pupillendurchmesser).2 Möchte man Fehler analysieren, die deutschsprachige Lerner beim Schreiben von Texten in Farsi machen, muss man diese Fehler auch kompetent erkennen können (d. h. man muss entweder selbst fundierte Farsikenntnisse oder Zugriff auf jemanden mit diesen Kenntnissen haben).
Kenntnis der bisherigen ForschungDie Einschätzung der Machbarkeit hängt wie viele andere zentrale Themen davon ab, wie informiert die Studie ist. Das bedeutet nichts Anderes, als dass man sich – genau wie für eine Seminararbeit – vor der endgültigen Formulierung einer Forschungsfrage durch vertiefte Literaturrecherche über die vorliegenden Erkenntnisse zum Thema informiert, und zwar sowohl über den Forschungsgegenstand als auch über die mögliche Forschungsmethodik. Das hilft sowohl das Projekt zu planen als auch Fallen beim Untersuchungsaufbau zu vermeiden: Man lernt aus den Überlegungen anderer, vor allem wenn dabei die einzelnen Schritte der Planung und Durchführung besprochen werden. Eine grundlegende Literaturrecherche zeigt v. a., was für eine Forschungsstudie man überhaupt durchführen kann – d. h., ob sie explorativ, deskriptiv oder explanativ (erklärend) sein soll (s. Kap. 2.3.2).
Schließlich muss man wissen, zu welchem Zweck die Daten erfasst werden. Bereits vor der Datenerhebung muss man überlegen, welche Schlussfolgerungen man hinterher tatsächlich aus den Ergebnissen ziehen kann. Soll z. B. eine bestehende Hypothese oder Theorie überprüft werden, so wird man sich fragen, welche Vorhersagen diese für bestimmte Situationen impliziert. Dann kann man versuchen, entsprechende Situationen zu beobachten oder sie künstlich zu schaffen, um zu überprüfen, ob sich die Wirklichkeit den Vorhersagen entsprechend verhält.
Das ist keine Lappalie: Viele laienhaft angelegte empirische Untersuchungen sammeln Daten, die dann nicht interpretierbar sind. Man beobachtet z. B. bei Befragungen oft, dass Studierende Fragen stellen, ohne sich vorher ausreichend überlegt zu haben, was die möglichen Antworten für ihre Untersuchung überhaupt bedeuten können („Ich sehe mal, was dabei herauskommt“). Den daraus resultierenden Problemen kann man entgehen, indem man den Fragebogen oder das Interview vor dem Einsatz systematisch daraufhin untersucht, ob die zu erwartenden Antworten überhaupt für die Argumentation zu gebrauchen sind.
Vor allem für erste empirische Versuche wie im Rahmen von Seminar- oder Abschlussarbeiten sind ReplikationsstudienReplikationsstudien sehr zu empfehlen (vgl. Porte & McManus, 2019). Replikationsstudien testen, ob sie die Ergebnisse aus anderen Studien wiederholen können. Sie können sehr eng an das Design der ersten Studie angelehnt werden, indem sie z. B. dieselbe Untersuchungsfrage und dasselbe Untersuchungsdesign einsetzen, oder leicht unterschiedlich sein, indem sie z. B. mit einer unterschiedlichen Zielgruppe oder einer unterschiedlichen Zielsprache die gleiche Untersuchung durchführen. Wenn man eine Replikationsstudie durchführt, hat man die Gelegenheit, erstens die theoretischen Grundlagen und den daraus entwickelten Forschungsprozess stark angeleitet zu erleben und zu reflektieren, zweitens aber auch, die Ergebnisse aus anderen Untersuchungen zu prüfen (und zu bestätigen bzw. in Frage zu stellen). Neben diesen Vorteilen haben Replikationsstudien für die gesamte Forschungsgemeinschaft einen nicht zu unterschätzenden Wert: Sie tragen dazu bei, die Verlässlichkeit von Erkenntnissen und damit die Transparenz von empirischen Studien zu stützen, und gehen damit auf die viel diskutierte „Replikationskrise“ ein.3 Daher werden sie immer häufiger in wissenschaftlichen Zeitschriften anerkannt und veröffentlicht.
2.1.3 Operationalisierung zentraler Begriffe
OperationalisierungSpätestens im Laufe der Explorationsphase wird deutlich, dass man mit bestimmten Begriffen und Annahmen arbeitet, die nicht immer gleich verstanden werden, und die näher bestimmt werden müssen. Man muss also damit beginnen, zentrale Konstrukte zu operationalisieren.
Zunächst zum Begriff KonstruktKonstrukt. Bei manchen Begriffen weiß jede Zuhörerin, was wir damit meinen. Sage ich zum Beispiel, dass ich heute 10 km gelaufen bin, ist die Distanz unproblematisch – jede weiß oder kann zumindest sicher nachschlagen, wie weit 10 km sind. Mit dem Begriff „laufen“ ist es schon schwieriger, da müsste ich evtl. hinzufügen, dass ich 5 km in einem bestimmten Tempo gejoggt und im restlichen Tagesverlauf weitere 5 km gegangen bin, z. B. durch den Gang von der Bushaltestelle zur Bibliothek.
In der Linguistik und Sprachlehrforschung ist die Bestimmung von Begriffen, die für Forschungsstudien relevant sind, selten einfach. Wir machen das an zwei Beispielen deutlich. Nehmen wir an, es soll untersucht werden, ob man das Hörverstehen von Fremdsprachenlernern besser mit der Methode X oder mit der Methode Y fördern kann. Dann wird eine ganz entscheidende Frage für den Wert der Untersuchung sein, ob es gelingt, den Faktor „Hörverstehen“ hinreichend von anderen Faktoren zu isolieren (wir operationalisieren das Konstrukt). Denn ob die Lerner etwas verstehen, hängt nicht nur vom eigentlichen Hörverständnis ab, sondern sie nehmen z. B. ihr Weltwissen und Informationen aus der Situation zu Hilfe, und in der Planung der Untersuchung muss man das berücksichtigen (man muss also konfundierende Faktoren identifizieren und ausschließen, worauf wir unten eingehen). Es wird auch wichtig sein, zu entscheiden, ob „Hörverstehen“ rein auditiv gemessen sein soll, oder ob audiovisuelles Verstehen (also mit einer Unterstützung durch visuelle Informationen wie Bilder oder Videos) dazu gehört. Eine Möglichkeit, ein Konstrukt zu operationalisieren, ist es, auf bekannte Testformate zu verweisen. So könnte man „Hörverstehen“ z. B. als „Erreichte Punktzahl im Test Z“ operationalisieren. Das ist dann eine handhabbare Möglichkeit, etwas zu messen, was auch leicht überprüft (oder sogar repliziert) werden kann.
Ein zweites Beispiel führen wir für korpusanalytische Untersuchungen an. Nehmen wir an, wir wollen auszählen, in welchen Satzarten bestimmte Modalpartikel vorkommen. Wenn z. B. die Beschreibung der Fälle, in denen eben als Modalpartikel angesehen wird (Männer sind eben so), nicht exakt genug ist, werden Adverbien mitgezählt (Eben war Fritz noch nüchtern).
Durch die Operationalisierung können Begriffe standardisiert und transparent dargestellt und eine Studie im Gesamtforschungskontext verortet werden. Die Prüfung der Operationalisierung soll daher auch bei zentralen Konstrukten in allen herangezogenen Forschungsstudien, auf die man selbst referiert, erfolgen.1
2.2Formulierung einer Forschungsfrage
Nach der Exploration wird (mindestens) eine Forschungsfrage bestimmt. Diese verdeutlicht möglichst präzise, worum es in der Studie geht; sie entwickelt sich aus dem Erkenntnisinteresse und der Literaturrecherche und spiegelt häufig den theoretischen Rahmen wider, in den die Studie eingebettet ist.
Nehmen wir an, wir interessieren uns für den Einfluss einer Sprachlernapp auf das Lernen des Unterschieds zwischen dem present perfect tense und dem simplepast tense im Englischen. Angemessen ist eine Fragestellung, die das Forschungsinteresse möglichst klar darstellt, z. B. „Lernen Schüler, die – nach derselben Einführung in den Unterschied zwischen den beiden Tempusformen – dazu zwei Stunden mit der Lernapp X üben, besser als Schüler, die im gleichen Zeitraum dieselben oder sehr ähnliche Übungen im Arbeitsbuch lösen, und zwar gemessen an der Leistung bei einem Entscheidungstest mit diesen beiden Tempusformen?“ Diese Frage sagt uns, (1) was der Forschungsgegenstand ist (Vergleich zwischen dem Lernen mit einer App und dem Lernen mit einem Arbeitsbuch in einer Situation, in der möglichst nur das Lernmedium verschieden ist), (2) wie der Forschungsgegenstand operationalisiert wird (Lernen des Unterschieds zwischen present perfect und simple past), und (3) wie „Lernenerfolg“ operationalisiert wird (Ergebnis bei einem Test, in dem die Schüler entscheiden müssen, ob die richtige Tempusform eingesetzt worden ist).1 Problematisch dagegen wäre eine Fragestellung wie die folgende: „Lernen Schüler besser mit Hilfe einer Sprachlernapp?“, denn diese Frage sagt uns weder, was unter „Lernen“ verstanden wird, noch was die Schüler lernen sollen (man kann z. B. relativ sicher sein, dass eine App weniger hilfreich ist, wenn man in der Fremdsprache streiten lernen möchte), noch wie man den Erfolg des Lernens feststellen will.
2.3Verortung und Gestaltung der Studie
Mit dem Formulieren einer Forschungsfrage müssen mehrere weitere Entscheidungen getroffen werden, bevor die Studie im Detail geplant werden kann. Denn welche Art von Frage man stellt, hängt vom Erkenntnisinteresse ab und beeinflusst das Untersuchungsdesign. Wir gehen nun auf zentrale Einordnungsmerkmale ein und erklären sie kurz.
2.3.1 Grundlagen- oder experimentelle Forschung?
Eine vertiefte Literaturrecherche ist notwendig, um zu entscheiden, ob man Hintergrundwissen zum Forschungsgegenstand aufbauen will, weil noch keine ausreichende Grundlage besteht, oder ob man untersuchen will, ob eine Änderung in der (Lern-/Lehr-)Situation etwas bewirken kann. Im ersteren Fall arbeitet man im Rahmen der Grundlagenforschung und versucht, weitere Informationen z. B. zum Verhalten von Personen oder zur sprachlichen Entwicklung einer Zielgruppe herauszufinden. In der experimentell ausgerichteten Interventions- und Evaluationsforschung, die auf solchen Grundlagen aufbaut, entwickelt die Forscherin bestimmte Maßnahmen im Lernkontext oder ändert bestimmte Variablen und untersucht, wie Personen (oft Lerner) darauf reagieren. Das Ziel ist also, einer Wirkung einer Variablen auf eine andere (Kausalität) nachzugehen. Der experimentellen Forschung widmen wir uns in Kapitel 8, weil sie eine ganz besondere Forschungskonstellation erforderlich macht.
2.3.2 Explorativ, beschreibend oder erklärend?
Welches Ziel verfolgt die Untersuchung: Soll das Forschungsinteresse neu erschlossen werden explorativ(explorativ)? Soll die Studie eine Begebenheit oder Population beschreiben deskriptiv(deskriptiv)? Oder soll eine Erklärung für bestimmte Phänomene gefunden werden erklärend(erklärend)?
Explorative Fragestellungen werden häufig in wenig erschlossenen Bereichen aufgestellt und sollen dazu dienen, der Forschungsgemeinschaft in einem Thema oder Forschungsfeld Orientierung zu bieten. Fragen wie „Wie empfinden Sprachlehrkräfte in Schulen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt die Unterrichtssituation in mehrsprachigen Lerngruppen?“ sind oft explorativ, weil so wenig über die Situation bekannt ist.
Eine deskriptive Studie ist dagegen fokussierter in der Ausrichtung und interessiert sich für die Beschreibung einer Begebenheit. Eine typische deskriptive Frage wäre: „Wie häufig erhalten Grundschüler mit türkischem Migrationshintergrund eine Gymnasialempfehlung?“ Viele deskriptive Fragen werden allerdings erst dann interessant, wenn sie korrelativkorrelativ formuliert sind. Eine korrelative Fragestellung fragt, welche Variablen häufig zusammenkommen, z. B. „Erhalten Grundschüler mit türkischem, russischem und italienischem Migrationshintergrund mit unterschiedlicher Häufigkeit eine Gymnasialempfehlung im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund?“





























