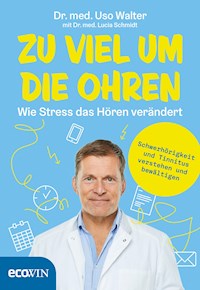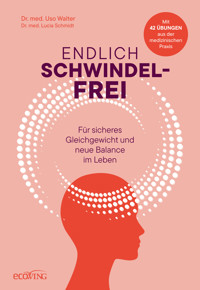
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Selbsthilfe bei Gleichgewichtsstörungen: Ein Ratgeber zur Diagnostik und Überwindung von Schwindelgefühlen Die Welt dreht sich, der Boden schwankt. Schwindel bringt uns körperlich und seelisch aus der Balance. Der HNO-Arzt Dr. Uso Walter zeigt in diesem Buch, zusammen mit der Journalistin und Ärztin Lucia Schmidt, welche Ursachen es für Störungen des Gleichgewichtssinns gibt und wie man diese behandeln kann. Ist es das Ohr, ein niedriger Blutdruck oder die Halswirbelsäule? Eine schnelle Diagnose ist oft schwierig, denn die Schwindelarten und Ursachen für Schwindelgefühle sind ebenso vielfältig wie Begleiterscheinungen in Form von Benommenheit, Übelkeit oder Sehstörungen. Dieser Ratgeber für Gesundheit bietet praktische Hilfe bei Schwindel mit leicht durchführbaren Übungen sei es bei Dreh- und Lagerungsschwindel, phobischem Schwankschwindel, Altersschwindel, Schwindel durch Verspannungen oder einem Hörsturz. - Alltagstaugliche Übungen bei Gleichgewichtsstörungen und plötzlichen Schwindelattacken - Das Phänomen Schwindel: Ursachen der eigenen Beschwerden erkennen und verstehen - Viele praktische Tipps vom Schwindelexperten - Schwindelgefühle und ihre Ursachen: Wertvolle Informationen zum besseren Verständnis des Gleichgewichtssinns - Glossar mit kurzen Erklärungen der wichtigsten Fachbegriffe Für das sichere Gefühl, mit beiden Beinen auf festem Boden zu stehen: Praktische und leicht anwendbare Methoden zur Selbsthilfe Anhand von Fallbeispielen aus der HNO-Praxis erklärt Dr. Uso Walter die verschiedenen Arten von Schwindel und welche Methoden helfen, wieder ins Lot zu kommen, sich nicht mehr schwummrig im Kopf und wackelig zu fühlen und endlich wieder schwindelfrei zu werden. Der Ratgeber liefert Informationen und zahlreiche Übungen zum Gleichgewichtstraining und macht Sie sicherer im Umgang mit Ihren Beschwerden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ENDLICH SCHWINDELFREI
Dr. med. Uso Walter
Dr. med. Lucia Schmidt
ENDLICH SCHWINDELFREI
Für sicheres Gleichgewicht und neue Balance im Leben
INHALT
Willkommen!
KAPITEL 1
Schädigung des Innenohrs – Wenn der Schwindel nicht mehr verschwindet
KAPITEL 2
Lagerungsschwindel – Wenn Bewegung den Schwindel auslöst
KAPITEL 3
Altersschwindel – Wenn der Gleichgewichtssinn in die Jahre kommt
KAPITEL 4
Hörsturz – Wenn der Schwindel einen plötzlich überfällt
KAPITEL 5
Morbus Menière – Wenn Schwindelanfälle immer wieder kommen
KAPITEL 6
Schritt für Schritt zur richtigen Diagnose
KAPITEL 7
Neurologische Probleme – Wenn der Schwindel reine Kopfsache ist
KAPITEL 8
Verspannungen – Wenn der Schwindel von den Muskeln kommt
KAPITEL 9
Funktioneller Schwindel – Wenn die Angst einen aus dem Gleichgewicht bringt
KAPITEL 10
Vestibularisausfall – Wenn ein Gleichgewichtsorgan die Arbeit einstellt
KAPITEL 11
Vier Säulen der Therapie
KAPITEL 12
Woher kommt mein Schwindel?
KAPITEL 13
Aktiv werden – Übungen für Ihren Alltag
Glossar
Die Autoren
WILLKOMMEN!
Eigentlich liegt es einem Arzt fern, mit dem einen Patienten mehr Mitgefühl zu haben als mit dem anderen. Jede Erkrankung bedeutet Leid für den Betroffenen, und jeder Betroffene ist in Not. Trotzdem muss ich gestehen: Wenn vor mir ein Patient sitzt, der an Schwindel leidet, dann merke ich schon, wie mich das berührt. Jeder von uns, der schon mal einen über den Durst getrunken hat, weiß, wie unangenehm es ist, wenn man nicht mehr so recht weiß, wo oben und unten ist, wenn sich jeder Schritt anfühlt, als würde man in Wackelpudding treten, wenn man beim Drehen des Kopfes den Eindruck bekommt, dass die Augen nicht mehr folgen können und die Bilder, die im Gehirn ankommen, mehr Unruhe stiften als klare Sicht.
Schwindel, und das muss man an dieser Stelle klar betonen, ist eine verdammt unangenehme Empfindung. Er erschüttert unser Sicherheitsgefühl zutiefst. Wenn wir eines von Kindesbeinen an verinnerlicht haben, dann, dass unsere beiden Füße fest auf der Erde stehen, dass man sich auf die Informationen der Augen, was Raum und Weite angeht, verlassen kann, dass unser Gleichgewichtssinn uns ohne jeden Zweifel Orientierung in der Welt gibt. Wer an Schwindel leidet, dem fehlt dies alles von jetzt auf gleich. Für diejenigen, die es besonders schlimm erwischt, gibt es keine Position mehr, weder im Liegen noch im Sitzen, geschweige denn im Stehen, in der sie wirklich Halt finden.
Ein Schwindelpatient, den es so grundlegend und buchstäblich aus dem Gleichgewicht geworfen hat, macht mich in der Sprechstunde schon wirklich betroffen. Das besonders Gravierende: Gehen diese Menschen zum Arzt, erhalten sie nicht immer die schnelle Diagnose und erfolgreiche Behandlung, die sie sich wünschen. Denn die Ursachen für Schwindel sind vielfältig und selbst für spezialisierte Ärzte wie mich ist jeder Schwindelpatient eine neue Herausforderung.
Doch jedes Mal nehme ich diese Herausforderung wieder gern an, denn bei jedem Patienten kann ich noch etwas Neues lernen über das Phänomen Schwindel. Und alles, was ich bisher gelernt habe, will ich in diesem Buch mit Ihnen teilen. Natürlich wollen wir erst einmal über Ursachen und Folgen von Schwindel sprechen, aber dann vor allem auch über Lösungen und sinnvolle Therapieansätze. Denn die gute Nachricht lautet: Hilfe ist möglich!
Gleichgewichtsstörungen und Schwindel sind nach Schmerzen der zweithäufigste Grund für einen Arztbesuch. Jeder Zweite leidet mindestens einmal im Leben unter diesem unangenehmen Symptom. Da Angst den Schwindel verstärken kann, entsteht schnell ein Teufelskreis, aus dem Betroffene aus eigener Kraft nur schwer wieder herausfinden. Deshalb soll dieses Buch Ihnen auch praktikable und leicht umsetzbare Methoden zur Selbsthilfe bieten. Einige dieser Tipps stammen aus persönlichen Erfahrungen von Betroffenen, die ihren Schwindel wieder in den Griff bekommen haben.
Aber wir wollen uns nicht nur damit beschäftigen, was passiert, wenn der Gleichgewichtssinn nicht mehr richtig funktioniert, sondern auch damit, was er tagtäglich für uns leistet. Denn wissen Sie, warum wir auch im Stockdunklen geradeaus gehen können oder warum wir die kurze Beschleunigung eines Sportwagens beim Start so intensiv spüren, aber nicht die Geschwindigkeit von über 1000 km/h, wenn wir entspannt in einem Flugzeug sitzen? Oder warum unser Blickfeld auch bei der wildesten Tanzeinlage immer stabil bleibt?
All das und noch viel mehr leistet unser Gleichgewichtssinn für uns. Solange er gut funktioniert, hilft er uns, klar zu sehen und uns zielgerichtet zu bewegen. Er gibt uns Orientierung und Halt, er warnt uns vor Gefahren.
Lassen Sie sich also mitnehmen auf eine spannende Reise durch die Welt des Schwindels und des Gleichgewichts und erkunden Sie mit uns gemeinsam die Möglichkeiten, wieder in Balance zu kommen und endlich wieder schwindelfrei zu sein. Bevor Sie nun aber eintauchen in die Welt des Gleichgewichtssinns, noch ein paar einordnende Worte. Wir haben versucht, medizinische Zusammenhänge, Untersuchungsmethoden und Diagnosen so verständlich wie möglich zu beschreiben, denn es geht uns ja darum, dass Sie am Ende des Buches gut informiert sind und kompetenter mit Beschwerden umgehen können. Aber nicht immer sind wir ganz um Fachbegriffe herumgekommen. Damit Sie während der Lektüre auf die Frage »Was war das noch mal?« eine schnelle Antwort erhalten, gibt es am Ende des Buches ein Glossar mit kurzen Erklärungen zu den wichtigsten Begriffen. Außerdem ist es uns wichtig zu betonen, dass wir aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit in diesem Buch nur die männliche Form nutzen. Das ist kein Akt der Diskriminierung oder Ignoranz. Wir meinen mit der männlichen Form selbstverständlich jede Form der geschlechtlichen Identität. Und zuallerletzt: Dieses Buch soll informieren, aufklären und unterhalten. Außerdem soll es Sie im besten Fall zum Profi für Ihre Beschwerden oder die Ihrer Herzensmenschen machen. Aber es ersetzt keinen Besuch beim Arzt. Jetzt aber legen wir los.
1
SCHÄDIGUNG DES INNENOHRS
Wenn der Schwindel nicht mehr verschwindet
Als Frau P. zum ersten Mal in meine Praxis kam, konnte sie kaum geradeaus gehen. Sie hielt sich an ihrem Mann fest und starrte vor sich auf den Boden. Sie berichtete, dass sie seit mehr als drei Monaten unter ständigem Schwindel leide. Sobald sie sich bewege, schwanke der Raum um sie herum und sie könne sich kaum auf den Beinen halten. Selbst fernsehen könne sie nicht mehr, da die schnelle Abfolge der Bilder auf dem Schirm den Schwindel sofort verstärken würde. Sie sei schon bei mehreren Fachärzten gewesen, aber die Tabletten, die sie bekommen habe, hätten ihr kaum geholfen. Es seien auch schon viele Untersuchungen gemacht worden, unter anderem eine Computertomografie und eine Kernspintomografie des Kopfes und der Halswirbelsäule. Bisher sei aber immer alles in Ordnung gewesen. Sie berichtete weiter, dass sie nicht mehr in ihrem Beruf als Erzieherin arbeiten könne und die Hoffnung auf Besserung schon fast aufgegeben habe. Sie sei jetzt zu mir gekommen, weil eine gute Freundin ihr das empfohlen habe. Sie wisse wirklich nicht mehr weiter und ich sei ihre letzte Hoffnung.
Ehrlich gesagt, ist es mir immer ein bisschen unangenehm, wenn Patienten mich als »letzte Hoffnung« bezeichnen. Die Erwartungshaltung ist dann sehr hoch und die Verzweiflung der Betroffenen meist auch. Bevor ich mit der Untersuchung überhaupt beginne, ist es in solchen Situationen deshalb meine erste Aufgabe, einerseits realistische Hoffnungen auf eine Lösung des Problems zu machen, andererseits aber auch nicht zu viel zu versprechen. Beides versuchte ich auch bei Frau P., die mir verängstigt gegenübersaß und sich an die Stuhllehne klammerte, als hätte sie Angst, selbst im Sitzen umzufallen.
Ich fragte sie, ob sie beim ersten Auftreten des Schwindels andere Symptome wie Hörstörungen, Sehstörungen oder Verspannungen gehabt habe und in welcher Situation ihr erstmalig schwindelig geworden sei. Verspannt sei sie schon immer gewesen, antwortete die 50-Jährige, das sei normal bei der Arbeit im Kindergarten. Ansonsten habe es vor dem erstmaligen Auftreten des Schwindels keine besonderen Umstände gegeben, erzählte sie weiter. Ihr sei eines Tages plötzlich und unerwartet in der Kaffeepause schwindelig und übel geworden, und sie habe sich hinlegen müssen, um nicht umzufallen. Alles habe sich um sie gedreht. Ihre Kolleginnen hätten dann einen Krankenwagen gerufen, weil sie befürchtet hätten, dass sie einen Schlaganfall erlitten habe. Das sei im Krankenhaus aber zum Glück ausgeschlossen worden. Sie habe Medikamente bekommen und sei drei Tage im Krankenhaus geblieben. Danach sei der Schwindel in Ruhe etwas besser geworden, sobald sie sich aber wieder bewege, komme er zurück. Im Entlassungsbrief der Klinik sei nur von einem akuten Schwindelanfall die Rede gewesen. Der Hausarzt habe ihr daraufhin Tabletten verschrieben und ihr mehrere Überweisungen zu Fachärzten mitgegeben.
Es waren Überweisungen zum Neurologen, zum Augenarzt, zum HNO-Arzt, zum Radiologen und zum Orthopäden. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie so verzweifelt vor mir saß, war sie also schon in mehreren Praxen gewesen – beim Augenarzt, beim Radiologen und beim Neurologen. Nun war ich als HNO-Arzt an der Reihe. Der Termin beim Orthopäden sollte in zwei Monaten sein.
Auch wenn jetzt vielleicht bei vielen von Ihnen, liebe Leser, ein Impuls von Mitleid hochkommt und Sie denken: »Oh weh, Frau P. hat es aber hart getroffen«, muss ich festhalten, dass ihr Leidensweg bis zu dieser Stelle leider die Regel und nicht, wie man hoffen würde, die Ausnahme ist. Da der Schwindel im akuten Stadium oft als sehr bedrohlich empfunden wird, werden die Betroffenen häufig ins Krankenhaus eingewiesen und stationär aufgenommen. Dort wird zunächst eine Computertomografie durchgeführt, um einen Schlaganfall auszuschließen. Ansonsten erfolgt eine symptomatische Behandlung mit Medikamenten, die den Schwindel zumindest etwas unterdrücken können. Das Problem: Gerade in diesen ersten Stunden und Tagen des ganz akuten Stadiums ließe sich die Ursache des Schwindels oft mit einfachen Untersuchungen feststellen. Doch je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger kann dies werden. Ein Krankenhausaufenthalt verzögert die richtige Diagnose daher oft eher, als dass er sie beschleunigt. In der Klinik wird in der Regel nämlich nur geschaut, ob es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt – etwa Blutungen im Gehirn oder andere neurologische Ursachen. Den harmloseren, aber viel häufigeren Diagnosen wird dort nicht auf den Grund gegangen.
Auch das, was Frau P. nach der Entlassung in der Klinik erlebt hat, ist typisch. Hausärzte überweisen Patienten mit Schwindel zu Recht an Fachärzte – denn in deren Hände gehört das Symptom Schwindel. So weit, so gut, das Problem, vor dem viele dann mit der Überweisung des Hausarztes in der Hand stehen, ist jedoch: Termine bei Fachärzten sind hierzulande, gerade für Kassenpatienten, schwer zu bekommen. Die fehlende Möglichkeit, direkt mit einem Experten ins Gespräch zu kommen und behandelt zu werden, ist bei jedem Leid absolut suboptimal, beim Symptom Schwindel aber besonders relevant, denn wird dieser nicht schnell und zielgerichtet behandelt, wird er rasch zum Dauerproblem. Es ist leider so: Überhaupt erst einmal denjenigen Arzt zu finden, der einem bei Schwindel wirklich helfen kann, gleicht für viele betroffene Patienten schon einer großen Odyssee.
Doch woran liegt es, dass Schwindel oft so schwer zu diagnostizieren ist und selbst erfahrene Ärzte Schwierigkeiten haben, die Ursache zu finden? Werfen wir dazu zunächst einen kurzen Blick auf die Aufgaben und die Funktionsweise unseres Gleichgewichtssinnes. Denn nur, wer verstanden hat, wie er eigentlich funktionieren sollte, kann auch verstehen, was die Ursache ist, wenn er nicht mehr rundläuft.
WARUM GLEICHGEWICHT HALTEN ECHTE TEAMARBEIT IST
Wir beginnen dafür nicht bei Adam und Eva, aber immerhin bei dem griechischen Gelehrten Aristoteles. Er unterschied damals beim Menschen fünf Sinne: das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Tasten. Was Aristoteles damals festlegte, hat sich bis heute gehalten – fälschlicherweise! Denn einen Sinn hat der griechische Philosoph schlichtweg unterschlagen, nämlich den Gleichgewichtssinn. Gott sei Dank hat sich das Wissen dahingehend weiterentwickelt, dass man heute weiß: Wir haben (mindestens) sechs Sinne.
Nur durch den Gleichgewichtssinn können wir wahrnehmen, wie wir in einem Raum stehen, sitzen oder liegen. Wir können kontrollieren, dass wir erhobenen Hauptes durch eine Tür gehen oder uns auf ein Sofa fläzen, ohne runterzufallen. Er ist aber auch dafür verantwortlich, dass wir auf einer Leiter stehen und dabei etwas ins Regal räumen können oder nicht umfallen, wenn wir uns zum Schuhebinden bücken. Alles schon ziemlich beeindruckend bis hierher, oder? Aber jetzt kommt das einzigartige und spannende Merkmal des Gleichgewichtssinnes, das zugleich auch Teil der Antwort ist, warum Schwindel so schwer zu diagnostizieren ist: Im Gegensatz zu den anderen Sinnen ist für das Gleichgewicht nicht ein einzelnes Organ zuständig, sondern gleich mehrere Organ- und Funktionssysteme, die als Team eng zusammenarbeiten müssen, damit wir eben nicht durch die Gegend torkeln.
Wir möchten Ihnen kurz vorstellen, wer zu diesem Team gehört. Da hätten wir zum einen die eigentlichen sogenannten Gleichgewichtsorgane oder Vestibularorgane im Innenohr. Ihre Hauptaufgabe ist es, Beschleunigungskräfte, die bei Bewegungen von Kopf oder Körper auftreten, wahrzunehmen und diese Info ans Gehirn weiterzugeben.
Nummer zwei im Team sind die Augen, sie liefern uns das optische Bild unserer Umgebung und unserer eigenen Position.
Ebenfalls Teil des Teams ist das propriozeptive System. Zu diesem zählen kleine Messfühler in Muskeln, Sehnen und Gelenken, sogenannte Rezeptoren, die die Gelenkstellung und Muskelspannung im Körper registrieren. Damit tragen sie dazu bei, dass wir spüren, wie wir stehen, liegen oder sitzen. Diese Selbstwahrnehmung nennt man auch Tiefensensibilität.
Und schließlich gehört zu dem Team noch das Gehirn. Man kann fast sagen, es ist der Chef in der Gruppe, denn seine unterschiedlichen Teile haben die entscheidende Aufgabe, all die Informationen, die ihm die Teamkollegen zukommen lassen, zu sammeln, zu sortieren und wie ein Puzzle zu einem Gesamteindruck zusammenzusetzen – oder anders ausgedrückt: uns im Gleichgewicht zu halten.
Solange dieses Team Hand in Hand arbeitet, sind Orientierung und Bewegung im Raum für uns mühelos möglich. Doch wehe, ein Teammitglied schwächelt oder liefert falsche Angaben. Dann passen die Informationen, die das Gehirn erreichen, nicht mehr zusammen, dann wird daraus kein sinnvolles Puzzle – und wir nehmen das als Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen wahr. Je nachdem, welches Teammitglied schwächelt oder wo eine Information nicht richtig weitergeleitet wird, können die Folgen unterschiedlich sein. Das erklärt, warum es so wichtig ist, als Arzt zu verstehen, wie das Schwindelgefühl konkret aussieht, in welcher zeitlichen Abfolge es auftritt und welche Beschwerden noch dazukommen.
SCHWINDEL IST NICHT GLEICH SCHWINDEL
Wir nutzen im Alltag für ganz unterschiedliche Empfindungen häufig dasselbe Wort, doch Schwindel ist nicht einfach Schwindel. Er kann sich anfühlen, als drehe sich alles nach rechts oder nach links, aber auch, als schwanke alles mal in die eine, mal in die andere Richtung. Manche Patienten empfinden es so, als stünden sie bei hohem Seegang auf einem kleinen Boot, würden bei jedem Schritt in weichen Schnee treten oder immer stark in eine Richtung gezogen. Auch der zeitliche Verlauf, also wann, wie häufig und in welchem Zusammenhang Schwindel auftritt, kann extrem unterschiedlich, für die Diagnose aber sehr entscheidend sein.
Als besonders bedrohlich empfinden Patienten jene Art von Schwindel, die plötzlich und anfallsartig auftritt. Solche Anfälle können täglich oder auch in großen Abständen auftreten. Sie können nur Sekunden, aber auch mehrere Tage andauern. Mancher Schwindel hört gar nicht mehr auf, manchmal führt der längere Blick auf einen Bildschirm oder auf ein flackerndes Licht zu Schwindelanfällen. Sie merken schon an dieser Stelle, um es noch mal zu betonen: Schwindel ist nicht gleich Schwindel. Deshalb ist es für mich als Arzt wichtig, zu verstehen, unter welcher Art der Patient leidet. Nur die Aussage »Mir ist schwindelig« bringt mich in einer Diagnostik kaum weiter.
Neben dem Verständnis, unter welchem Schwindelgefühl genau jemand leidet, geht es auch um die Begleitsymptome. Denn als wäre Schwindel allein nicht schon belastend genug, kommen häufig noch Übelkeit, Müdigkeit und vor allem Angst dazu. Das liegt daran, dass Schwindel und Gleichgewichtsstörungen immer etwas Bedrohliches an sich haben. Man verliert dabei die Kontrolle über seinen Körper, fühlt sich hilflos, bewegungsunfähig und instabil. Das führt zu Stress und Angst, beides typische und evolutionär eigentlich so sinnvolle wie notwendige Reaktionen des Organismus, wenn Gefahr droht. Denn das ist auch bei Schwindel der Fall: Die Gefahr von Stürzen und Verletzungen steigt, wenn sich alles dreht. Man ist nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich hilfloser und kann sich im Zuge dessen nicht mehr gegen andere Bedrohungen zur Wehr setzen. Der Körper reagiert also logisch, beim Betroffenen wird das Leid dadurch aber nur größer. Zum gestörten Gleichgewicht kommen Herzrasen, Übelkeit und Panikgefühle.
Neben diesen Stress- und Angstsymptomen können noch weitere Beschwerden auftreten. Welche genau, ist davon abhängig, welches der gerade vorgestellten Teammitglieder für den Schwindel hauptverantwortlich ist. Sind das etwa die Augen, kann es zu Sehstörungen und Doppelbildern kommen, die mit dem Schwindel einhergehen. Aber auch Verspannungen, Kopfschmerzen, Hörschäden und Ohrgeräusche können mir als Arzt einen Hinweis geben, wer im Team nicht mehr richtig mitspielt.
Ich kann es deshalb an dieser Stelle nur erneut betonen: Mit der Aussage »Mir ist schwindelig« allein wird der Arzt keine korrekte Diagnose stellen können. Je genauer der Patient seine Beschwerden schildert, desto eher kann der behandelnde Arzt Rückschlüsse auf die Ursache des Schwindels ziehen. Deshalb finden Sie am Ende dieses Buches einen Fragebogen und übersichtliche Darstellungen zu Symptomen und möglichen Auslösern – alles Hilfestellungen, damit auch Sie leichter herausfinden können, was die Ursache für Ihren Schwindel ist.
Vielleicht ist sie Ihnen aber auch eine Hilfe, wenn es darum geht, den richtigen Arzt zu finden. Am Beispiel meiner Patientin Frau P. kann man sehen, wie viele Ärzte Betroffene oft schon besucht haben. Auch hierzu würde ich Ihnen gerne die ultimative, schnelle Checkliste an die Hand geben, aber das ist leider nicht so einfach. Denn da ein ganzes Team an Organen und Funktionssystemen am Schwindel beteiligt sein kann, wird kein Arzt alles sofort im Blick haben. Für jedes System ist nämlich ein bestimmter Mediziner zuständig. Ärzte, die sich auf all diese Systeme gleichzeitig spezialisiert haben, gibt es nicht. Der Facharzt für Schwindel muss erst noch erfunden werden. Oft bleibt dem Patienten, so leid mir das tut, also nichts anderes übrig, als einen Facharzt nach dem anderen zu besuchen.
So viel jedoch lässt sich sagen: Die häufigsten Schwindelursachen sind entweder Störungen des Gleichgewichtsorgans oder des Gehirns und seiner Nervenverbindungen. Bei akuten Schwindelbeschwerden, die anfallsartig auftreten, oder bei dauerhaftem Schwindel, der sich überwiegend als Drehschwindel bemerkbar macht, liegen häufig Funktionsstörungen der Gleichgewichtsorgane im Innenohr vor. Bei chronischen, eher unspezifischen Schwindelbeschwerden sind es hingegen eher neurologische Ursachen. Deshalb möchte ich Ihnen zumindest folgende Formel an die Hand geben: Der Hausarzt ist immer eine gute erste Anlaufstelle, dann sollten HNO-Arzt und Neurologe folgen und dann erst die anderen Fachgruppen oder Röntgenuntersuchungen.
Wenn man weiß, dass Schwindelbeschwerden nach Schmerzen der zweithäufigste Grund für Arztbesuche sind und laut der Deutschen Hirnstiftung rund 40 Prozent aller Menschen mindestens einmal im Leben an Schwindel leiden, Frauen häufiger als Männer, dann könnte man sich schon überlegen, ob die Einführung eines Schwindelfacharztes nicht sinnvoll wäre. Schmerzmediziner gibt es mittlerweile ja auch. Aber unabhängig davon, wer sich am Ende des Patienten annimmt, haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, warum ausgerechnet Schwindel so häufig auftritt? Der Körper kann ja an vielem leiden, warum also leidet er gerade daran so oft?
Die Antwort, dass jeder schon mal zu tief ins Glas geguckt hat oder bei Wellengang auf einem Schiff war, lasse ich dabei nicht gelten. Die Wissenschaft kennt nämlich einen anderen, viel spannenderen Grund. Er liegt in unserer Evolutionsgeschichte.
Der Mensch ist das einzige Säugetier, das auf zwei Beinen geht und das – zumindest nach evolutionären Maßstäben – noch gar nicht so lange. Wahrscheinlich 3,5 bis 7 Millionen Jahre vor unserer Zeit trennten sich die Entwicklungslinien von Menschen und Affen, und irgendwann in diesem Zeitraum begannen unsere Vorfahren, sich aufzurichten. Das hatte mehrere Vorteile. Der aufrechte Gang verhalf einerseits zu einem besseren Überblick in der Steppe, andererseits zu besserem Halt beim Klettern auf Bäume und größerer Reichweite bei der Fortbewegung. Einen gravierenden Nachteil hat der aufrechte Gang aber auch: Es ist wesentlich instabiler, sich auf zwei Beinen fortzubewegen als auf vier. Dazu muss man nur Kleinkinder beobachten, die ihre ersten Gehversuche starten. Sie brauchen Wochen, manchmal Monate, um sich sicher zu bewegen. Unzählige Male fallen sie dabei hin und richten sich wieder auf. Dieser Wille und dieses Durchhaltevermögen sind bewundernswert, davon könnte man sich auch als erwachsener Mensch ab und zu mal eine Scheibe abschneiden. Aber zurück zum Gleichgewicht: Dieses zu halten, ist für uns Menschen deutlich anspruchsvoller als für Vierbeiner – und entsprechend ist das System auch störanfälliger.
Genau wie zu Beginn des Lebens machen sich auch gegen Ende die Nachteile der Zweibeinigkeit für die Stabilität bemerkbar. Ältere Menschen stürzen häufiger, können sich oft ohne Stock oder Rollator nicht mehr sicher fortbewegen. Sie werden also aus unterschiedlichen Gründen wieder instabiler, das Sturzrisiko steigt ab dem 80. Lebensjahr exponentiell an.
DER GLEICHGEWICHTSSINN SCHWÄCHELT
Kommen wir zum Ende dieses Kapitels noch einmal auf meine Patientin Frau P. zurück. Sie hatte ja berichtet, dass sie zunächst akut und ohne einen erkennbaren Auslöser unter starkem Drehschwindel mit Übelkeit gelitten habe. Wie wir gerade festgehalten haben, werden diese Symptome häufig durch eine Funktionsstörung der Gleichgewichtsorgane im Innenohr ausgelöst. Als HNO-Arzt sollte ich ihr also eigentlich helfen können. Um sicher und schnell einen eventuellen Schaden des Innenohres festzustellen, sah ich ihr deshalb zunächst mit dem Mikroskop in die Ohren und machte dann einen Kopfimpulstest.
Dabei handelt es sich um einen einfachen medizinischen Test, bei dem der Patient dem Untersucher gegenübersitzt und dessen Nase fixiert. Der Blick soll auch dann auf die Nase gerichtet bleiben, wenn der Kopf hin und her bewegt wird. Der Untersucher nimmt dann den Kopf des Patienten zwischen seine Hände und macht mehrere kleine, aber möglichst schnelle, ruckartige Bewegungen des Kopfes zur Seite. Gelingt es dem Patienten dabei, weiter die Nase zu fixieren, ist alles in Ordnung. Folgt der Blick aber zunächst der Bewegung des Kopfes und fixiert erst dann erneut die Nase des Untersuchers, spricht das für eine Funktionseinschränkung des gleichseitigen Gleichgewichtsorgans. Neurologische Ursachen sind damit sicher ausgeschlossen.
Erstmals beschrieben haben diese Untersuchung die beiden Ärzte Halmagyi und Curthoys im Jahr 1988. Der Test beruht darauf, dass die Gleichgewichtsorgane unsere Augenbewegungen steuern, um das Bild selbst bei schnellen Kopfbewegungen stabil zu halten. Insgesamt drei Reflexe sind hierfür verantwortlich. Derjenige, der beim Kopfimpulstest untersucht wird, nennt sich vestibulookulärer Reflex. Er ist der schnellste Reflex des Menschen und bewegt die Augen bereits nach 7,5 Millisekunden entgegen der Richtung der Kopfdrehung. Dadurch können die Augen auch bei sehr hohen Drehgeschwindigkeiten des Kopfes von 400 Grad pro Sekunde einen Punkt fixieren und damit das Blickfeld stabil halten.
Als ich diese Untersuchung bei Frau P. durchführte, stellte ich fest, dass ihr rechtes Gleichgewichtsorgan nicht mehr richtig funktionierte. Bei der ruckartigen Bewegung des Kopfes nach rechts fixierte sie für einen Moment nicht mehr meine Nase, ihre Augen folgten stattdessen kurz der Drehung des Kopfes. Die Diagnose lautete daher Vestibulopathie rechts, was übersetzt so viel heißt wie: »Das Gleichgewichtsorgan im rechten Innenohr (Vestibularorgan) ist krank (pathologisch).«
Ist die Diagnose einer solchen einseitigen Vestibulopathie einmal gestellt, ist die Behandlung in der Regel einfach. In der akuten Phase können hochdosierte Kortisongaben helfen. Das ist dasselbe Vorgehen wie beim Hörsturz, denn beide Erkrankungen sind sehr ähnlich: Der Hörsturz ist definiert als »akuter, einseitiger Hörverlust ohne erkennbare Ursache«. Die Vestibulopathie könnte man analog als »akute, einseitige Schädigung eines Gleichgewichtsorgans ohne erkennbare Ursache« definieren.
Bei Frau P. lag der Beginn der Erkrankung jedoch schon einige Monate zurück und eine ursächliche Behandlung kam deshalb nicht mehr infrage, da das Gleichgewichtsorgan bei einer dauerhaften Schädigung nicht einfach repariert werden kann. Sinneszellen im Innenohr wachsen nämlich bei einer Schädigung nicht einfach nach, wie beispielsweise Hautzellen bei einer Schnittverletzung. Sind sie erst mal zerstört, bleibt der Schaden bestehen. Zum Glück kann das Gehirn aber lernen, damit umzugehen und trotz fehlender oder fehlerhafter Informationen einen Gleichgewichtszustand herbeizuführen. Dazu bedarf es allerdings spezifischer therapeutischer Maßnahmen, die wir in Kapitel 11 (siehe Seite 159) noch