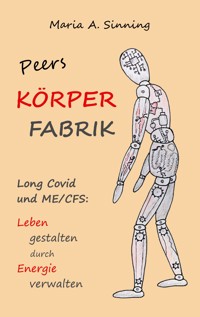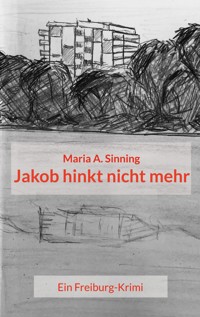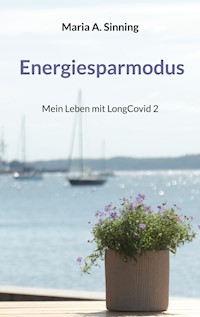
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nach einer Coronainfektion erkrankt Maria A. Sinning schwer an LongCovid. Was bis dahin ihr Leben ausgemacht hat, ist schlagartig zu Ende. Nun muss sich die unternehmenslustige Frau in einer Krankheit zurecht finden, die sie zu strenger Ruhe verpflichtet. Bildhaft und anhand ihrer eigenen Geschichte erzählt sie humorvoll davon, viel mehr Lebenslust als körperliche Kraft zu besitzen, und bringt die Krankheit LongCovid nahe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Kapitel 1: Mit Bildern die Krankheit verstehen
Mitten in der Bahnhofshalle
Vegetarisch-abstinentes Pacing
Das „Mailänder Parkhaus-Problem“
Das „Klassensprecher-Syndrom“
Von der Stauforschung lernen
Mein „Lebensregal“
Kapitel 2: Alltag mit LongCovid
Wiedereingliederung
„Sieht man Ihnen aber gar nicht an!“
Shoppen
Kapitel 3: Krankheit und Seele
Gelb reicht auch
Der Fortschritt ist ein Faultier
Fehlende Behandlung
Verschiedene Krankheitsbilder
„Nicht alle Tassen im Schrank“
Exkurs: Wo bleibt mein Wunder? - Glaube, Bibel und LongCovid
Ein echter Hiob
Wasser in Wein wandeln (Joh 2)
„Steh auf, nimm dein Bett und geh“ (Mk2)
Kapitel 4: Urlaub mit LongCovid
Die Anreise
Fast normale Tage
Nichts ist normal
Ein Kauf mit Symbolgehalt
Abhängig sein
Angehörige haben es auch nicht leicht
Das Grab meiner Mutter
Unter Gleichen
Heimkehr
Einführung
Es hätte auch schöne Krankheiten gegeben. Im Vergleich zu LongCovid verklärt sich zum Beispiel meine Knieverletzung im Rückblick zu sechs wunderbaren Wochen.
Eine Sportverletzung hatte meine noch junge Karriere als Kitesurferin jäh beendet. Und ja, das Knie tat danach unglaublich weh. Dass Knieschmerzen sogar noch intensiver sein können als ein veritabler Bandscheibenvorfall, erfuhr ich beim erstversorgenden Arzt. Der war unglücklich an meinen Fuß gestoßen, und hatte damit eine Drehbewegung im Knie ausgelöst. Wie höllisch weh dieser kurze Moment tat, erfuhr auch gleich die ganze Praxis. Meine Frau hatte meinen Schrei im Wartezimmer miterlebt. Sie meinte, diverse Wartende hätten hinterher ausgesehen, als überlegten sie sich, doch vorsichtshalber einen anderen Arzt aufzusuchen. Auch die anschließenden Wochen zuhause waren schmerzhaft, und ich habe viel geflucht und wollte endlich wieder laufen können.
Aber gleichzeitig beschenkte mich das kaputte Knie mit sechs ruhigen Wochen. Endlich hatte ich Zeit, so viele Bücher zu lesen, wie ich wollte. Eswar ein wunderschöner Sommer und ich lag lesend im Garten. Nachmittags, wenn meine Frau von der Arbeit heim kam, humpelte ich mit ihr die 500m zu unserem Badesee und wir betrieben Muskelaufbau und Training im Wasser. Unsere Nachbarin lieh mir ihr dreirädriges Fahrrad. Mit ihm konnte man genau die richtige Bewegung fürs Knie machen ohne Angst vor dem Absteigen haben zu müssen. Und es hatte höchst witzige Fahreigenschaften. Mit dem Gefährt um Kurven zu fahren hatte was von den Achterbahnen im „Europapark“. Nur, dass ich dafür nicht einmal bezahlen musste!
So einen sekundären Krankheitsgewinn hatte ich mir anfangs bei LongCovid auch vorgestellt. Als mich die Ärztin am 3. Januar 2022 das erste Mal für vier Wochen krank schrieb, malte ich mir aus, wie ich zwar wahnsinnig viel schlafen würde, aber noch genug Kapazität hätte, was zu lesen, Klavier zu spielen, etwas spazieren zu gehen und aufzuräumen. Da hatte ich mich gründlich geirrt.
Statt dessen war die Krankheit wochenlang nur aushaltbar, wenn man die meiste Zeit des Tages auf dem Sofa lag und wirklich gar nichts tat: keine Musik hörte, nichts las, nichts bastelte, sich praktisch nicht bewegte, fast kein Fernseher lief.
Wenn ich auch nur das Haus verließ, brach mein Körper komplett zusammen. Stundenlang zitterten alle Nerven, tagelang tat alles weh, jeder Muskel, jeder Nerv, der Kopf sowieso. Ich bekam nicht mehr richtig Luft. Das Gehirn war viel zu benebelt, um sich noch auf irgendetwas konzentrieren zu können. Stundenlang lag ich apathisch auf dem Sofa und konnte nichts mehr.
Strenges Pacing und endlos lange Fastentage führten schließlich millimeterweise zur Besserung. Pacing ist ungefähr das, was Sie vom guten Umgang mit der Basilikumpflanze in der Küche kennen: Immer nur so viele Blätter nehmen, dass sich die Pflanze erholen kann. Nie alle Blätter auf einmal nehmen. Das Gleiche gilt für das postvirale Fatigue-Syndrom: immer Energie übrig lassen, nie alles auf einmal aufbrauchen. Sonst geht die Energiepflanze ein. Aber wenn man die Blätter nur in Maßen pflückt, können sie nachwachsen und gedeihen. Und eines Tages reicht es vielleicht sogar für leckeres Basilikum-Energie-Pesto.
Auf den Tag genau sechs Monate nach der Infektion hatte ich mich so weit erholt, dass ich das erste Mal dachte: „Heute war so ein Tag, wie dudir die Krankheit ursprünglich vorgestellt hast.“ Es blieb für lange Zeit der einzige.
„Was für eine tolle Krankheit“ habe ich das erste Mal etwa nach sieben Monaten gedacht – für zwei Minuten. Dann wollte ich irgendetwas tun, was weit jenseits meiner Möglichkeiten lag, und es war wieder vorbei mit dem Gedanken. Zwar lerne ich, halbwegs positiv an diese Krankheit heranzugehen, und sie lehrt mich auch manches, das ich nicht wieder hergeben möchte, auch wenn ich eines Tages gesund sein werde. Aber schön ist die Krankheit trotzdem nicht.
In meinem ersten Buch: „Wie Schneewittchen im Sarg – mein Leben mit LongCovid“ habe ich die Zeit beschrieben, in der ich ohne Unterstützung meiner Frau nicht hätte leben können. Es endet etwa in der Zeit, in der ich wieder selbst für mich sorgen konnte: einkaufen, essen machen, Wäsche waschen. Und als ich wenigstens so tun konnte, als könne ich mich auf der Arbeit nützlich machen.
Damals hatte ich zwei für mich entscheidende Schritte der Besserung erlebt: der erste Schritt ging von gefühlt 1% Lebensenergie auf 5%, und der andere von 5% auf vielleicht 10%. Der erste Schritt hatte also meine Energie fast verfünffacht, und der zweite verdoppelt. So, dachte ich, geht es bestimmt weiter. Kräfte verdoppeln bis verfünffachen sich. Zwei bis dreimal noch solche Schritte, und ich wäre wieder wie vor Corona.
Der nächste Verbesserungsschritt brachte dann aber keine Verfünffachung, sondern wieder höchstens 5% zusätzliche Energie.
Ich hatte keineswegs vor, die Krankheit noch lange genug zu haben, um einen zweiten Band „Mein Leben mit LongCovid“ zu schreiben. Lieber wollte ich spätestens nach den Sommerferien so fit sein, dass ich neben meiner Vollzeitstelle und einem nachholend-ausschweifenden Privatleben noch genug Kraft hätte, meinen ersten Krimi zu schreiben.
Was ich dabei vollkommen unterschätzt hatte, waren die „Zustandsverschlechterungen nach Belastung“, kurz PEM (Post- exertional-malaise). Nicht jeder, der LongCovid hat, hat auch PEM. Aber wer sie hat, hat ein echtes Problem. Andere Menschen werden, wenn sie sich anstrengen, müde. Menschen mit PEM wirken eine bestimmte Zeit lang fit. Sie freuen sich, dass es ihnen gut geht, und machen sich auf, endlich wieder etwas zu erleben. Danach sind sie nicht nur einfach müde, sondern haben Schmerzen, sind überfordert, frieren oder schwitzen, haben zu hohen oder zu niedrigen Puls oder andere überraschende Symptome. Der Name des Syndroms, PEM, beschreibt dabei lautmalerisch, wie nachhaltig es einen ausknocken kann: „Bääähmmm!“ Diese Zustandsverschlechterung nach Belastung hat neben dem, dass sie schmerzhaft ist, zwei weitere Tücken. Sie kann sowohl schlagartig einsetzen als auch deutlich zeitversetzt. So erleben Menschen, dass sie im Supermarkt stehen, schlagartig zu zittern anfangen und es kaum noch nach Hause schaffen. Nicht weniger problematisch ist das zeitversetzte Einsetzen. Die Zustandsverschlechterung kann bis zu zwei Tage verspätet auftreten. Mit einem anständigen Corona-Kopfnebel hat man dann schon längst vergessen, womit man sich vor zwei Tagen überlastet haben könnte. Über das „normale“ Maß einer PEM hinaus geht der komplette Zusammenbruch, der Crash. Er kann einen um Wochen, Monate und teilweise Jahre zurückwerfen und gilt deswegen als unbedingt zu vermeiden.
Wer PEM hat, dem hilft nach momentanem Wissensstand nur eines: nie an seine Grenzen zu gehen und damit nie PEM auslösen. Aber woher weiß ich, dass ich gerade zu viel mache, wenn die Quittung erst übermorgen kommt? Vom Suchen dieser Grenze erzählt dieses Buch.
Wieder etwas mehr am Leben teilzunehmen, bringt neue Herausforderungen: Ich begegne wieder regelmäßig Menschen. Sie sehen mir meine Krankheit nicht an und tun sich mit dem Verstehen notgedrungen schwer. Gleichzeitig verändert sich die eigene Auseinandersetzung mit der Krankheit. Ich habe Kraft für wenige Kleinigkeiten, aber die Lust reicht für viele Kleinigkeiten und große Abenteuer. Auswählen und das Anerkennen meiner momentanen Grenzen sind entscheidende Lernaufgaben, die die Krankheit für mich bereit hält. Und nicht zuletzt setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Krankheit gekommen ist, um zu bleiben. Immer mehr kristallisiert sie sich als Lebensaufgabe heraus. Schrieb ich das erste Buch zum Thema noch mit der Zuversicht, dass der Spuk bald vorbei sei, so hat sich inzwischen eine längere Perspektive eingestellt. Auch ein Jahr nach der Infektion habe ich keine Ahnung, wie viel Gesundheit ich mir zurückerobern kann, und wie lange das dauern wird.
Zu mir:
ich bin 51 Jahre alt, weiblich, verheiratet, lebens- und abenteuerlustig, weiß von keinen nennenswerten Vorerkrankungen. Am 15. November 2022 spürte ich die ersten Symptome des Coronavirus. Seit dem ist mein altes Leben beendet und ich lebe mit den Folgen der Virusinfektion.
Ich habe dieses Buch unter anderem Namen veröffentlicht. Das hat zwei Gründe:
Nicht nur ich, sondern alle anderen im Buch erwähnten Personen wären mit wenigen Klicks zu googlen. In einer Zeit, in der Menschen Hassmails und Morddrohungen verschicken, weil man Corona nicht für eine harmlose Grippe hält, möchte ich mir und allen anderen im Buch erwähnten Menschen diese Erfahrung ersparen. Ich selbst bin dafür noch nicht wieder kräftig genug.
Zweitens: Ich erzähle zwar meine Geschichte, will aber stellvertretend von Erfahrungen erzählen, die viele machen: wie fühlt sich „Zusammenbruch“ an, wie monatelange schwerste Kraftlosigkeit? Wie verändert die Krankheit nicht nur das äußere Leben, sondern auch die Gedanken, Gefühle und den Blick aufs Leben? Meine Erfahrungen stehen stellvertretend für die, die hunderttausende von LongCovid Betroffene gerade ähnlich machen.
In einigen Punkten aber habe ich mehr Glück als andere: Da ich verbeamtet bin, trifft mich die Krankheit nicht auch noch auf materiell existenzbedrohende Weise. Außerdem habe ich die ganz großen körperlichen Beschwerden und Symptome „nur“ nach Überlastung. Bei anderen Betroffenen halten die Schmerzen rund um die Uhr an. Und zuletzt habe ich keine Verantwortung für kleine Kinder oder für das wirtschaftliche Wohlergehen eines eigenen Betriebs. Das ermöglicht es mir, so langsam zu machen, dass ich „nur“ nach Überlastung Schmerzen habe. Wenn es mir immer besser gelingt, einen relativ guten Umgang mit der Krankheit zu finden, ist das nicht automatisch eine Blaupause für alle anderen Betroffenen. Schon eine andere Auswahl aus den rund 200 Symptomen kann die Ausgangslage extrem viel schlechter machen als meine. Meine Idee für dieses Buch ist nicht zu sagen: „so geht‘s“, sondern zum Verständnis beizutragen, was für eine unglaubliche Herausforderung die Krankheit LongCovid ist. Dem entsprechend ist dieses Buch kein medizinischer Ratgeber, sondern ein Erfahrungsbericht.
Ich benutze für die Krankheit den Begriff LongCovid. Offiziell spricht man nur die ersten drei Monate nach der Infektion von LongCovid, danach wechselt der Name für die gleiche Krankheit auf Post Covid Syndrom. „Post“ aber heißt „nach“ und klingt, als sei der Spuk vorbei. Der eigentliche Schrecken der Krankheit aber liegt in seiner unglaublichen Länge. Sie zieht sich quälend lang hin und keiner weiß, wann sie endet.
Kapitel 1: Mit Bildern die Krankheit verstehen
Mitten in der Bahnhofshalle
Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Traumleben gefunden: einen Beruf, in dem Sie sich verwirklichen können, eine Partnerschaft, die Sie erfüllt, Hobbys, einen aktiven Freundeskreis. Im Beruf müssen Sie sich konzentrieren. Ihr Büro und ihr Schreibtisch ist deswegen in einem ruhigen Raum untergebracht.
Eines Tages aber wird ihr Schreibtisch und ihr Privatleben in die Bahnhofshalle eines riesigen Hauptbahnhofes verlegt, mitten in den Krach, in die Gerüche, in das Blinklicht, in den Publikumsverkehr. Wie lange könnten Sie dort mithalten?
So ungefähr fühlt sich für mich LongCovid an. Alle Reize prasseln direkt und ungefiltert auf mich ein. Nebengeräusche, wie das Klappern einer Tastatur oder Stimmengewirr, sind für mich so belastend, wie für andere eine laute Bahnhofshalle. Eine Zeitlang ist alles in Ordnung, aber mit jeder Minute nimmt die Belastung zu. Für mich ist ein Gespräch mit einem Menschen so anstrengend und laut, wie früher eines mit zehn. Blinklicht lenkt mich zigmal stärker ab als früher. Und je länger ich in diesem „Hauptbahnhof“ namens Leben verweile, desto mehr belasten mich diese Reize. Nicht alle Betroffene reagieren so nachhaltig auf sämtliche Reize wie ich. Bei anderen entsteht die Überlastung vor allem nach Konzentration oder nach Bewegung. LongCovid kennt viele Ausprägungen.
Bleiben wir einen Augenblick bei dem Bild. Stellen Sie sich Ihren Arbeitsplatz vor, an dem Sie in Ruhe und konzentriert arbeiten sollen. Jetzt steht ihr Schreibtisch in der Bahnhofshalle. Morgens um fünf ist die Halle menschenleer. Es ist noch dunkel. Nur Ihre Schreibtischlampe ist an. Sie machen sich hochmotiviert an die Arbeit. Warum soll man nicht auch hier arbeiten können?
Um viertel nach fünf kommt die Putzkolonne. Eine Kehrmaschine fährt immer um Ihren Schreibtisch herum, und zwei laut redende Reinigungskräfte wischen unter ihren Füßen. Noch können Sie die Störungen ignorieren, denn Sie sind auf ihre Arbeit konzentriert.
Um halb sechs kommen die ersten Ladenbesitzer. Bei einem Laden stimmt etwas mit der Beleuchtung nicht. Der Inhaber stellt die Neonreklame an und aus. Sie flackert und irritiert Sie bei der Arbeit. Er flucht, weil er das Problem nicht gelöst bekommt. Schließlich lässt er die Beleuchtung, wie sie ist. Den Rest Ihrer Arbeitszeit wird sie neben Ihnen flackern.
Nun öffnen auch die Bäckereien und die Schnellimbisse. Der Duft von frischen Brötchen vermischt sich mit dem des Chinarestaurants. Ein neuer Duft entsteht und erinnert Sie an irgendetwas. Aber an was? Sie versuchen, auch den Duft zu ignorieren.