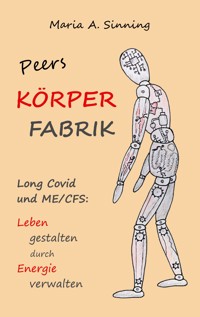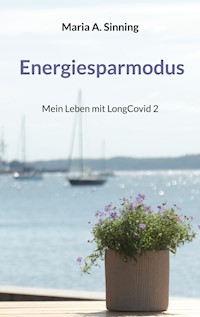Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Nach einer Coronainfektion erkrankt Maria A. Sinning schwer an LongCovid. Was bisher ihr Leben ausgemacht hat, ist schlagartig zu Ende. Statt dessen beschränkt sich ihr Leben plötzlich auf "Ausruhen". Für die lebensfrohe und unternehmenslustige Frau stellen sich ganz neue Lebensfragen. Humorvoll berichtet sie davon, wie sich diese neue Krankheit anfühlt, womit man als Betroffene zu kämpfen hat, wie andere Menschen mit einem umgehen und was sie selbst sich für ihr Leben als chronisch Kranke wünscht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT: WARUM DIESES BUCH?
KAPITEL 1 : ZEITENWENDE
Weihnachtsshopping
Kipppunkt
KAPITEL 2 : CORONADIKTATUR
Neujahr
Ganz unten
Lebendig begraben
Nebel
Versiegte Kraftquellen
Wer bin ich?
Alarmstufe Rot
Paartherapie für Kopf und Körper
Atemübung mit Piepstängel
Diszipliniertes Nichtstun
KAPITEL 3 : ANDERE MENSCHEN
Meine Frau
Gute Freunde
Tipps für gute Freunden
Die Übrigen
KAPITEL 3 : LEBENSHUNGER
Talsohle
Freedom-Day
Tränen des Glücks
Wie im Escaperoom
Kraft für Morgen
Mein Anteil an Krankheit und Genesung
Unbekannte Zukunft
Mein erster freier Tag
NACHWORT: MEINE WUNSCHLISTE
Meine Wünsche an die Politik
Meine Wünsche an alle medizinisch und therapeutisch Tätigen
Meine Wünsche an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
Meine Wünsche an die Geschäftswelt
Meine Wünsche an uns als Gesellschaft
VORWORT: WARUM DIESES BUCH?
Das Coronavirus produziert täglich neue Schattenmenschen: Menschen, die nach einer „milden“ Coronainfektion eine bleierne Erschöpfung und fehlende Belastbarkeit entwickeln, und die deswegen nur noch eingeschränkt am öffentlichen Leben teilnehmen. Je nach Untersuchung klagen bis zu 40% über anhaltende Beschwerden. Bei 10% scheinen die Probleme das Leben deutlich einzuschränken. Bis zu 2% sind dauerhaft arbeitsunfähig. Sie sind bereits davon erschöpft, morgens aufzustehen, sich anzuziehen und aufs Sofa umzuziehen. Einer dieser Schattenmenschen bin ich.
Wir tauchen in der öffentlichen Wahrnehmung erst langsam auf, . Inzwischen berichten zumindest die Medien deutlich öfter. Logischerweise kommen dabei die zu Wort, deren Kraft immerhin ausreicht, über sich berichten zu lassen. Trotzdem bleibt es schwer, die Krankheit zu verstehen. Denn schon das Berichten darüber ist vielen zu anstrengend. Um wahrgenommen zu werden, müssten wir uns zeigen können. Aber wie soll man eine
Demonstration organisieren, wenn man schon zu erschöpft ist, die Wohnung zu verlassen? Wie soll ein Fernsehteam den eingeschränkten Alltag filmen, wenn die Betroffenen schon rasende Kopfschmerzen entwickeln, während das Kamerateam nur sein Equipment aufbaut? Wir verschwinden aus dem gemeinschaftlichen Leben.
Öffentlich wahrgenommen werden diejenigen, die ins Krankenhaus kommen. Wir kennen die Bilder von Menschen an künstlichen Lungen, und von der schweren Arbeit des Pflegepersonals, diese Patienten regelmäßig umzulagern. LongCovid entsteht aber oft nach „mildem“ Verlauf. Die Betroffenen waren nie in einem Krankenhaus, gelten in der Statistik als genesen. Es trifft besonders Menschen zwischen 20 und 50 Jahren. Und bei vielen ist die Krankheit gekommen um zu bleiben. Wir Betroffenen müssen lernen, chronisch krank zu sein, und mit der Krankheit zu leben.
Auch mich hat die Krankheit aus dem Leben gekegelt und für Wochen aufs Sofa verbannt. Aber in ein paar Punkten habe ich es besser getroffen als Hunderttausende andere. Zunächst bin ich verbeamtet. Mich trifft die Krankheit deswegen finanziell weniger, als wenn ich angestellt oder selbständig wäre. Ich habe das Privileg, mich nur mit der Krankheit selbst auseinander setzen zu können. Andere in meiner Situation bekommen nach 6 Wochen Krankengeld oder leiten Betriebe, die inzwischen in Konkurs gehen. Dann habe ich, wenn ich mich ruhig verhalte, meistens keine Schmerzen. Sie kommen erst bei Überlastung, die allerdings früh einsetzt. Vor allem aber habe ich nach sieben Wochen, in denen ich zu gar nichts in der Lage war, eine deutliche Verbesserung erleben dürfen. Das ist den Meisten, die so stark betroffen sind wie ich, nicht vergönnt.
Ich bin immer noch weit weg von gesund, auch wenn ich in der Statistik des RKI als „genesen“ geführt werde. Ich bin auch noch weit weg, ernsthaft arbeitsfähig zu sein. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht einmal, ob ich es je wieder sein werde. Weil es mir aber zumindest besser geht, gehöre ich zu den wenigen Schwerbetroffenen, die (wieder) genug Kraft haben zu erzählen.
Ich erzähle von dieser Krankheit stellvertretend für die anderen Betroffenen, die nicht selbst davon erzählen können – weil sie zu schwach sind oder kein Gehör finden. Ein bisschen erzähle ich auch für mich selbst, um die Erfahrungen zu verarbeiten. Vor allem aber erzähle ich für diejenigen, die andere Betroffene kennen und sie nur schwer verstehen können: in der Familie, Partnerinnen und Partner, im Freundeskreis, auf der Arbeit oder als Patient. Es ist schwer, uns Betroffene zu verstehen. Man sieht uns unsere Krankheit nicht an. Und in einer Welt, in der man sich üblicherweise „mal ein bisschen zusammenreißt“, ist es nur wenig einsichtig, wieso genau das bei LongCovid nicht gehen soll.
Ich erzähle von dieser Krankheit nicht als medizinisches Fachbuch. Dazu gibt es berufenere Menschen. Medizinische Befunde lasse ich aus, schon allein deswegen, weil ich mindestens die Hälfte davon nicht verstehe. Dieses Buch ist kein Buch mit medizinischen Ratschlägen. Mir geht es um Erfahrungen und Umgang mit der Krankheit. Ich möchte von Gefühlen erzählen, von Verzweiflung und Hoffnung, von Hilflosigkeit und Zuversicht. Wenn ich davon erzähle, was mir hilft, dann haben diese Erzählungen keine Allgemeingültigkeit. Mir geht es viel mehr darum ein Verständnis zu schaffen, wie sich diese Krankheit anfühlt.
In diesem Buch benutze ich für die Krankheit das Wort „LongCovid“. Medizinisch vorgesehen wäre das nur für die ersten drei Monate nach der Infektion. Danach ändert sich der Begriff für die gleiche Krankheit zu Post-Covid-Syndrom. „Post“ heißt aber „nach“, und klingt, als sei die Krankheit vorbei. Der eigentliche Schrecken dieser Krankheit aber ist, dass sie gerade nicht vorbei geht, sondern sich quälend lang hinzieht.
Unsere Symptomatik zwingt uns ein Verhalten auf, das von außen aussieht, als seien wir halt „faul“, müssten nur mal „den Hintern hochkriegen“ oder müssten mal unsere psychischen Probleme in den Griff bekommen und jeder sei schließlich mal müde.
Gegen dieses Bild anzukämpfen ist manchmal fast so schwer wie der Kampf gegen die Krankheit selbst. Wenn es mir gelingt, mit diesem Buch zu einer anderen Sicht beizutragen, hat sich für mich die Anstrengung gelohnt. Und mit LongCovid ist selbst so ein kleines Buch echte Schwerstarbeit.
Zu mir:
ich bin 51 Jahre alt, weiblich, verheiratet, lebensund abenteuerlustig, weiß von keinen nennenswerten Vorerkrankungen. Ich habe dieses Buch unter anderem Namen veröffentlicht. Das hat zwei Gründe: Nicht nur ich, auch alle anderen im Buch erwähnten Personen wären mit wenigen Klicks zu googlen. In einer Zeit, in der Menschen Hassmails und Morddrohungen verschicken, weil man Corona nicht für eine harmlose Grippe hält, möchte ich mir und allen anderen im Buch erwähnten Menschen diese Erfahrung ersparen. Ich selbst bin dafür noch nicht wieder kräftig genug. Zweitens: Ich erzähle zwar meine Geschichte, will aber stellvertretend von Erfahrungen erzählen, die viele machen: wie fühlt sich „Zusammenbruch“ an, wie wochenlange schwerste Erschöpfung? Deswegen bin ich als Einzelschicksal nicht wichtig. Meine Erfahrungen stehen stellvertretend für die, die Hunderttausende ähnlich machen.
KAPITEL 1 : ZEITENWENDE
Mein altes Leben endete am Montag, den 15. November 2021, um 16.30 Uhr.
Genau genommen war die Weichenstellung schon einige Tage früher, als das Virus in mir einen neuen Wirt gefunden hatte. Aber jener Montag Nachmittag war der letzte Augenblick, in dem ich völlig frei und ahnungslos mein Leben genießen konnte.
Am Morgen jenes Montags war meine Frau schon um halb sechs zu einer geführten Busreise nach Spanien aufgebrochen. Keinen Moment zu früh, denn so kam sie um eine Ansteckung herum. Wäre der Bus nur wenig später abgefahren, hätte sie vielleicht den ganzen Reisebus irgendwo in Südspanien in Quarantäne gesetzt.
Ich selbst tat an jenem Montag Morgen das, was ich bis dahin immer montags morgens getan habe: die Küche und das Bad putzen. Meine Frau und ich hassen putzen. Daher haben wir uns strenge Regeln auferlegt, wer wann was zu putzen hat. Unser montäglicher Putzvormittag fühlt sich für uns immer an wie stundenlange Schwerstarbeit.
An jenem Montag aber fühlte es sich besonders ermüdend an. Ich dachte, es liege bestimmt daran, dass ich allein putzen musste. Mittags war ich rechtschaffen müde. Nachmittags beschloss ich, mich einen Moment hinzulegen. Der Moment, bevor ich einschlief, war der letzte Moment meines alten Lebens – der letzte, der nicht von einem kleinen Virus namens SARS-Cov2 bestimmt war.
Als ich wieder aufwachte, hatte ich Gliederschmerzen, Schnupfen und Halsweh.
Viel mehr kam an Symptomen nicht hinzu. Einige Nächte hustete ich vor mich hin und freute mich daran zu wissen, dass ich als Geimpfte ziemlich sicher nicht im Krankenhaus landen würde. Der Leidensweg begann erst deutlich nachdem die Infektionskrankheit abgeklungen war. Zunächst aber galt ich nach 14 Tagen als genesen im Sinne des RKI: 14 Tage nach dem PCR-Test weder im Krankenhaus noch tot. Mehr braucht das RKI nicht, um Menschen für „genesen“ zu halten.
Ich selbst hatte mir unter „genesen“ etwas anderes vorgestellt, nämlich wiederhergestellt zu sein, wieder so fröhlich und gesund durchs Leben zu gehen wie vorher. Wieder diese Energie und Unternehmenslust zu spüren, die schiere Lebensfreude. Statt dessen schlief ich bis Weihnachten praktisch jede freie Minute ein. Selbst die kürzeste Pause reichte für ein kleines Schläfchen, manchmal mehrmals am Tag.
Bis Weihnachten schleppte ich mich so durch. Zwischen Weihnachten und Neujahr verschlechterte sich mein Zustand noch einmal deutlich. Ich wurde immer weniger belastbar, nach kurzer Anstrengung wurde mir alles viel zu viel. Ich wurde immer geräuschempfindlicher, reagierte auf Ortsveränderungen mit massivem Stress – ein Gefühl, das ich bis dahin überhaupt nicht kannte.
Am 1. Januar klappte ich zusammen. Das war der Moment, in dem ich verstand, dass ich ein ernsthaftes Problem habe.
Weihnachtsshopping
Kurz vor Weihnachten brauchte ich beruflich etwas aus dem Bastelladen. Der steht direkt in der Innenstadt, dort, wo sich mehrere Straßenbahnlinien kreuzen. Ich fuhr mit dem E-Bike, parkte es in der Nähe und machte mich die letzten Schritte über die Kreuzung zu Fuß auf. Es war Montag Mittag. Durch die Absage der Weihnachtsmärkte war verblüffend wenig los. Aber für mich wurde dieser Ausflug in die Stadt eine erste Ahnung in das Entsetzen, das noch kommen würde.