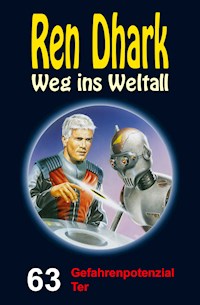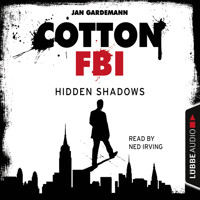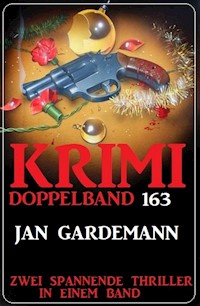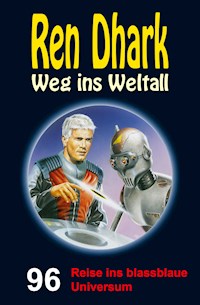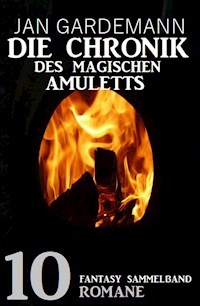Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Federheld
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
So hatte sich John, der Junge aus New York, den Familienurlaub in Schottland nicht vorgestellt. Ein alter Fluch hat im Land seiner Ahnen Besitz von ihm ergriffen. Ein schwarz gewandeter Hüne versucht John mit einer Geisterkutsche ins Reich der Untoten zu entführen. John gelingt es anfangs, dem Fluch zu widerstehen. Doch als seine neue Freundin Jessica vom gruseligen Kutscher entführt wird, wendet sich das Blatt. John riskiert die Reise in die Geisterwelt, doch wird es ihm gelingen, seine Freundin zu retten und das Geheimnis des Fluchs zu lüften?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Entführt in die Geisterwelt
I M P R E S S U M
© 2017 Jan Gardemann
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Federheld.com
Inhaber: Jan Gardemann
Gänsekamp 7
29556 Suderburg
Titelbild und Gestaltung: Jan Gardemann
weitere Informationen:
www.federheld.com
facebook: Federheld.com
Vervielfältigung und Nachdruck des Textes und des Covers (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet.
Kapitel 1:
Der Unheimliche mit dem Wolf
Kapitel 2:
»Die Rote Laterne«
Kapitel 3:
Die Geschichte vom Geisterfischer
Kapitel 4:
Horror in der Burgruine
Kapitel 5:
Wenn dich Geisterstimmen locken …
Kapitel 6:
Eine unerfreuliche Bekanntschaft
Kapitel 7:
Der geheimnisvolle Glücksbringer
Kapitel 8:
Der Fluch der MacConnors
Kapitel 9:
Willkommen in der Geisterwelt!
Kapitel 10:
Der Geister-Earl
Kapitel 11:
Eine Seele für den Teufel
Kapitel 12:
Der Knochenthron
Kapitel 13:
Eine freudige Überraschung
Kapitel 1:
Der Unheimliche mit dem Wolf
Aus der Luft betrachtet sah ihr Auto vermutlich aus wie ein in der Dunkelheit dahinkriechender Käfer mit leuchtenden Augen, der durch die Wildnis irrte …
Müde saß John Connor auf dem Rücksitz des Kleinwagens, den seine Eltern in Glasgow gemietet hatten. Voller Unbehagen starrte er in die verregnete Nacht hinaus.
Der helle Schein der Autoscheinwerfer huschte vor dem Fahrzeug über die nasse Straße. Die verknorrten Bäume am Straßenrand wurden im Vorbeifahren jedes Mal kurz aus der Dunkelheit gerissen. Sie glichen Riesen mit langen Armen, die nur darauf zu warten scheinen, dass um diese nachtschlafende Zeit Reisende vorbeikamen, die sie dann packen und durchschütteln konnten.
»Wann sind wir denn endlich da?«
John biss presste verärgert die Lippen zusammen. Die Worte waren wie von selbst aus ihm herausgerutscht.
Dabei hatte er sich doch fest vorgenommen, sich solch kindische Fragen zu verkneifen. Schließlich war er ja kein kleiner Junge mehr.
Helen Connor, Johns Mutter, drehte sich auf dem Beifahrersitz zu ihrem Sohn um. Ihr blondes glattes Haar schimmerte matt im Schein der Armaturbeleuchtung. »Ein wenig wirst du dich noch gedulden müssen, Schatz. Du hast jetzt schon so lange durchgehalten, da wirst du die letzten Kilometer auch noch überstehen!«
Mürrisch verschränkte John die Arme vor der Brust.
»Gedulden!«, murmelte er trotzig. »Das klingt ja, als könne ich es gar nicht mehr erwarten, dass wir unser Urlaubsziel endlich erreichen!«
Dabei war das genaue Gegenteil der Fall. John hätte seine Sommerferien nämlich viel lieber in seiner Heimatstadt New York verbracht als ausgerechnet im Norden von Schottland.
Endlich hätte er mal Zeit gehabt, mit seinen Freunden all die angesagten Discotheken des Big Apple zu besuchen, im Central Park ein Picknick zu veranstalten oder stundenlang das neue Fantasie-Strategiegame online am Computer zu spielen.
Stattdessen würde er nun etliche Tage in einer mikroskopisch kleinen Ortschaft zubringen müssen, in der es nicht einmal ein Kino gab!
Dass Johns Vorbehalte gegen diesen Urlaub nicht aus der Luft gegriffen waren, wie seine Eltern behaupteten, davon konnte sich ja wohl jeder überzeugen, der wie John in diesem Moment einen Blick durch die Seitenscheiben des Wagens geworfen hätte.
Es gab dort nichts außer unheimlichen Bäumen, weiten Hügeln und bizarrem Buschwerk zu sehen.
Ein Blitz zuckte vom Himmel. Das Regenwasser, das in dicken schweren Tropfen von den Ästen, Zweigen und Blättern fiel, sah für einen Moment wie flüssiges Silber aus. Die Dunkelheit zwischen den Bäumen wirkte dabei so vollkommen und undurchdringlich, dass sie John wie etwas Lebendiges vorkam …
Fröstelnd drehte der Junge das Gesicht vom Fenster weg.
Die Fahrt vom Flughafen in Glasgow nach Dunress an der Nordküste Schottlands, wo seine Eltern zwei Hotelzimmer gebucht hatten, dauerte nun schon über drei Stunden.
Es kam John vor, als müsse eine halbe Ewigkeit vergangen sein, seit sie die letzte größere Ortschaft durchquert hatten. Seitdem waren sie lediglich durch einige Dörfer gekommen, die eigentlich nicht mehr als eine armselige Ansammlung einer Handvoll Häuser gewesen waren.
Die Leute in den Dörfern schienen um diese Uhrzeit bereits alle zu schlafen. Es hatte kaum ein erleuchtetes Fenster gegeben. Sogar die Straßenlaternen waren aus Kostengründen abgeschaltet worden ― oder weil sich kurz vor Mitternacht sowieso kein Mensch mehr auf der Straße herumtrieb.
»Unterwegs zum Ende der Welt«, erfand John für ihre Autofahrt einen Filmtitel.
»Was brummelst du da in deinen nicht vorhandenen Bart, Sohnemann?«, erkundigte sich William Connor. Er saß am Steuer des Wagens und warf John einen strengen Blick im Rückspiegel zu. »Du solltest dich freuen, dass du endlich mal aus dieser miefigen Großstadt herauskommst. Das Leben auf dem Lande hat auch seine Vorzüge – du wirst schon sehen!«
John schnaufte trotzig. »Du wirst dich doch sowieso nur auf dem Golfplatz herumtreiben, Dad. Und Mom wird tagelang am Strand spazieren gehen und sich die Handlung für einen neuen Kriminalroman ausdenken.«
Johns Dad arbeitete für eine New Yorker Versicherung und war in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Golfspieler.
Beides ziemlich fantasielose Angelegenheiten, wie Johns Mom stets betonte. Sie war Schriftstellerin und hatte schon ein halbes Dutzend Kriminalromane veröffentlicht.
Fürs Golfspiel interessierte sich Mom genauso wenig wie John, der diesen Sport einfach nur öde fand. Mom ging in ihrer Freizeit lieber im Central Park spazieren oder traf sich mit Freundinnen und Schriftstellerkollegen, mit denen sie dann stundenlang über Themen sprach, von denen John nur die Hälfte verstand.
Der Junge war überzeugt, dass seine Eltern ihre Gewohnheiten in Schottland nicht ändern würden. Sein Dad würde die meiste Zeit auf dem Golfplatz verbringen und seine Mom am Strand umherschlendern, Muscheln sammeln oder sich mit den Einheimischen unterhalten.
Für ihn, John, würden Dad und Mom genauso wenig Zeit aufbringen wie in New York. Er würde ganz auf sich allein gestellt sein. Und das ausgerechnet in einem kleinen unbedeutenden Nest, das für ihn so fremd war wie etwa die dunkle Seite des Mondes!
»Am Meer und bei der Brandung hast du bestimmt deinen Spaß, John«, sagte Mom aufmunternd. Ihr war die trübe Stimmung ihres Sohnes nicht entgangen. »Du kannst dort endlich surfen lernen – das wolltest du doch so gern.«
»Ich weiß«, erwiderte John unleidlich. »Ohne meine Freunde macht das aber bestimmt nur halb so viel Spaß.«
»Du wirst in dem Hotel nicht das einzige Kind sein«, erklärte Dad überzeugt.
»Ich bin aber kein Kind mehr!«
»Du weißt, wie ich das meine«, erwiderte Dad streng. »Freunde kannst du überall auf der Welt finden – nicht nur in New York!«
John seufzte schicksalsergeben. Vor den Ferien hatte es schon zahlreiche ähnlich ätzende Diskussionen wie diese gegeben. Seine Eltern hatten sich einfach nicht von dieser blöden Reise abbringen lassen. Wenn John ein Grund gegen die Reise eingefallen war, hatte sein Dad dieses Argument stets mit denselben Worten zerschlagen.
Mit der Bemerkung nämlich, dass die Vorfahren der Connors einst in Dunress gelebt hatten, ehe die Familie vor zweihundert Jahren nach Amerika ausgewandert war.
»Wir wollen doch mal sehen, wo unsere Ahnen damals gehaust haben«, sagte sein Dad in diesem Moment auch prompt wieder. »Es wird dich doch gewiss interessieren, wo deine Wurzeln liegen, John. Vielleicht entdeckst du in dir ja sogar eine tiefe Verbundenheit mit diesem rauen Landstrich.«
»Ja«, sagte John wenig begeistert. Am liebsten hätte er seinen Vater drauf hingewiesen, dass es so toll in Dunress nicht sein konnte, wenn ihre Ahnen so weise gewesen waren, diesen einsamen Flecken Erde zu verlassen, um nach Amerika auszuwandern.
Doch das ließ er lieber bleiben. Sein Dad konnte ziemlich ungehalten werden, wenn John ihm frech kam.
John wollte das sinnlose Gespräch beenden, zog seine Reisetasche zu sich heran und kramte darin herum.
Die Batterien seines Game-Boy waren fast leer. Aber John verspürte sowieso keine Lust auf ein Spiel. Er hatte fast alle Games auf dem langen Flug von New York nach Glasgow durchgespielt.
Das Einzige, was ihn vielleicht noch aufgemuntert hätte, wäre ein Onlinematch am Computer oder ein spannender Kampf an der neuen Playstation gewesen.
John schob seine Reisetasche wieder von sich. Wehmütig dachte er daran, dass sich die neue Playstation, die erst vor kurzem auf den Markt gekommen war, jetzt tatsächlich in seinem Reisegepäck hätte befinden können. Einen Fernseher würde es auf seinem Zimmer ja wohl geben, sodass er sich die Zeit mit seiner neuen Errungenschaft hätte vertreiben können.
Doch John hatte das Geld, das er sich mühsam für die Spielkonsole zusammengespart hatte, einer Hilfsorganisation gespendet.
Ja, es war kaum zu fassen. John konnte es selbst noch immer kaum glauben. Da war wohl eine Seite an ihm, die er selbst kaum kannte.
Die Organisation, der er gespendet hatte, kümmerte sich um Kinder in Erdbebengebieten. Um Kinder, die nicht nur ihr Zuhause, sondern obendrein noch ihre Eltern und Familien verloren hatten.
Vor kurzem hatte es wieder so eine Erdbebenkatastrophe gegeben. Viele Menschen waren gestorben, noch mehr hatten ihr Dach überm Kopf verloren – ihr Haus, ihr gesamtes Hab und Gut.
Und das in einer Region, die zu den ärmsten der Welt zählte!
John hatte diese bemitleidenswerten Menschen in einem Videoclip im Fernsehen gesehen, und gerade die Gesichter der Not leidenden Kinder hatten ihn tief bewegt.
Dieser Anblick war ihm so nahe gegangen, dass er sogleich beschlossen hatte, irgendwie zu helfen. Und das konnte er im fernen New York eben nur mit Geld.
So hatte er auf seine Playstation verzichtet, wenn auch schweren Herzens. Er wollte sein Geld lieber dafür verwenden, dass diesen armen Kindern geholfen wurde.
Mom und Dad waren von seinem spontanen Entschluss, von dem John auch später nicht mehr hatte abweichen wollen, völlig baff gewesen. Das hätten sie ihm nicht zugetraut – und er sich selbst auch nicht.
Doch es kam John irgendwie ungerecht vor, dass er sich ein im Grunde genommen überflüssiges Spielzeug leisten konnte, während diese Kinder nicht einmal ein Dach überm Kopf hatten, weil die Naturgewalten es ihnen fortgerissen hatten.
Seine überraschende Spendenbereitschaft hatte auch seine Eltern dazu bewegt, einen erheblichen Beitrag für die Not leidende Bevölkerung herzugeben. Mom hatte sogar einen Großteil des Honorars gespendet, das sie für ihren letzten Roman erhalten hatte.
Aber sie hatte das nicht an die große Glocke gehangen, wie so mancher Promi es getan hätte, um für sich Reklame zu machen, sondern hatte es still und heimlich getan.
Zwar wäre John jetzt froh gewesen, hätte er die neue Playstation gehabt, trotzdem – er bereute seinen Entschluss nicht. Nun ja, auf jeden Fall bereute er ihn niemals sehr lange. Wenn er an die Kinder dachte, deren Leid mit seinem Geld hatte gelindert werden können – und wenn auch nur ein winziges Bisschen ―, fühlte er sich gleich besser …
John lehnte sich auf der Rückbank vor. Gelangweilt spähte er an den Schultern seiner Eltern vorbei nach draußen. Er hoffte, das Ortschild von Dunress endlich am Straßenrand zu erblicken.
»Jetzt haben wir es gleich geschafft«, versprach Mom und drehte sich halb zu ihrem Sohn um. »In wenigen Kilometern müssten wir Dunress erreicht haben.«
»Hoffentlich ist wirklich noch jemand wach in dem Hotel, wie es uns versprochen wurde«, bemerkte John müde.
»Mach dir keine Sorgen, mein Junge«, sagte Dad. »Du wirst heute Nacht in einem butterweichen Bett liegen und dich von den Strapazen der Reise ausruhen können.«
Da huschte plötzlich eine geduckte Gestalt aus dem Wald und rannte direkt auf die Fahrbahn!
»Pass auf, Dad!«, schrie John und deutete nach vorn. »Ein Tier auf der Straße!«
Dad trat mit voller Wucht auf die Bremse.
Ein großer Hund war in den Lichtkegeln der Scheinwerfer aufgetaucht.
Seine Augen leuchteten rot, und er senkte den Kopf, als wollte er den heranrasenden Wagen anspringen.
Das Auto kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Es fehlten aber nur wenige Zentimeter, und die Kühlerhaube hätte das Tier erwischt.
Dies alles ließ den Hund jedoch unbeeindruckt. Seelenruhig stand er da, hechelte mit lang heraushängender Zunge und starrte den Wagen und dessen Insassen mit seinen roten Augen an.
»Das ist gar kein Hund«, sagte Mom beklommen. Sie krallte ihre Hand in den Unterarm ihres Mannes. »Das ist ein Wolf!«
»Du hast recht«, sagte Dad verdattert. »Wahrscheinlich gibt es in Schottland Leute, die sich dafür einsetzen, dass diese wilden Tiere in den Wäldern wieder heimisch werden.«
»Warum verschwindet dieses Biest denn nicht wieder?«, fragte John beklommen. Wölfe hatte er bisher nur im Zoo gesehen – und da hatte ihn ein hoher Zaun von den Tieren getrennt.
Sein Dad drückte auf die Hupe.
Den Wolf aber ließ der Lärm kalt. Er rührte sich nicht und setzte sich sogar noch auf die Hinterläufe.
»Der macht es sich auf der Straße ja regelrecht gemütlich!«, stieß Dad ungläubig hervor.
»Da – seht doch!«, rief John und deutete zum Waldrand.
Eine weitere Gestalt schob sich zwischen den Bäumen hervor. Eine Gestalt allerdings, die aufrecht ging.
Es war ein Mann. Er trug einen langen dunklen Mantel. Das Kleidungsstück wurde an den Nähten mit Schnüren zusammengehalten und bestand offenbar ganz aus Leder.
Die Kapuze des Mantels hatte der Fremde tief in das Gesicht gezogen. Regen lief in glitzernden Rinnsalen über seine Klamotten.
Gelassen trat der Fremde an den Wolf heran und strich dem Tier mit seinen dürren Fingern durch das borstige Nackenfell.
Es sah fast aus, als wollte er das Tier für sein Verhalten belohnen.
Dad schickte sich an, das Seitenfenster runterfahren zu lassen.
»Pass bloß auf!«, mahnte seine Frau ängstlich. »Wer weiß, was das für ein Kerl ist!«
»Wir sind hier nicht in New York«, gab Dad zurück. »Bestimmt ist das nur der Förster.«
Der unheimliche Fremde hatte sich unterdessen von dem Wolf abgewendet und trat an die Fahrertür heran.
Er beugte sich vor und spähte in den Wagen, und John konnte das Gesicht des Fremden sehen. Es war ein abgemagertes Gesicht mit kantigen Zügen und einer vorspringenden Nase, an deren Spitze ein Regentropfen hing.
Am gruseligsten aber waren die Augen des Mannes. Sie waren kohlschwarz.
Als der Mann John anstarrte, hatte der Junge das Gefühl, der Blick des Fremden würde ihn regelrecht durchbohren.
Der Junge kam sich plötzlich entsetzlich schutzlos vor. Es war, als könne dieser Mann bis tief in seine Seele schauen.
Ein dünnes, böses Lächeln umspielte die Lippen des Unheimlichen.
»Hallo, die Herrschaften«, sagte er mit rauer Stimme. Sie klang, als würde er aus einem Grab zu ihnen sprechen. »Willkommen in Dunress. Es freut mich ganz außerordentlich, die MacConnors in dieser Gegend begrüßen zu dürfen.«
»Würden Sie die Güte haben und Ihren Wolf von der Straße entfernen!«, rief Mom dem Fremden gereizt zu. Sie hatte die Nase voll von diesem Spuk.
»Es ist nicht mein Wolf«, erwiderte der Mann gelassen.
»Er vertraut Ihnen aber doch«, sprang Dad seiner Frau bei.
»Das will ich wohl meinen.«
»Na also – dann befehlen Sie dem Tier, die Fahrbahn freizugeben. Der Wolf hätte beinahe einen Unfall verursacht!«
»Er hat Sie nur begrüßen wollen«, beschwichtigte der Mann.
Aber er trat von dem Wagen zurück und stieß einen durchdringenden Pfiff aus.
Daraufhin erhob sich der Wolf und trottete an die Seite des Unheimlichen.
»Passen Sie das nächste Mal besser auf das Tier auf«, rief Johns Dad mürrisch. »Ich habe nichts dagegen, wenn den Wölfen ihr Lebensraum zurückgegeben wird. Sie sollten sich aber von der Straße fernhalten!«
Dad ließ das Seitenfenster wieder hochgleiten und fuhr los.
John und seine Mom drehten sich um und sahen dem sonderbaren Mann noch auf der Straße stehen. Dann beschrieb die Fahrbahn eine Kurve, und der Unheimliche in seinem langen nassen Mantel verschwand aus ihrem Blickfeld.
Mom schüttelte sich. »Ein schauriger Kerl.«
»Woran er wohl erkannt hat, dass wir die Connors sind?«, überlegte John laut.
»Vermutlich sind wir die einzigen Feriengäste, die noch um Mitternacht in ihrem Domizil erwartet werden«, erklärte Dad. »Dunress ist ein kleiner Ort. So etwas spricht sich hier wahrscheinlich schnell herum.«
»Er hat unseren Familiennamen aber verunstaltet«, bemerkte John. »Er hat uns die MacConnors genannt.«
»Wahrscheinlich hat er es aus Gewohnheit getan«, meinte Mom schulterzuckend. »In Schottland sind Familienamen mit dem Zusatz ›Mac‹ sehr geläufig.« Sie drehte sich auf dem Beifahrersitz zu ihrem Sohn um. »Da gibt es zum Beispiel den bekannten Clan der MacLeods und den der MacKenzies, die zu ihrer damaligen Zeit sehr viel Macht hatten, aber auch die MacPhersons oder die MacLeans, Clans, die weniger einflussreich waren.«
»Ach«, sagte John. »Und warum ist das so? Ich meine, warum haben diese Clans oder Familien alle dieses ›Mac‹ im Namen?«
»Das Wort ›Mac‹ ist gälisch und bedeutet ›Sohn‹«, erklärte Mom. »MacConnor heißt also so viel wie ›Sohn von Connor‹.«
John wunderte sich doch sehr und fragte staunend: »Die Männer in so einem Clan hatten aber doch nicht alle ein und demselben Dad, oder?«,
Mom lachte. »Nein, aber die Mitglieder eines solchen Clans führten ihre Abstammung meist auf einen gemeinsamen Ahnherrn zurück, der den Clan gegründet und diesem seinen Namen gegeben haben soll. Was natürlich nicht ganz der Realität entsprechen kann, aber man dachte damals so.«
John nickte. »Ich verstehe.«
»Ha – wir haben es geschafft!«, unterbrach William Connor Moms Unterricht in schottischer Namensgebung. »Dort vorn ist das Ortsschild von Dunress!«
Kapitel 2:
»Die Rote Laterne«
Helen und William Connor hielten in der Dunkelheit angestrengt nach einem Hinweisschild Ausschau, das auf ihr Hotel hinwies.
Dunress übertraf Johns schlimmsten Befürchtungen. Der Ort unterschied sich in keiner Weise von den anderen Dörfern, durch die sie gefahren waren. Die Häuser waren klein und einfach, die Fenster alle unbeleuchtet.
Die Straßenlampen hatte man auch bereits abgeschaltet, sodass die Scheinwerfer des Autos die einzige Lichtquelle weit und breit waren.
Dad bog plötzlich in eine Seitenstraße ab. Es ging einen Hügel hinauf.
»Da ist es!«, rief Mom begeistert und deutete aufgeregt nach vorn. »Wir sind endlich am Ziel angelangt!«
John folgte der angegebenen Richtung mit seinem Blicken – und traute seinen Augen nicht!
Oben auf dem Hügel thronte ein mehrstöckiges düsteres Gebäude. Das Dach war Spitz und von Giebeln und Erkern mehrfach durchbrochen. Hohe, schlanke Schornsteine ragten wie mahnende Zeigefinger in den wolkenverhangenen Himmel.
Die Mauern des Hauses bestanden aus faustgroßen Steinen. Sie waren so dicht aneinander gepackt, dass es aussah, als befände sich gar kein Mörtel in den Fugen und Ritzen.
Die Fenster waren klein und natürlich alle unbeleuchtet. Über dem Eingang des Hauses baumelte ein altes Holzschild, das im Wind hin- und herschaukelte und vor Nässe triefte.
»Rote Laterne«, stand in blutroten Lettern darauf geschrieben.
Was dieser idiotische Name zu bedeuten hatte, konnte John sich beim besten Willen nicht erklären. Es war nämlich nirgendwo eine rote Laterne zu entdecken.
Im Großen und Ganzen sah das Gebäude aus, als würde es den nächsten Sturm nicht überstehen, fand John.
»Das soll unser Hotel sein?«, rief er entgeistert. »Das ist doch wohl nicht euer Ernst?«
»Ich weiß gar nicht, was du hast«, erwiderte Mom vergnügt. »Das Haus sieht doch beeindruckend aus.«
John schnaufte abfällig. »Dass du diese Bruchbude toll findest, wundert mich nicht. Sie würde eine gute Kulisse für einen deiner Krimis abgeben. Ein verrückter Mörder könnte darin sein Unwesen treiben!«
Unterdessen stoppte Dad den Wagen unmittelbar vor dem Eingang des Hotels. Der Parkplatz lag hinter dem Haus. Aber Dad hatte keine Lust, noch lange durch den Regen zu marschieren.
John warf der Eingangstür einen unbehaglichen Blick zu. Sie bestand aus dicken, fast schwarzen Bohlen. Ein rautenförmiges kleines Fenster befand sich im oberen Drittel.
Und in diesem Fenster glomm plötzlich ein Licht auf.
»Aha!«, sagte Mom, die das Licht auch bemerkt hatte. »Wie es scheint, hat der Nachtportier unsere Ankunft bereits bemerkt.«
In diesem Moment schwang die Tür auf. Ein alter, gebeugter Mann erschien in dem hellen Rechteck der Türöffnung. Wie lauernd stand er da und hielt sich mit einer Hand an dem Türpfosten fest.
»Der sieht aber nicht aus, als wäre er uns mit unserem schweren Gepäck eine große Hilfe«, merkte Dad mürrisch an.
Der Mann winkte müde. Offenbar hatte er keine Lust, in den Regen hinauszutreten, um die Gäste zu begrüßen.