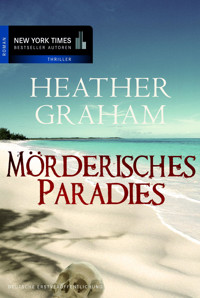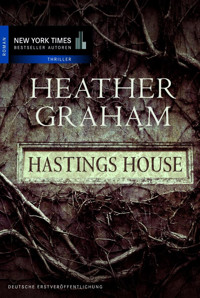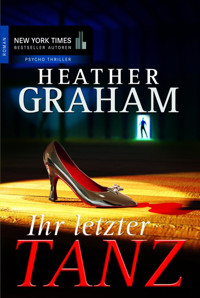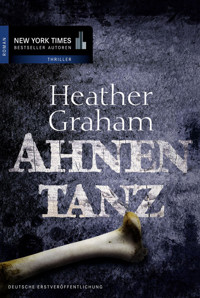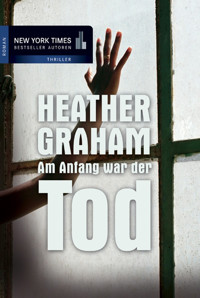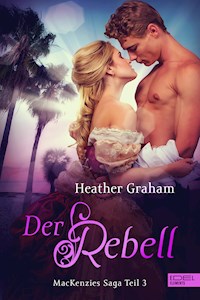Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Highland-Kiss-Saga
- Sprache: Deutsch
Gefangen zwischen Rache und Sehnsucht Schottland im 13. Jahrhundert: Um den Tod ihres Vaters durch die Hand von Rebellen zu rächen, stürzt sich die mutige und schöne Lady Eleanor in den Kampf gegen die aufständischen Schotten. Doch als der Highlander Brendan Graham sie als Geisel nimmt, verwandelt sich ihr glühender Hass schnell in eine gefährliche Faszination für den temperamentvollen Outlaw. Aus ihrer geliebten Heimat fortgerissen und umgeben von Verrat und Intrigen, kann sie nur einem vertrauen – jenem Mann, der ihr größter Feind sein sollte. Wird es Brendan gelingen ihr Leben zu retten – und ihr Herz zu erobern? »Heather Graham glänzt!« Bestsellerautorin Kat Martin »Entführt von einem Schotten« ist der dritte Band der gefühlvollen »Highland Kiss«-Reihe der New-York-Times-Bestseller-Autorin und kann unabhängig gelesen werden. Ein Romance-Highlight für alle Fans der historischen Liebesromane von Kristin MacIver und Barbara Longley – auch bekannt unter dem Titel »Geisel der Leidenschaft«. Alle Bände der Reihe: Band 1: In den Armen des Schotten Band 2: Der Highlander und die schöne Feindin Band 3: Entführt von einem Schotten Band 4: Gefangen von einem Highlander Band 5: Die Braut des Viscounts Die Bände sind unabhängig unabhängig voneinander lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schottland im 13. Jahrhundert: Um den Tod ihres Vaters durch die Hand von Rebellen zu rächen, stürzt sich die mutige und schöne Lady Eleanor in den Kampf gegen die aufständischen Schotten. Doch als der Highlander Brendan Graham sie als Geisel nimmt, verwandelt sich ihr glühender Hass schnell in eine gefährliche Faszination für den temperamentvollen Outlaw. Aus ihrer geliebten Heimat fortgerissen und umgeben von Verrat und Intrigen, kann sie nur einem vertrauen – jenem Mann, der ihr größter Feind sein sollte. Wird es Brendan gelingen ihr Leben zu retten – und ihr Herz zu erobern?
eBook-Neuausgabe August 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »Seize the Dawn« bei Kensington, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Geisel der Leidenschaft« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2001 by Shannon Drake
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: MostlyPremade - Nadine Most unter Verwendung von stock.adobe.com (Taiga, _Danoz, VJ Dunraven, Ankomando)
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fb)
ISBN 978-3-69076-106-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Heather Graham
Entführt von einem Schotten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Malsch
Prolog
Falkirk, Schottland22. Juli 1298
Im Krieg lag eine eigentümliche Schönheit. Allein die Pfeile boten einen atemberaubenden Anblick. Unvermittelt tauchten sie im leuchtenden Blau des Sommerhimmels auf, flogen hoch empor und sanken anmutig herab – zischend und zielstrebig.
Und dann hörte Brendan das Geschrei, denn die Schotten, die den Trupp der erfahrenen englischen Bogenschützen herausgefordert hatten, erkannten zu spät, dass Schönheit und Anmut genauso mörderisch zu wirken vermochten wie die Dummheit.
Die Pfeile bohrten sich ins Fleisch, ließen Blut spritzen, zerschmetterten Knochen. Schwankend krümmten sich die Männer, schwer verwundet oder gar tot fielen sie zu Boden. Die verängstigten Pferde wieherten ohrenbetäubend, und viele Ritter, selbst unverletzt, fluchten voller Zorn, als tödlich getroffene Tiere unter ihnen zusammenbrachen. In wilder Panik stob das Fußvolk auseinander, die Kavallerie wich zurück, die Kommandanten erteilten mit durchdringenden Stimmen ihre Befehle.
»Halt, ihr Narren!«, brüllte John Graham, Brendans Verwandter, der auf seinem großen Rappen saß. »Sorgt für eure Rückendeckung!«
Da ihr Anführer William Wallace einen günstigen Kampfplatz gewählt hatte, konnten sie sich gewisse Vorteile verschaffen. Obgleich Edward von England etwa zweitausendfünfhundert Fußsoldaten und zwölftausend Reiter in den Krieg geschickt hatte, kämpfte William am Rand des Callander Wood. An dieser Stelle mündete ein rauschender Bach in einen anderen aus Glen Village. Deshalb mussten die Engländer ein sumpfiges Gebiet durchqueren, das Männer und Pferde gleichermaßen ermüdete. Trotzdem rückten die Engländer unbeirrt vor. Und die Schotten wurden zurückgetrieben.
»Halt!«, befahl John wieder und Brendan sah ihn ungläubig den Kopf schütteln. Welches törichte Selbstvertrauen hatte zu dieser unfassbaren Dummheit geführt?
Wer hatte die Pfeile nicht gesehen? So sicher waren sie sich gewesen, den Engländern trotzen zu können. Nun vergeudeten sie zahllose Menschenleben. Und der Hauptangriff hatte noch nicht einmal begonnen.
Über dem Geschrei der Männer hörte Brendan die Pferdegeschirre klirren. In nervöser Ungeduld stampfte sein scheckiger Hengst Achilles in der aufgeweichten Erde, feuchter Atem quoll aus den Nüstern. Immer mehr Pfeile rasten heran, Schotten brachen zusammen und starben. Edward von England war kein Narr und gewiss kein Feigling. Wer ihn falsch eingeschätzt hatte, rannte ins Verderben. Gnadenlos hatte er Wales vernichtet, dem er seine ausgezeichneten Langbogenschützen verdankte. Auch mit der Armbrust wussten seine Soldaten umzugehen, flämische und deutsche Söldner, auch Krieger aus Frankreich, das er so beharrlich bekämpfte.
Sogar Schotten ritten mit ihm, weil sie fürchteten, ihr Beschützer Wallace könnte sich gegen die Streitkräfte des englischen Plantagenet-Königs, des selbst ernannten Hammers der Schotten, nicht behaupten.
Vielleicht wechselten wankelmütige Schotten in eben diesem Augenblick die Seiten ...
Die englischen Reiter folgten ihren Bogenschützen, ein Nahkampf stand unmittelbar bevor. Mit ihren Schiltrons – Barrieren aus Männern, die Piken schwangen – pflegten die Schotten dem Feind zu trotzen.
Aber jetzt versagte auch diese Methode.
Hastig sprang Brendan von seinem Hengst und rannte zu einem alten Krieger, aus dessen Schenkel der Schaft eines Pfeils ragte. »Zieh ihn heraus!«, befahl der Mann. »Sonst verblute ich auf diesem Schlachtfeld!«
»Das kann ich nicht, MacCaffery ...«
»Doch, mein Junge.« Unter schneeweißen Brauen und wild zerzausten Haaren funkelten blaue Augen.
«MacCaffery ...«
»Bist du zu schwach?«
Mit dieser herausfordernden Frage erreichte MacCaffery sein Ziel. Brendan packte den Schaft des Pfeils, biss die Zähne zusammen und zog die Spitze aus dem Fleisch. Blitzschnell riss er sich das Leinenhemd vom Leib und presste es auf die Wunde. »Du Narr!«, beschuldigte er den alten Krieger.
»Aye«, bestätigte MacCaffery leise. Bei der schmerzhaften Prozedur hatte er mit keiner Wimper gezuckt. »Ein freier Narr. Und als solcher will ich sterben.«
Sterben? Spürte auch er dieses seltsame Gefühl? Keine Furcht, eher ein Unbehagen. An diesem Tag hätten sie nicht kämpfen dürfen. Viele Kommandanten hatten dagegen protestiert. Stattdessen hätten sie weiter nach Norden ziehen sollen. Sie hatten das Land verwüstet zurückgelassen. Wären sie vor dem englischen Heer geblieben, hätten sie es aushungern können.
Vor nunmehr fast einem Jahr, in Stirling Bridge, hatten sich die Schotten – Arme und Reiche, Bauern und Kaufleute – der englischen Übermacht gestellt und triumphiert. Seit jenem wundervollen Sieg hatte Schottland seine Freiheit genossen. Andrew de Moray, der große Baron aus dem Norden, war kurz nach der Schlacht gestorben, tödlich verwundet. Bis zur letzten Minute hatte Sir William Wallace den Namen des Freundes in der offiziellen Korrespondenz am Leben erhalten und als Verwalter Schottlands regiert – mächtig genug, um die Welle des Blutvergießens nach England zu jagen, York zu zerstören und seinen Anhängern etwas unglaublich Kostbares zu schenken – Stolz.
Stolz, der sich jetzt in Dummheit verwandelt hatte.
»Vorsicht!«, mahnte der alte MacCaffery.
Gerade noch rechtzeitig drehte sich Brendan um. Ein Ritter in voller Rüstung und in den Farben des Hauses York stürmte auf ihn zu. Verzweifelt schwang Brendan seine Waffe und zielte auf den Hals des Gegners. Für Sekunden schien die Zeit stillzustehen, als der Engländer nach seiner Kehle griff. Zwischen den Fingern quoll Blut hervor, dann sank er in den Morast. Sofort galoppierte ein anderer Ritter heran und Brendan hob erneut sein Schwert.
In Hawk’s Cairn hatte er zum ersten Mal den Hass der Feinde gespürt, ohne Talent und Erfahrung gekämpft und nur überlebt, weil er auf dem Schlachtfeld liegen geblieben war – scheinbar tödlich verletzt. Mit der Zeit hatte er gelernt, erfolgreich zu kämpfen, seinen Verstand zu nutzen, zu siegen. Und plötzlich wusste er, was dieser Tag bedeutete – hier würde er das bittere Leid der Niederlage erfahren.
Aber er war nicht gewillt, dies hinzunehmen. Ebenso wenig wie der alte MacCaffery, der sich trotz seiner blutenden Wunde erhob und sein Schwert zückte. Immer wieder. Zu ihren Füßen färbte sich der Schlamm rot.
Als Brendan einen Schrei hörte, fuhr er herum. Sein Verwandter, John Graham, war aus dem Sattel gestürzt und lag am Boden, umringt von seinen Männern, die ihn in Sicherheit bringen wollten.
»Lauf zu ihm, mein Junge«, rief MacCaffery, »ich gebe dir Rückendeckung!« Mochte er auch halb tot sein, kein anderer würde ihn wirksamer schützen. Brendan kniete neben John nieder, sah die Wunde im Hals, hörte das Rasseln des Todes in den Lungen.
»Um Himmel willen, John!« Er versuchte ihn hochzuheben, aber John stemmte eine blutige Hand gegen seine Brust.
»Du musst fliehen, Brendan, mit diesen Männern! Soeben haben sie Wallace weggetragen ...«
»Nein, ich verlasse dich nicht, ich trage dich in den Wald ...«
»Ich bin so gut wie tot, und dir fehlt die Zeit, um eine Leiche zu retten.«
»John ...«
»Denk an Schottland und ergreif die Flucht! Diese Schlacht ist verloren – so viel ist verloren. Aber die Hoffnung lebt in deinem Herzen weiter. Lauf weg!« Verzweifelt umklammerte Brendan die Hand seines Verwandten, die den Druck nicht erwiderte.
Nach einer Weile erhob er sich langsam. Er stand inmitten zahlloser Leichen, sah den alten MacCaffery taumeln und zu Boden sinken. Unbeugsam bis zum letzten Atemzug, starb er als freier Mann.
Und die Engländer rückten immer noch vor. Viele hundert Reiter. Doch die Pferde strauchelten im blutigen Schlamm, stolperten über die Toten. Ein Ritter stieg ab und eilte zu dem jungen Feind. Da stieß Brendan einen ohrenbetäubenden Schrei aus, den Kriegsruf der Schotten, der zum Himmel emporzusteigen schien und sogar die hartgesottenen, kampferprobten Engländer zögern ließ.
Dann stürmte er vor und schwang sein Schwert mit der Kraft seines Zorns, seines tiefen Kummers. Reihenweise brachen die Engländer zusammen, die meisten mit einem einzigen Streich niedergestreckt. Gnadenlos durchbohrte er ihre Kehlen. John war tot, der alte MacCaffery war tot – überall lagen Leichen und die verhassten Engländer galoppierten immer noch auf ihn zu.
Viel zu viele.
Aber er kämpfte nicht mehr allein. Als er einen Blick zur Seite warf, sah er die Farben und das Emblem seiner Familie. Sein Vetter Arryn war auf das Schlachtfeld geritten. Gemeinsam eilten sie durch die Schatten des Todes. In der Sonne glänzte blutroter Stahl.
Blut und Dunstschleier. Wer Freund oder Feind war ließ sich kaum noch erkennen. Schlamm verdeckte die Wappen auf den Rüstungen. Die Farben der schottischen Kilts waren noch schwerer zu unterscheiden.
Nach einer kurzen Atempause tauchten weitere Engländer am Horizont auf, in schimmernden Rüstungen. Ein faszinierender Anblick. Ehrfurcht gebietend. Tödlich.
»Auf die Pferde!«, schrie Arryn und die meisten Männer gehorchten.
Nur Brendan schüttelte den Kopf. »John ist tot – Mac- Caffery ist tot. Alle tot. Für sie will ich kämpfen, für die Freiheit – oder sterben!«
»Wenn wir nicht weiterleben, um uns gegen England zu stellen, wird Schottland niemals seine Freiheit gewinnen. Verdammt, Brendan, lauf zu deinem Pferd!«
Mit sechzehn hatte er die Freude des Sieges von Stirling ausgekostet.
Und jetzt, mit siebzehn, musste er die bittere Niederlage von Falkirk verkraften.
Arryn schwang sich auf seinen Hengst Achilles. Ein paar Sekunden zögerte Brendan noch. Dann stieg er auf sein Pferd und folgte dem Verwandten.
Neben Johns Leiche hielt er an. »Aye, mein Vetter! Für meine Liebe zu Schottland werde ich kämpfen. Das schwöre ich dir. Und ich will nicht rasten, bis Schottland für immer frei ist. Niemals werde ich kapitulieren!«
Inzwischen hatten ihn die Engländer beinahe eingeholt und er wartete. Ein letztes Mal drehte er sich um, tötete den ersten Ritter, der ihn angriff, dann den zweiten. Allmählich drängten sie ihn in den Wald zurück, warfen ihn beinahe aus dem Sattel, und er sprang aus eigenem Antrieb zu Boden. Ein Engländer stürzte sich auf ihn, und Brendan presste ihn gegen einen Baumstamm, bevor er ihn erstach.
Als er sich umdrehte, sah er jemanden im Schatten stehen, einen dunklen Umhang über einem Kettenhemd.
Freund oder Feind?
Er trat vor, und die Gestalt attackierte ihn, aber er parierte jeden Schwerthieb. Da wich sie zurück. »Nein – wartet ...«
Eine junge Stimme, eine weibliche Stimme. Der Umhang glitt von den Schultern und die Frau nahm ihren Helm ab. Verblüfft starrte er sie an. Ein junges Mädchen, in seinem Alter. Vielleicht noch jünger. Im Dunkel des Waldes schimmerten ihre Haare wie goldenes Feuer, die Augen in ihrem ebenmäßigen Gesicht hell wie Sterne – und genauso unschuldig.
Reglos stand er da – bis er Schritte hinter sich hörte. Der Feind im Rücken ... Blitzschnell fuhr er herum. Bevor ihm der Engländer den Kopf abschlagen konnte, bohrte sich Brendans Schwert in seine Kehle.
Irgendetwas traf seinen Hinterkopf. Durch seine Schläfen stach ein wilder Schmerz. Blindlings sank er auf die Knie. Das Mädchen hat mich niedergeschlagen, dachte er, bevor die Welt verblasste.
»Brendan!« Die Stimme seines Vetters rief ihn ins Bewusstsein zurück. Als er die Augen öffnete, sah er ihn herangaloppieren. Arryn stieg ab und zog Brendan auf die Beine. »Komm, wir müssen wegreiten, tiefer in den Wald hinein!«
Die Zähne zusammengebissen, packte Brendan den Sattel seines Pferdes und zog sich hinauf. Noch schlimmer als die Schmerzen war sein Zorn gegen sich selbst. Nie wieder würde er einem Feind trauen.
»Komm, mein Junge, halt dich fest!«, befahl Arryn.
Vor Brendans Augen verschwammen die Engländer, die zwischen den Bäumen heranritten, und er grub die Fersen in die Flanken seines Pferdes. Glücklicherweise folgte es Achilles. Während sie durch den Wald sprengten und die Engländer hinter ihnen zurückblieben, verfluchte Brendan seine eigene Dummheit. So lange und so hart hatten sie gekämpft und verloren.
Und dann war er auch noch von einem Mädchen niedergestreckt worden.
Aber er lebte.
Er war bereit gewesen, auf dem Schlachtfeld zu sterben. Jetzt gab er seinem Vetter Arryn Recht. Um die Freiheit zu erringen, musste er weiterleben. Niemals würde er sich den Engländern unterwerfen.
Niemals vergessen, niemals verzeihen.
In seinem Kopf dröhnte es qualvoll. Um ein Haar wäre er aus dem Sattel gefallen. Aber er hielt sich fest und blieb am Leben, dank seiner unerschütterlichen Willenskraft.
Für Schottland musste er überleben.
Um Vergeltung zu üben.
Bei Gott, eines Tages würde er herausfinden, wer sie war!
Rachsucht und Wut zwangen ihn, sich mit aller Kraft an sein Leben zu klammern.
Endlich fanden sie Zuflucht in der Tiefe des Waldes. »Mein Junge, wir sind in Sicherheit!« Er hörte Arryns raue Stimme, dann fiel er ihm in die Arme und wusste, er würde bald die Besinnung verlieren. Rotglühendes Dunkel hüllte ihn ein, wie ein Schatten aus Blut und Tod ...
Aye, er würde alles überstehen, was ihn peinigte, für Schottland kämpfen, das Mädchen finden.
Süße Rache – und Freiheit ...
Dies waren die letzten bewussten Gedanken, bevor er in schwarzer Nacht versank ...
1. Kapitel
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts 1301-1302
»Ein Piratenschiff!«, rief Captain Abram. »Mit vollen Segeln! Hart am Wind! Diesen Bastarden müssen wir davonfahren!«
Aufgeregt beugte sich der weißhaarige, bärtige Kapitän über die Reling.
Lady Eleanor of Clarin aus Yorkshire in England stand im Bug, spürte die salzige Gischt im Gesicht und den Wind, der an ihrem Haar und ihrer Kleidung zerrte. Die Stirn gerunzelt, wandte sie sich zu Abram – sie zweifelte an seiner Vermutung. Noch vor dem Wachtposten im Ausguck hatte sie das Schiff entdeckt und den Kapitän darauf hingewiesen. Ein schnelles Schiff ... Erstaunt beobachtete sie, wie es über die Irische See zu fliegen schien.
»Ein Piratenschiff?«, wiederholte sie. Sollte sie dem Kapitän glauben? Sie hatte von Seefahrern gehört, die vor keinem Wagnis zurückschreckten, um sich zu bereichern. Aber es gab nur wenige. Die Zeiten der Wikingerherrschaft über die Meere war vorbei. Und obgleich in den Adern vieler Menschen, die in Britannien, Irland und Europa lebten, Wikingerblut floss, würden die harten Strafen, die den Piraten drohten, die meisten Seemänner von solchen Missetaten abhalten. Gnadenlos verfolgte König Edward die Schurken, die seine Schiffe plünderten und das Geld stahlen, das er für seine endlosen Kriege brauchte.
»Aye, Piraten«, bestätigte Captain Abram erbost. »Und Ihr, Mylady, geht sofort unter Deck, in meine Kabine.«
»Wenn Piraten dieses Schiff kapern, bin ich in Eurer Kabine nicht sicherer als anderswo, Captain.«
»Lady Eleanor, ich beabsichtige, die Stellung an Bord zu halten!«
»Schon viele Männer haben dies oder jenes beabsichtigt.«
»Selbstverständlich werde ich kämpfen ...«, entgegnete er ärgerlich.
»Daran zweifle ich nicht.«
Seufzend musterte er die junge Frau, die schon so viel mit angesehen hatte. »Wenn diese Halunken das Schiff entern, könntet Ihr ermordet werden, Mylady. Von der zivilisierten Welt wissen die Piraten nichts.«
Falls sie in einer zivilisierten Welt lebte, hatte sie noch nicht viel davon gesehen. Ihre zivilisierte besorgte männliche Verwandtschaft hatte sie zu dieser Reise veranlasst. »Vielleicht sind es gar keine Piraten, sondern meine Vettern.«
»Dieses Schiff kenne ich. Es gehört einem französischen Seeräuber namens Thomas de Longueville. Mylady, ich werde Euch nicht gestatten zu sterben!«
Natürlich nicht, dachte sie bedrückt und fragte sich, ob sie vielleicht nach Frankreich fuhr, weil sie den Tod herbeisehnte. Diesen Gedanken behielt sie indes für sich. »Ich musste auf meinem Familiensitz nördlich von York miterleben, wie Wallace, dieser wilde Schotte, einen Stall anzündete, in dem dreißig Männer gefangen saßen. Um die Holzwände zu zerhacken, trotzte ich einem Schlächtertrupp. Also kann ich es auch mit Piraten aufnehmen.«
Abram wich ihrem Blick unbehaglich aus. »Aye, die Leute halten Euch für eine Heilige und die Krieger von York sind Euch zum Schlachtfeld von Falkirk gefolgt. Aber hier sind wir auf dem Meer. Ein Enterhaken könnte Euch tödlich treffen – oder ein Mast, der herabstürzt ... Bitte, ruft Eure Zofe und geht unter Deck.«
»Bei allem Respekt, Captain ...«
»Hört Ihr eigentlich auf niemanden, Mädchen?«, stieß er hervor und der heisere Klang seiner Stimme jagte ihr endlich Angst ein. Als sie über ihre Schulter spähte, stellte sie erschrocken fest, wie nahe das Piratenschiff inzwischen herangekommen war.
Jetzt erschien ihr Abrams Schiff wie ein armseliger, ächzender Kahn, der im Schneckentempo dahinkroch. Vom Ersten Offizier kommandiert, rannte die Besatzung umher. Was sie in den Augen der Männer las, warnte sie noch eindringlicher als die Worte des Kapitäns vor dem drohenden Unheil.
Stolz und kühn, alle Segel gebläht, durchpflügte der Verfolger die Wellen.
»Eleanor!« Die Zofe Bridie lief die Stufen herauf, die zur Kapitänskajüte führten. »Seid Ihr taub, Kindchen? Gleich werden die Piraten über uns herfallen!«
Trotz der prekären Lage hob Eleanor die Brauen, pikiert über diesen Ton, den Bridie für gewöhnlich nicht anschlug. Glaubte die Zofe tatsächlich, sie müssten um ihr Leben bangen? »Bridie ...«, begann sie.
Aber da rannte Bridie bereits über das Deck und wich den Seemännern aus, die sich verzweifelt bemühten, das Tempo des Schiffs zu beschleunigen. Nur drei Jahre älter als Eleanor, war sie ihr eine treue, tapfere Gefährtin. Entschlossen nahm sie ihre Herrin in die Arme. »An jenem Tag war ich dabei, Mylady. Ich weiß, welche Angst Ihr ausstehen musstet. Und dann seid Ihr auch noch aufs Schlachtfeld geritten ... Das alles ist mir bewusst. Aber ich flehe Euch beim Blut der Heiligen Jungfrau Maria an – redet Euch nicht ein, Ihr wärt so stark wie ein Mann. Kommt mit mir!«
Eleanor schluckte krampfhaft. Bei diesen Worten verließ sie der Mut. O ja, sie hasste das Blutvergießen, die Angst, die Kämpfe, den Tod ... Und es war kein Mut gewesen, der sie auf Castle Clarin angetrieben hatte, sondern reiner Wahnsinn. Doch sie hatte viel gelernt. Über Schlachten und Männer.
»Bitte!«, flüsterte Bridie.
»Schon gut, gehen wir unter Deck.« Eleanor folgte ihrer Zofe zur Treppe, spürte das Schwanken des Schiffs, geriet aber nicht aus dem Gleichgewicht. Vor Wind und Wellen fürchtete sie sich nicht. Nur vor der Gefahr, eingesperrt zu werden.
Ehe sie die Stufen erreichten, wurden beide Frauen von einer gewaltigen Erschütterung zu Boden geworfen. Das ganze Schiff schien zu stöhnen – verwundet, gerammt, von gnadenlosen Feinden angegriffen. Hastig verließen die Besatzungsmitglieder ihre Posten und zückten die Waffen. Wie Silbervögel flogen Enterhaken durch die Luft, wie Stahlzähne bohrten sie sich in die Decksplanken. Piraten sprangen an Bord und ein wilder Kampf begann. Entsetzt sah Eleanor den Blick eines sterbenden Seemanns brechen, sein Blut floss zu ihr.
»Steh auf!«, befahl sie der Zofe. Sekunden später rannten sie die Treppe hinab, und zwei Männer, die ihre Waffen verloren hatten, stürmten hinter ihnen in die Kabine. Eleanor erkannte den Ersten Offizier, den ein Angreifer an der Kehle gepackt hatte. Entschlossen nahm sie die schwere, kostbare Bibel vom Schreibtisch des Kapitäns und warf sie dem Piraten an den Kopf. Der verdrehte die Augen und stürzte auf die Planken.
Verwirrt wandte sich der grauhaarige Erste Offizier zu seiner Retterin. Bridie hob die Bibel auf und hielt sie hoch. »Der Herr steht auf unserer Seite!«
»Tatsächlich?« Alle Blicke richteten sich auf den hoch gewachsenen Mann, der am Türrahmen lehnte. »Das glaube ich nicht, Mademoiselle«, fuhr er fort, betrat die Kabine und nahm seinen Hut ab. »Darf ich mich vorstellen? Thomas de Longueville. Im Augenblick steht Gott auf meiner Seite.« Er mochte in mittleren Jahren sein. Aber Wind und Wetter auf hoher See hatten sein Gesicht gegerbt, sodass er älter wirkte. Er trug Breeches aus gefärbtem dunklem Leinen, ein weißes Hemd, eine preißelbeerfarbene Weste und hohe Stiefel. Mit schmalen Augen sah er sich aufmerksam um: »Ah – also stimmt es. Lady Eleanor of Castle Clarin, nehme ich an. Ihr segelt nach Frankreich, um einen reichen Mann aufzusuchen – um die Geldkisten, die Eure Feinde geplündert haben, wieder zu füllen. Gott segne die wilden Seelen der Schotten. Mal sehen, was dieser Mann bezahlen wird, um Euch zu gewinnen ...«
Plötzlich sprang der Erste Offizier vor, der an die Wand zurückgewichen war. »Elender Schurke! Wenn Ihr die Lady anfasst ...«
Der Pirat zog ein Messer und Eleanor trat hastig zwischen die beiden Männer. Dabei stieß sie mit dem Ersten Offizier zusammen und der Aufprall warf sie an die Brust des Piraten. In den Augen des Franzosen erschien ein beunruhigendes Glitzern und sie zuckte zurück. »Heute sind schon genug Männer gestorben!«
»Wollt Ihr das entscheiden?«, fragte Thomas de Longueville und hob belustigt die Brauen.
»Tötet Ihr Eure Gegner zum Vergnügen? Ihr habt das Schiff gekapert und keinen Grund, diesen Mann umzubringen.«
»Aye, das Schiff gehört mir. Und was Euren Freund betrifft ...« Nach kurzem Zögern rief er: »Jean!« Einer der Piraten rannte in die Kabine. »Wirf den Kerl über Bord. Aber du darfst ihn nicht töten. Sieh zu, dass er lebend ins Wasser fällt!«
»Setzt ihn in ein kleines Boot!«, fauchte Eleanor, als ein weiterer Pirat herbeieilte und der Erste Offizier hinausgeschleift wurde.
»Was für eine Nervensäge Ihr seid!«, seufzte Thomas de Longueville. »Die Beschützerin von Castle Clarin, nicht wahr? Santa Leonora, eh?«
»Sie ist eine vornehme, sanftmütige Lady!«, log Bridie und legte einen Arm um die Schultern ihrer Herrin. »Und wenn Ihr – wenn Ihr ...« Ihre Stimme erstarb. Brennend stieg das Blut in ihre Wangen.
»Vielleicht darf ich erklären, was sie Euch mitzuteilen versucht«, stieß Eleanor hervor. »Wenn Ihr mir zu nahe tretet, werde ich meinem künftigen Bräutigam nicht mehr viel wert sein.« Spielte das überhaupt eine Rolle? In einem unterdrückten, gepeinigten Land geboren, führte sie seit dem Tod ihres Vaters ein Leben, das einer bitteren Farce glich.
»Und wenn’s mich nicht kümmert, was ich an Euch verdienen würde?«, konterte er, immer noch amüsiert.
»Und wenn mir gar nichts wichtig ist? Wenn ich ins Meer springe?«
Ärgerlich runzelte er die Stirn. Ehe er antworten konnte, kehrte Jean zurück. »Ein Schiff!«
»Ein Schiff?«
»Aye, und es segelt auf uns zu!«
Trotz der drohenden Gefahr nahm sich Thomas de Longueville genug Zeit für eine höfliche Verbeugung. »Entschuldigt mich vorerst. Welch eine bedauerliche Störung, Lady Eleanor, wo wir uns doch eben erst kennen lernen! Ich werde diesen neuen Feind möglichst schnell erledigen und dann zu Euch zurückkehren. Natürlich will ich mit ansehen, wie Ihr im Meer versinkt!«
Die Tür fiel hinter den beiden Piraten ins Schloss. Als Eleanor hörte, wie der Riegel vorgeschoben wurde, schrie sie verzweifelt auf.
»Mylady ...«, rief Bridie und eilte zu ihr.
Eingesperrt! Das ertrug Eleanor nicht.
Plötzlich wurde sie zurückgeworfen und prallte gegen den Schreibtisch des Kapitäns. Das Schiff erzitterte, Holz ächzte und knackte.
Und dann – Rauchgestank ...
»Feuer!« Angstvoll wandte sie sich zu Bridie.
»Bis hierher werden die Flammen nicht dringen ...«
»Wir werden nicht verbrennen. Lieber lasse ich mich erstechen!«
»Eleanor ...«
»Das halte ich nicht aus ...« Von wachsender Panik getrieben, schaute sich Eleanor in der Kabine um, auf der Suche nach einer Waffe, mit der sie die Tür aufbrechen konnte. Endlich fand sie eine Axt hinter dem Vorhang, der das Bett des Kapitäns abschirmte. Vielleicht eine Streitaxt oder einfach nur ein Werkzeug – das wusste sie nicht und es war ihr auch gleichgültig.
Entschlossen hob sie die Axt.
»Nicht, Mylady!«, mahnte Bridie. »Captain Abram hat gesagt, wir müssen hierbleiben. Sonst werden wir womöglich getötet, versehentlich oder sogar mit Absicht ...«
Entgeistert starrte Eleanor ihre Zofe an. »Riechst du das Feuer nicht? Sollen wir wie gefangene Ratten verbrennen?«
»Aber – Mylady ...«
»Wie ich sterbe, ist mir egal, solange ich nicht in lodernden Flammen umkomme! Hör doch, Bridie! Feuer an Bord!«
Da stieg der Brandgeruch auch in Bridies Nase. »O Gott – ja! Was kann ich tun, Eleanor? Lasst Euch helfen ...«
»Tritt zurück, Bridie! Mit solchen Geräten kann ich gut umgehen.«
Eleanor schwang die Axt. Mit einem einzigen Schlag zertrümmerte sie die Tür.
»Können wir das Schiff kapern?« Brendan schaute durch das Fernglas des Kapitäns.
»Aye, wenn du willst ...«, erwiderte Eric Graham, ein Verwandter, der die Wasp kommandierte.
»Natürlich will ich’s.«
Auf dem Meer bot sich ein sonderbarer Anblick. Piraten hatten ein englisches Schiff geentert, das unter der Flagge Edwards I. segelte, und der Kampf tobte noch. Auf beiden Seiten waren mehrere Männer umgekommen, beide Schiffe hatten schwere Schäden erlitten.
Zur Besatzung der schnittigen, im norwegischen Stil erbauten Wasp zählten Seemänner, in deren Adern Wikingerblut floss. Und Schotten, in vielen Schlachten erprobt – zu oft besiegt.
»Kennst du das Piratenschiff?«, fragte Eric. Im Gegensatz zu seinem schwarzhaarigen Vetter war er kupferblond, mit einem Lockenkranz, der eine Glatze umgab, und einem dichten Bart. Beide Männer hatten blaue Augen – Eric in hellerem nordischem Blau, Brendan in leuchtendem Kobalt. »Nun, kommt dir die Flagge bekannt vor?«
»Die meiste Zeit habe ich an Land gekämpft, Vetter«, erwiderte Brendan. So viele Jahre lang ... Jetzt erinnerte er sich kaum noch an die Zeiten, wo er ein Junge aus gutem Haus gewesen und die Kriegskunst erlernt, aber seine Nächte mit Büchern und Fremdsprachen, Mathematik, Geschichte und Musik verbracht hatte. »Ich fahre noch nicht lange zur See.« Und seine Gedanken waren meist woanders. Um die verschiedenen Flaggen kümmerte er sich nicht. »Willst du’s mir nicht verraten, Eric?«
»Das Schiff gehört Thomas de Longueville.«
»Dem berüchtigten Franzosen?« Sogar Brendan hatte diesen Namen schon gehört.
»Aye, ein faszinierender Mann. Immer schlägt er im richtigen Augenblick zu.«
»Und er hat ein englisches Schiff gekapert? Los, greifen wir an!«
»Wäre Wallace damit einverstanden? Wir sind in nationaler diplomatischer Mission unterwegs.«
»Glaubst du, er hätte was dagegen, wenn wir auf der Reise nach Frankreich einen französischen Piraten besiegen, der ein Schiff unter Englands Flagge gekapert hat? Sicher nicht!«
Eric drehte sich um und richtete das Fernrohr nach achtern, auf Wallaces Schiff, das der Wasp in einigem Abstand folgte. Bevor die ungewöhnliche Szene vor ihren Augen erschienen war, hatten sie sich auf eine Schlacht vorbereitet.
So wie immer. Obwohl sie diesmal in diplomatischer Mission über das Meer segelten.
Nach der Niederlage von Falkirk kämpfte William Wallace immer noch um Schottlands Freiheit. Und es gab kaum einen Mann, dessen Tod der englische König freudiger begrüßen würde. Beharrlich blieb William seinem Ideal von einem unabhängigen Schottland treu. Er war kein Aristokrat mit Erbrechten auf Pächter, die ihm in Kriegszeiten dienen mussten. Aber er wusste seine Anhänger mitzureißen und anzufeuern. Seit den schweren Verlusten bei Falkirk griff er die englischen Truppen, die im Süden Schottlands Stellung bezogen hatten, unermüdlich an, blitzschnell und überraschend, mit einer klugen Strategie, die sich immer wieder gegen die Übermacht behauptete.
Die Niederlage von Falkirk hatte den Schotten auch einige Vorteile gebracht. Seither wurden ihre Aristokraten gezwungen, Verantwortung für das Land zu übernehmen.
Aber Edward I. von England würde seine Ansprüche niemals aufgeben. Nur sein Tod würde Schottland endgültig befreien. Zurzeit führte er andere Kriege und er besaß nicht genug Streitkräfte, um Schottland zu unterwerfen – ein Ziel, das er nach wie vor anstrebte und zu einem späteren Zeitpunkt erneut verfolgen würde.
Manchmal fragte sich Brendan, warum William Wallace – der große Krieger und Anführer – die Situation so gelassen hinnahm. Die Freiherren hatten seine Macht, seine beflügelnde patriotische Leidenschaft, sein Blut und seinen Schweiß zum Wohle Schottlands genutzt, aber niemals wirklich hinter ihm gestanden.
In Williams Augen war John Baliol immer noch der schottische König – der gesalbte König. Aber John Comyn, der Rote genannt, stammte aus derselben alten schottischen Königsdynastie wie Robert de Bruce. Man munkelte, John Comyn sei mit seinen Truppen vom Schlachtfeld bei Falkirk geflohen. Deshalb trage er die Schuld an der Niederlage. Eine Zeit lang hatten Comyn und Bruce Schottland gemeinsam verwaltet und die Engländer eher versteckt attackiert. Doch die alten Rivalitäten zwischen den beiden drohten die ohnehin geringfügige schottische Vormacht zu untergraben. Erst dankte Bruce ab, dann Comyn, und John Soulis, ein tapferer Schotte, hütete das Land im Namen des abwesenden Königs Baliol.
Wallace hatte all diese Ereignisse beobachtet, hatte Eigeninteressen sowie die Hab- und Machtgier der Freiherren gefürchtet. Beim geringsten Anzeichen einer Gefahr würden sie vor Edward kapitulieren, um ihre Ländereien und Adelstitel zu behalten.
Wenn William Wallace kämpfte, hatte er nichts zu verlieren. Und jetzt durfte er neue Hoffnung schöpfen.
John Baliol, der unglückliche König, war aus der päpstlichen Gefangenschaft in Italien, wohin Edward ihn verbannt hatte, entlassen worden und nach Frankreich gereist. Deshalb segelten Wallace und seine Streitkräfte zum französischen König, einem traditionellen Verbündeten der Schotten.
»Also gut.« Eric warf Brendan einen kurzen Blick zu. »Wenn William nichts dagegen hat, greifen wir an!«
»Aye!« Brendan eilte über das Deck zu seinen Männern.
Erwartungsvoll schauten sie zum Ruder, wo er mit Eric gesprochen hatte. Mit einer solchen Aktion hatten sie gerechnet. Während die Wasp ihre Flotte anführte, hielten sie nach Engländern Ausschau, die Wallace nur zu gern festnehmen und Edward ausliefern würden.
»Dieses Schiff holen wir uns!«, rief Brendan grinsend und zitierte die berühmten Worte des Anführers William, den sie alle bewunderten. »Nicht zum Ruhm, sondern für die Freiheit! Für Schottland!«
»Immer für Schottland!«, stimmte Liam MacAllister zu, ein großer kräftiger Mann mit erbaulichem Humor und flammend rotem Haar. »Und für die Schätze, die wir vielleicht an Bord finden werden – was, Brendan? Die brauchen wir für unsere leeren Geldschatullen!«
Alle Männer jubelten ihm zu und Brendan nickte. »Weiß Gott, Liam! Dieses sinkende Schiff wollen wir bis auf die letzte Münze plündern!«
Jetzt schrien sie noch lauter, wie so oft, wenn sie sich vor einem Kampf gegen die englische Übermacht Mut machen wollten.
»Volle Segel!«, befahl Eric seiner Besatzung und eilte zu Brendan. »Zweifellos sind sie in der Überzahl.«
Brendan schnitt eine Grimasse. »Bei meinen bisherigen Schlachten waren wir immer in der Unterzahl.« Er wandte sich zu seinen Leuten. »Brennende Pfeile, meine Freunde! Wenn wir an Bord gehen, müssen die Gegner alle Hände voll zu tun haben, um ihre Haut vor den Flammen zu retten. Die besten drei treten vor! Liam, Collum, Ainsley – eine gewaltige Salve! Setzen wir sie mit Pech und lodernden Fetzen in Brand!«
Sofort rannten die Männer davon, um den Befehl auszuführen. Im Lauf der Zeit hatten sie eine ganze Menge von Edwards hervorragenden Bogenschützen gelernt.
Mit hellem Feuer verkündeten sie den Engländern und Piraten ihre Ankunft.
»Schnell, Bridie!« Eleanor und ihre Zofe sprangen über die Splitter der zertrümmerten Tür hinweg und rannten an Deck. In diesem Augenblick flogen brennende Pfeile über das Meer heran und bohrten sich in Segel und Masten.
Angstvoll duckte sich Eleanor und zog Bridie hinab. Ein loderndes Geschoss sauste dicht an ihrem Kopf vorbei. Noch brannte das Schiff nicht.
In solchen Kämpfen erfahren, versuchten die Piraten die Flammen zu löschen und rüsteten sich, um die Angreifer gebührend zu empfangen.
Nicht weit von den beiden Frauen entfernt, stand de Longueville an der Reling, fluchte lauthals und erteilte seine Befehle. »Nun haben die Schotten ihren Krieg vom Land aufs Meer verlagert! Pfeile. Pfeile!« Wütend schwang er seine Faust in die Richtung des Schiffs, das seine Beute jeden Augenblick rammen würde. »Kämpft! Zieht eure Schwerter! Ausgerechnet Schotten! Mon Dieu!«
Enterhaken schlugen in die Planken. Wie durch ein Wunder wurde das englische Schiff nicht zerquetscht. An der Backbordseite lag das Piratenschiff vertäut und die neuen Feinde attackierten die Steuerbordseite.
»Aye, Pirat, wir haben unsere Schwerter gezogen!«, erklang ein donnernder Ruf.
Eleanor wandte sich zu dem Schiff, das soeben herangesegelt war. In der Takelage hing der Mann, dessen Stimme sie gehört hatte. Mit einer Hand umklammerte er die Taue, mit der anderen seine Waffe.
Schotten.
Entsetzt starrte sie auf das blaugrüne Schottenkaro seines Tartans, den er über engen dunklen Hosen, einem Leinenhemd und hohen Stiefeln trug. An einer Schulter wurde der Umhang von einer großen keltischen Brosche zusammengehalten.
Das Schwert gezückt, sprang er erstaunlich geschmeidig aus der Takelage auf das englische Schiff – ein junger Mann mit pechschwarzem Haar, das seine Schultern fast berührte. In seinem markanten, glatt rasierten Gesicht, das von der Sonne gebräunt war, leuchteten tiefblaue Augen. Er hatte Thomas de Longueville auf Französisch angesprochen.
Dennoch war er ein Schotte.
Unzivilisiert, verrückt, wild. Barbaren stürmten über das Deck, grausame Männer, die einander wegen belangloser Streitigkeiten töteten und wie Wölfe über ihre Gegner herfielen.
Aber der Anführer der Piraten war bereit zum Kampf. Klirrend prallten die Schwerter aufeinander.
Immer mehr Schotten stürmten mit gälischem Kriegsgeschrei das Deck. Diesen Ruf kannte Eleanor. Auch norwegische Flüche ertönten. In das ohrenbetäubende Gebrüll mischten sich die zivilisierten Stimmen der Franzosen. Während Eleanor neben Bridie auf dem Absatz der Treppe stand, die zur Kabine führte, beobachtete sie ungläubig das wilde Getümmel.
»O nein! Das muss ein böser Traum sein!«, klagte Bridie. Ein Mann fiel ihr vor die Füße. Grinsend schaute er sie an, sprang auf und wehrte sich erneut gegen den bulligen Schotten, der ihn niedergestreckt hatte. »Ein Angriff ist schon unhöflich genug!«, kreischte die Zofe empört. »Aber gleich zwei ...« Vor lauter Wut vergaß sie beinahe ihre Angst.
»Unhöflich? Bridie, wir blicken dem Tod ins Auge! Hier geht es nicht um Manieren. Wir müssen überlegen, was wir tun sollen ...«
»Gehen wir in die Kabine zurück!«, flehte Bridie. »Inzwischen wurde das Feuer gelöscht und die Tür ist zerbrochen. Also wären wir nicht gefangen. Wenn wir hier draußen bleiben, werden uns diese elenden Schurken erstechen!«
»Nein!« Jederzeit konnte ein neues Feuer ausbrechen, und Eleanor fand diese Gefahr viel schlimmer als den erbitterten Nahkampf, der ringsum tobte. »Laufen wir nach achtern, Bridie!«, entschied sie, packte die Hand ihrer Zofe und zerrte sie zwischen zwei Männern hindurch, bevor diese sich aufeinander stürzten.
Die zwei Frauen rannten an der Reling entlang, hinter die Masten, zum anderen Ende des Schiffs. Hier blieb Eleanor stehen, rang nach Luft und starrte ins schäumende Wasser hinab. Auf der Irischen See sah man nur selten sanfte Wellen. Nach einem sonnigen Morgen hatten sich dunkle Wolken zusammengeballt, als wollten sie die Seeschlacht ankündigen. Seufzend untermalte der Wind das Klirren der Schwerter.
»O Gott, Eleanor!«, jammerte Bridie. »Ihr wollt doch nicht ...«
»Ins Wasser springen? Meinst du das?«
»Und was habt Ihr vor? In der Kabine wären wir besser dran.«
»Bevor ich verbrenne, möchte ich lieber ertrinken.« Eleanor blickte wieder ins aufgewühlte Wasser. Aye, sie konnte schwimmen. Zur Küste? Von hier aus? Wohl kaum. Und welche Bestien lebten im Meer? Haie mit messerscharfen Zähnen, tödlicher als alle Schwerter. Meeresungeheuer, über die man in den Tavernen die schaurigsten Geschichten erzählte. Kreaturen, die Menschen zerquetschten und aussaugten ...
Immer noch besser als die Flammen!
»Alors!«
Erschrocken drehte sich Eleanor um und sah einen der französischen Piraten heranstürmen, einen Mann mit tintenschwarzem, fettigem Haar, tückischen Augen und einem seltsamen Spitzbart. »Kommt zurück!«
»Bei Gott, ich springe!«, flüsterte Eleanor und umklammerte die Reling.
Ehe sie sich emporschwingen konnte, rannte ein anderer Mann nach achtern und zog ein Messer aus seinem Stiefelschaft, warf sich auf den Franzosen und erstach ihn mühelos.
Das Schwert des Piraten schlitterte über die Planken und Eleanor griff instinktiv nach der scharf geschliffenen Waffe, einem französischen Rapier ... Abschätzend wog sie es in einer Hand, dann sah sie den Feind auf sich zulaufen, der den Franzosen innerhalb weniger Sekunden getötet hatte. Der dunkelhaarige Barbar, der zuerst auf das Deck gesprungen war, der Anführer ... Irgendetwas hatte er an sich ...
»Legt die Waffe nieder, Lady«, befahl er leise in kultiviertem normannischem Französisch.
Doch sie ließ sich nicht täuschen. Diese Männer kannte sie zur Genüge.
»Nein, verschwindet, Hochländer! Geht in Frieden und lasst mich in Ruhe!«
»Seid Ihr Engländerin?«
»Auf dem Weg zu meinem französischen Verlobten. Also nehmt Euch in Acht!«
In seinen kobaltblauen Augen funkelte unverhohlene Belustigung, noch intensiver als zuvor in Thomas de Longuevilles dunklem Blick. Und wie seltsam er sie anschaute ... Kannte er sie?
»Lasst das Schwert fallen, Lady. Danach wollen wir uns über Euren Verlobten, Eure Reise – und Eure Zukunft unterhalten.«
»Sobald man Schotten gegenübersteht, gibt es keine Zukunft mehr!«, fauchte sie verächtlich.
»Gebt mir das Schwert oder ich muss es mir nehmen.«
»Bitte, Mylady!«, flehte Bridie. »Um Himmels willen, übergebt ihm die Waffe!«
Eleanor raffte ihre Röcke und trat vor. Nein, sie würde nicht verbrennen – vielleicht ertrinken, aber niemals verbrennen und sich niemals der Gnade eines Schotten ausliefern!
»Lasst endlich die Waffe fallen!« Der Mann zog sein eigenes Schwert und stürzte sich auf Eleanor, um ihr das Rapier aus der Hand zu schlagen.
Aber sie parierte den Streich so schnell, dass sie ihn überrumpelte. Blut quoll aus seinem Arm. Verwirrt starrte er die Wunde an und Eleanor genoss ihren kleinen Triumph in vollen Zügen. Doch sie hätte das Überraschungsmoment sofort nutzen müssen. Als sie ihn schließlich angriff, war er längst bereit zum Kampf und trieb sie an die Reling zurück. Sie erkannte die Gefahr ihrer mangelnden Bewegungsfreiheit und versuchte, eine bessere Position zu erreichen. Obwohl jeder Schwerthieb sie schwächte, kämpfte sie verbissen weiter. Bald schien die Welt nur noch aus klirrendem Stahl zu bestehen.
Und dann merkte sie, dass der Schlachtenlärm an Bord verstummt war. Sekundenlang hielt sie inne und sah sich um. Wer den Sieg errungen hatte, wusste sie nicht.
Da standen Schotten, Franzosen und Norweger. Captain Abram und seine Besatzung waren verschwunden.
Getötet oder ins Meer geworfen. Eleanor war von Feinden umringt – von Piraten und barbarischen Hochländern.
Plötzlich prallte das Schwert ihres Gegners mit einer Wucht gegen die Schneide ihres Rapiers, die ein heftiges Zittern durch ihren Arm und den ganzen Körper jagte. Sogar die Zähne klapperten.
In den blauen Augen des Schotten, die dem stürmischen Meer glichen, las sie grimmige Entschlossenheit. Seine Lippen waren zusammengepresst. Eine Hand verbarg er hinter seinem Rücken, mit der anderen schwang er sein Schwert. Allzu viel hatte Eleanor ihm nicht angetan. Doch sie freute sich über das Blut, das seinen linken Ärmel tränkte.
Und sie weigerte sich immer noch, das Rapier loszulassen, holte tief Atem und bat den Allmächtigen um neue Kräfte.
Als sie vorsprang und auf sein Herz zielte, wich er erst in letzter Sekunde zur Seite. Diesmal konnte ihr die Angst vor den Flammen oder der ewigen Verdammnis nicht mehr helfen, den gewaltigen Schwertstreich zu parieren. Klirrend fiel das Rapier zu Boden. Eleanor stand reglos da und starrte den Schotten an.
Nein, sie kannte ihn nicht. Oder doch? Irgendetwas Vertrautes, eine vage Erinnerung an diese Augen ...
Ringsum erklang schrilles Geschrei. Vielleicht bejubelten die Piraten oder sogar die Schotten Eleanors Mut – und ihre Dummheit.
Mit schmalen Augen erwiderte der schwarzhaarige Mann ihren Blick. Auch er wusste, dass sie einander schon einmal begegnet waren.
»Wer seid Ihr?«, fragte er in sanftem Ton.
»Wer seid Ihr?«
Plötzlich entsann sie sich. Ihr Atem stockte. Vielleicht dachte er ebenfalls an jenen Tag, denn seine Miene schien sich zu verdüstern. Er trat einen Schritt näher und ihr Herz schlug wie rasend.
So schnell ihre Beine sie trugen, rannte sie an ihm vorbei, geradewegs zum Heck. Ohne Bridies Schreckensschrei zu beachten, sprang sie über die Reling und warf sich ins Meer.
2. Kapitel
Ungläubig stand Brendan an der Reling.
Mitten im Winter war sie in die Irische See gesprungen, in eiskaltes, schäumendes Wasser. Ein düsterer Himmel hatte den schönen, sonnigen Tag verdrängt.
Diese närrische Engländerin! Soll sie doch ertrinken!
Der bittere Gedanke schien ihn zu lähmen. Vor über drei Jahren hatte er sie verschont. Fast wäre er deshalb gestorben, und er hatte sich geschworen, sie zu finden und Rache zu üben.
Und jetzt war sie plötzlich in sein Leben zurückgekehrt. In der Zwischenzeit hatten sie sich beide verändert. Er hatte sie nicht sofort erkannt. Das verstand er nicht, denn sie hatte einzigartige graublaue Augen, so stürmisch wie das Gewitter, das sich gerade zusammenbraute. Ihre Züge hatte er sich eingeprägt, aber trotz seiner Rachsucht nicht erwartet, sie tatsächlich wieder zu sehen. Nach dem Kampf bei Falkirk war er von einem Schlachtfeld aufs andere gezogen. Und sie hatte außerhalb seiner Reichweite gelebt, im Herrschaftsbereich des englischen Königs. Da er nicht auf diese Begegnung gefasst gewesen war, hatte sie ihn zunächst nicht an jenes tückische Mädchen erinnert.
Nun war sie hier.
Wie ein Geschenk auf einer Silberplatte.
Und sie hatte sich ins Meer gestürzt ...
Ohne noch länger zu überlegen, stieg er auf die Reling und sprang hinterher. Die Eiseskälte der Irischen See drang ihm bis auf die Knochen, die Wellen zerrten an ihm, schleuderten ihn hin und her. Sekundenlang fühlte er sich den Gewalten der Elemente hilflos ausgeliefert. Energisch schlug er um sich und tauchte auf, blinzelte das Salzwasser aus seinen Augen, sah sich um und vergeudete seinen kostbaren Atem, um die Engländerin zu verfluchen.
Bald hatte er sie zwischen den Wellenbergen entdeckt und tauchte wieder unter. Um sich zu erwärmen, schwamm er mit kraftvollen Zügen zu ihr. Als er emportauchte, um Luft zu schnappen, sah er sie sofort. Glücklicherweise konnte sie schwimmen und war nicht in einem tödlichen Strudel hinabgesogen worden, der in dunkler Tiefe endete ...
Er schwamm unter der Oberfläche des Meeres weiter, tauchte wenig später wieder auf und trat Wasser. Inzwischen hatte er die Engländerin fast eingeholt – wahrscheinlich nur wegen der langen Röcke, die ihre Beine behinderten.
Als sie versank, schwamm er hastig weiter und bekam ihr Kleid zu fassen. Unter Wasser starrte sie zu ihm herauf. Wie ein goldenes Banner trieb ihr Haar in den Wellen und glänzte sonnenhell, trotz der grauen Wolken, die das Meer trübten. Ihr Blick streifte seine Finger, die mehrere Falten ihres Rocks umfassten.
Plötzlich hielt sie ein Messer in der Hand. Würde sie ihn erneut überrumpeln?
Aber die Klinge traf ihn nicht. Stattdessen zerschnitt die Engländerin ihr Kleid, befreite sich und schwamm davon. Jetzt sah er schlanke, wohlgeformte Beine durch das Meer gleiten.
Wohin wollte sie fliehen? Was glaubte sie, wie weit sie kommen würde, bevor sie ermüdete und ertrank?
Nachdem er Atem geschöpft hatte, folgte er ihr, wieder unterhalb der Wellen, wo er schneller vorankam als die junge Frau an der Oberfläche. Ein paar Sekunden später umklammerte er ihren Fußknöchel und riss sie zurück. Unter Wasser wandte sie sich zu ihm, von schwebenden feurigen Haaren umrahmt, die einer Gloriole glichen. In ihrer Hand schimmerte das Messer. Blitzschnell packte er ihr Handgelenk, verdrehte ihr den Arm und zwang sie, die Waffe loszulassen, die in undurchdringlicher Finsternis verschwand.
Dann zog er seine Gefangene zur Oberfläche hinauf. Damit sie ungehindert Wasser treten konnte, ließ er sie los. Regen prasselte herab. Hinter Gewitterwolken verbarg sich das letzte Tageslicht. Brendan strich das nasse Haar aus seinem Gesicht und sah ein kleines Beiboot von der Wasp auf sich zufahren. »Wie dumm Ihr seid, Lady!«, stieß er hervor. »Beinahe hättet Ihr Euch umgebracht.«
»Lieber sterbe ich von meinen eigenen als von Euren Händen!«
»Selbstmord ist eine schwere Sünde.«
»Vielleicht wäre ich am Leben geblieben.«
»Ihr hättet die Küste niemals erreicht.«
Erbost warf sie ihr langes Haar in den Nacken. »Oder Ihr hättet die Küste nicht erreicht. Ich wollte hinschwimmen.«
»Offenbar seid Ihr von Euren Fähigkeiten so fest überzeugt, dass man an Eurem Verstand zweifeln muss.«
»Und das aus dem Mund eines dieser überheblichen Schotten, die sich für die stärksten Männer auf Gottes Erde halten!«
Beinahe hätte er sie untergetaucht und ertrinken lassen. Auf den Schlachtfeldern hatte er zahlreiche Feinde getötet, zum Ruhm Schottlands, für die ersehnte Freiheit. Aber einen kaltblütigen Mord könnte er niemals begehen.
Im eisigen Salzwasser und strömenden Regen sollte er eigentlich nur noch ans Überleben denken. Trotzdem missgönnte er ihr das letzte Wort. »Die Schotten haben schon oft eine Übermacht besiegt, Mädchen.«
Herausfordernd reckte sie ihr Kinn aus den Wellen. »Ich bin kein Mädchen – und eine ausgezeichnete Schwimmerin.«
»Gewiss, aber nicht schnell genug.«
»Brendan!«
Als er Erics Stimme hörte, drehte er sich um. Sein Vetter saß mit Collum in dem kleinen Boot, das mittlerweile nähergekommen war. Zwischen den hohen Wellen würden sie Brendan und die junge Frau kaum sehen. »Hier!«, rief er. Sobald er sich abgewandt hatte, war sie davongeschwommen. Aber er griff wieder nach ihrem Fußknöchel, zerrte sie zurück und sie ging unter. Prustend und keuchend tauchte sie auf. Inzwischen schaukelte das Boot direkt neben ihnen. Starke Hände zogen das Mädchen an Bord, dann kletterte Brendan hinein und sank atemlos auf eine Bank.
»Kalt?«, fragte Eric grinsend.
Brendan schaute in die blauen Augen seines nordischen Verwandten. »Wie Hexentitten ...«
Plötzlich entsann er sich, dass niemand anderer als Lady Eleanor of Clarin im Boot saß. Wie sie hieß, hatte er schon vor einiger Zeit herausgefunden. Und sie hielt alle Schotten für ungebildete Rüpel, die niemals Bücher in die Hand nahmen.
Sie kauerte achtern neben Collum, einem großen, kräftigen Burschen mit feuerrotem Haar. Während Eric zu den Schiffen zurückruderte, stellte Brendan fest, dass die Männer alle Enterhaken entfernt hatten. Der unfreiwillige Fahrgast verschränkte zitternd die Arme vor der Brust und starrte ausdruckslos auf das Meer.
»Lady ...«, murmelte Collum höflich und reichte ihr seinen langen Tartan.
Da sie ihn nicht zu hören schien, wandte sich Brendan zu ihr. »Lady Eleanor, Collum bietet Euch seinen Tartan an.«
»Bevor ich ein schottisches Kleidungsstück trage, erfriere ich lieber«, stieß sie zwischen klappernden Zähnen hervor.
Eric wollte seinen Pelz von den Schultern nehmen und ihr reichen. Aber Brendan hinderte ihn daran. »Dann müsst Ihr eben frieren, Lady. Obwohl in Erics Adern norwegisches Blut fließt, ist er mit mir verwandt und seine nordische Insel liegt in der Nähe meines Landes. Deshalb verstehen wir, dass Ihr seinen Pelz verschmäht.«
Statt einer Antwort warf sie ihm einen vernichtenden Blick zu.
Eric ruderte zur Wasp und kletterte die Strickleiter hinauf. Dann drehte er sich um und sah die Lady heraufsteigen, ohne Brendans oder Collums Hilfe anzunehmen. Als sie auf einer nassen Sprosse ausrutschte, beugte er sich über die Reling. »Natürlich würde ich Euch gern heraufheben, Lady. Aber ich möchte Euch nicht mit der Berührung meiner barbarischen Hände beleidigen.«
»Dafür bin ich Euch äußerst dankbar. Und ich komme sehr gut allein zurecht.« Behände sprang sie auf die Decksplanken.
Brendan und Collum folgten ihr und beobachteten, wie Schotten, Norweger und Franzosen die drei Schiffe trennten.
Hoch aufgerichtet stand Eleanor da und versuchte, ihr Zittern zu unterdrücken. »Seid Ihr mit den Piraten im Bunde?«, fragte sie Brendan.
»Ich habe Thomas de Longueville nie zuvor gesehen«, erwiderte er und lehnte sich lässig an einen Mast. »Aber mitten im Kampfgetümmel erkannte der Pirat ebenso wie ich, dass wir einander viel zu bieten haben.«
»Und was wäre das?«
»Die Bedingungen unseres Abkommens brauchen Euch nicht zu kümmern.«
»Nachdem mein Schiff überfallen, mein Kapitän brutal ermordet und die Besatzung offensichtlich ins Meer geworfen wurde, interessiere ich mich sogar sehr für diese Vereinbarung. Dass sich die Schotten mit gemeinen Dieben verbrüdern, überrascht mich nicht ...«
Erbost fiel er ihr ins Wort. »Edward ist ein Dieb. Wales wurde gestohlen, seine Aristokratie niedergemetzelt. Und es sind nicht die Schotten, die nach London ritten. Nein, die Engländer kamen nach Norden. Bitte, Collum, bring Lady Eleanor in ihre Kabine.«
Als Collum vortrat und ihren Arm ergreifen wollte, wich sie hastig zurück. »Wenn Ihr vorausgeht, werde ich Euch folgen.«
Des albernen Spiels müde, wandte er sich zu Eric. »Ist William über die Ereignisse in Kenntnis gesetzt worden?«
»Aye.«
»Dann will ich mich erst einmal von der Irischen See befreien.« Brendan überließ die Wasp Erics fähigen Händen und ging unter Deck, um trockene Kleider anzuziehen. Außerdem wollte er mit seinen Gedanken allein sein. Er zitterte am ganzen Körper. Nicht vor Kälte, sondern vor wilder Rachsucht, die seine Erinnerungen erneut schürten.
Die Wasp war klein, sehr schmal und so ausgestattet, dass sie möglichst schnell segeln konnte. Trotzdem hatte sie einige Annehmlichkeiten zu bieten. Eleanor schaute sich verblüfft auf dem unteren Deck um, das mehrere Vorratsregale enthielt. Hinter den Türen lagen vermutlich die Kabinen einiger Besatzungsmitglieder. Collum führte sie zu einer erstaunlich großen Kabine, die achtern lag, mit einer schmalen Nische für Kleidung, Ausrüstung und Bücher, einer Koje an der Backbord- und einem Schreibtisch an der Steuerbordseite.
Zweifellos hatte jemand diese Kabine bewohnt. Aber jetzt stand zu Eleanors Überraschung ihre Reisetruhe mitten im Raum – von ihrem Schiff herübergeholt ...
An Bord des schottischen Schiffs hatte sie mehrmals den Namen Wallace gehört. Dieser Mann war ein Schlächter, der keine Gnade mit seinen Feinden kannte. Das wusste sie nur zu gut, denn seine Grausamkeit hatte ihr Leben verändert und sie auf das Schlachtfeld von Falkirk gesandt – und über Umwegen auch auf die Wasp.
Allem Anschein nach kommandierte William Wallace die schottische Flotte, und der junge Soldat, dem sie am Ende der Kämpfe von Falkirk zufällig begegnet war, hatte die Navigation übernommen. Der englische König hasste Wallace und betonte immer wieder, er würde nichts anderes akzeptieren als dessen bedingungslose Kapitulation. Doch diesen Triumph würde Edward niemals erleben – das erkannten seine Freunde ebenso wie seine Feinde.
Collum wartete vor der Kabinentür. Beinahe fühlte sich Eleanor schuldig. Er war freundlich zu ihr gewesen – oder hatte es zumindest versucht. Warum sie seinesgleichen verabscheute, konnte er sicher nicht verstehen.
»Wenn Ihr noch etwas braucht, Lady ...«
»Meine Zofe!«, unterbrach sie ihn mit scharfer Stimme. »Geht es ihr gut?«
»Aye, Lady.«
»Kann sie zu mir kommen?«
»Jetzt nicht.«
»Wann?«
»Das weiß ich nicht ...«
»Ach ja! Offensichtlich gehorcht Ihr diesem aufgeblasenen Kerl, der alle Entscheidungen trifft.«
»Aye, Lady. Ihr seid ganz blaugefroren. Wenn ich vorschlagen dürfte ...«
»Werdet Ihr mich hier einsperren?« Vergeblich versuchte Eleanor, die Angst zu bezähmen, die in ihrer Stimme mitschwang.
»Aye.«
Sie wandte sich wortlos ab.
Sekunden später hörte sie, wie die Tür ins Schloss fiel. Als der Riegel vorgeschoben wurde, zuckte sie zusammen. Nur keine Panik ... Sie musste ihre eigenen Dämonen bekämpfen. Aber dann stieg ihr Rauchgeruch in die Nase. Entsetzt lief sie zur Tür und hämmerte mit beiden Fäusten dagegen. »Bitte, wartet ...«
Es war nicht Collum, der die Tür öffnete, sondern schon wieder der Mann, den sie auf dem Schlachtfeld bei Falkirk gesehen hatte ... Immer noch triefnass, runzelte er ärgerlich die Stirn. »Aye, Lady?«
»Es brennt«, flüsterte sie und trat zurück.
»Aye, Lady, das englische Schiff.«
»Sind ...«
»Es wurde gekapert, geplündert und in Brand gesteckt. Sind noch Männer an Bord? Nein, Lady. Solange ich eine Truppe kommandiere, wird weder ein Mensch noch ein Tier verbrennen. Wolltet Ihr danach fragen?«
Obwohl sie eine andere Frage stellen wollte, nickte sie. Seltsamerweise fühlte sie sich beschämt. »Sind wir in Gefahr? Könnte dieses Schiff Feuer fangen?«, würgte sie hervor. Um seinem prüfenden Blick auszuweichen, senkte sie den Kopf.
»Natürlich nicht«, versicherte er und wollte die Tür schließen. Was sie bewog, ihn zurückzuhalten, wusste sie selbst nicht. »Im eiskalten Wasser zu ertrinken – das ist auch kein angenehmer Tod.«
»Wohl kaum. Warum seid Ihr dann dieses Wagnis eingegangen?«
»Wie ich bereits erklärt habe – ich wollte mich nicht umbringen.«
»In diesem Gewittersturm wärt Ihr zweifellos ertrunken.«
Darauf gab sie keine Antwort. »Was ich Euch noch sagen wollte – Captain Abram war ein lieber, guter Mensch. Meine Verwandten haben ihm das Schiff anvertraut. Was mit ihm geschehen ist, wird mein Leben lang auf meiner Seele lasten.«
»Wie lange das auch sein mag«, bemerkte er.
»Also wollt Ihr auch mich ermorden?«
Sein Lächeln verwirrte sie. »Nein, Lady, ich bin kein Henker. Wahrscheinlich wird Euer Leben durch Euren eigenen Leichtsinn ein vorzeitiges Ende nehmen. Und was Euren Captain Abram betrifft – ich habe keine Ahnung, wovon Ihr redet.«
»Wie sonderbar ... Er wurde über Bord geworfen.«
»Lady, die Piraten sind habgierig, aber nicht blutrünstig, und sie töten nur Leute, die Widerstand leisten. Keine Bange, Euer Captain Abram ist am Leben. Er wurde auf Thomas de Longuevilles Schiff gebracht, die Red Rover.«
»Aber de Longueville hat behauptet ...«
»Das war nicht ernst gemeint. Aye, Lady, einige Männer sind bei diesem Kampf gestorben. So etwas lässt sich nicht vermeiden. Doch weder Euer Captain noch seine Männer wurden kaltblütig ins Meer geworfen. Solche Gräueltaten überlasse ich den Engländern.«
Verwundert schaute sie auf. »Entweder seid Ihr ein Lügner, oder Ihr wisst nichts über die Männer, für die Ihr Euch einsetzt!«
»Soll ich Euch erzählen, was die Engländer vor meinen Augen verbrochen haben?«
»Und soll ich schildern, was mir die skrupellosen Schotten angetan haben? Nur zu gern!« Unwillkürlich näherte sie sich ihm. »Habt Ihr von Castle Clarin gehört? Vermutlich nicht. Das Schloss ist nicht so grandios wie York, wo Euresgleichen ebenfalls gewütet hat. Auf Clarin wurden Bauern, Kaufleute, Handwerker und Krieger wie Vieh in einen Stall getrieben, der wenig später in Flammen auf ging. Nachdem mein Vater und meine Verwandten aufs Schlachtfeld geritten waren, fielen die feigen Schotten über uns her – über unschuldige Menschen ...«
»Erstaunlich, Lady ... Solche Methoden wandten die Engländer schon viel früher an. Das musste ich mit ansehen. Wenn wir uns grausam verhalten, so haben wir ‘s von unseren Feinden gelernt. Würdet Ihr mich jetzt entschuldigen, Lady Eleanor? Ich bin bis auf die Haut durchnässt. Und ich friere. Genau wie Ihr.«
Als er sich abwandte, rief sie: »Wartet!«
»Aye?« Ungeduldig drehte er sich um.
»Müsst Ihr ...«
»Was meint Ihr?«
»Schon gut. Nichts.«
Aber er blieb stehen und musterte sie neugierig. »Fürchtet Ihr, ich würde die Tür wieder verriegeln?«
»Aye.«
»Tut mir Leid, das muss ich tun. Ihr seid eine wertvolle Gefangene, Lady.«
»Also wollt Ihr Lösegeld für mich verlangen?«
»Das habe ich noch nicht entschieden.«
»Und wenn nicht?«
»Mal sehen ...«
»Hört mich an! Wie Ihr festgestellt habt, bin ich eine Menge wert.«
»In mancher Hinsicht.«
Sein spöttischer Unterton zerrte an ihren Nerven, und sie musste sich zwingen, seinem Blick standzuhalten. »So ist es üblich, nicht wahr? Plündern – und vergewaltigen ... Nun, worauf wartet Ihr? Aber ich muss Euch warnen, ich werde Euch keine Freude bereiten ...«
»Zumindest nicht in diesem Augenblick. Ihr seht aus wie eine ertrunkene Ratte, Lady. Auch ich bin klatschnass, müde und verbittert – sehr verbittert. Die Kraft, die mich die erwähnte fragwürdige Freude kosten würde, kann ich vorerst nicht aufbringen. Nun wünsche ich Euch eine gute Nacht, Lady. Oder würdet Ihr Euch besser fühlen, wenn ich Euer Angebot an meine Besatzung weiterleite?«
War sie vor lauter Angst verrückt geworden? Oder hatte das eisige Wasser ihr Gehirn betäubt? Wie auch immer, sie stürzte sich auf ihn. Aber bevor sie ihre Fäuste heben konnte, packte er blitzschnell ihre Oberarme. Vielleicht hatte er den Angriff vorausgeahnt. Stahlharte Finger gruben sich in ihr Fleisch. Und trotz seiner kalten, nassen Kleidung erschien ihr sein Körper so heiß wie das Feuer, das sie in so vielen Albträumen heimgesucht hatte. Als sie in seine Augen schaute, stieg eine neue Angst in ihr auf – ein merkwürdiges Gefühl, das sie nie zuvor verspürt hatte. Plötzlich fand sie diesen Feind gefährlicher als alle anderen.
Sein unheilvoller Blick schürte ihr Entsetzen. Auch ihn mussten die durchnässten und trotzdem erhitzten Körper irritieren. Aber dann verzogen sich seine Lippen zu einem schwachen Lächeln. Ein sonderbarer Glanz verdrängte das Dunkel seiner Augen. Behutsam schob er sie von sich. »Wer weiß, Lady? Wenn Ihr Euch waschen und was Sauberes anziehen wollt – vielleicht kann ich Euch erfreuen.«
Mühsam widerstand sie dem Impuls, ihre Fäuste ein zweites Mal zu heben. Diesen Fehler würde sie nicht mehr begehen. »Lieber nehme ich Euren Vorschlag an und liefere mich der gesamten Besatzung aus.« Wütend strich sie sich die nassen, vom Salzwasser verklebten Haarsträhnen aus dem Gesicht. Dass sie wie eine ertrunkene Ratte aussah, wusste sie selber.
»Gewiss, das lässt sich arrangieren«, versprach er leichthin.
»Verschwindet!«, fauchte sie.
Höflich verneigte er sich und erinnerte sie: »Ihr habt mich zurückgehalten, Lady!«
»Um Himmels willen, geht endlich und schließt die Tür!«
»Zu Befehl, Lady«, entgegnete er, schloss die Tür hinter sich und schob den Riegel vor.
Sollte sie sich schreiend gegen das Holz werfen? Eine Zeit lang bekämpfte sie diese Versuchung, dann sank sie auf die Koje, die an straff gespannten Seilen hing. Die weiche Federmatratze fühlte sich erstaunlich angenehm an. Aber das vermochte Eleanor nicht zu trösten. Von Erschöpfung und Kummer überwältigt, brach sie in Tränen aus.
Sie träumte. Das wusste sie. Verzweifelt warf sie sich umher und erlebte aufs Neue jene schicksalhaften Ereignisse.
In ihrem Traum kehrte sie nach Clarin zurück. Die Schotten hatten bei Falkirk eine Niederlage erlitten und sie war mit den englischen Truppen geritten.