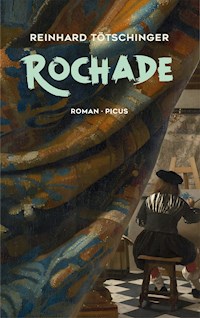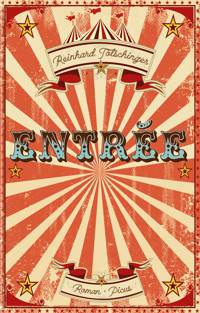
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Philip, knapp 50, führt ein recht unspektakuläres Leben als Texter in Wien. Da erreicht ihn eines Tages ein Notariatsbrief aus Paris. Die Erinnerungen an sein damaliges Leben und an Céline führen ihn zurück in die Stadt, wo er vor fünfundzwanzig Jahren Philosophie studiert hat. Die Reise löst eine Kaskade von Gefühlen, Ängsten und Rückblicken aus, die immer wieder die belastete Vergangenheit seines Heimatdorfes hochkommen lassen, in dem sich einst eines der größten Kriegsgefangenenlager des Deutschen Reichs befand. Um den Spuren eines Familiengeheimnisses zu folgen, landet er wieder bei seiner alten Liebe, erlebt die herzliche Aufnahme in der Welt des Zirkus und lernt die Kunst der alten Clowns kennen. Unmerklich verändert sich etwas in ihm. Schritt für Schritt tritt er aus den gewohnten Bahnen, entdeckt neue Klarheit im Vorhandenen und lebt wie die Clowns im Augenblick inmitten einer unruhigen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © tintin75/iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2148-8
eISBN 978-3-7117-5517-9
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Reinhard Tötschinger
ENTRÉE
Roman
Picus Verlag Wien
Man versteht nur das wirklich, was man erschaffen kann.
GIAMBATTISTA VICO
Si c’est trop, c’est ne pas assez!
JACQUES LECOQ
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Man steigt nicht aus der Höhle hinauf ans Licht. Auch schwebt nichts von oben herab und es gibt kein Hin-zu und kein Wegvon. Das Spiel kann kein zweites Mal gespielt werden, es ist nie dieselbe Partie. Es wird einem nur der Vorhang vom Fenster gezogen. Was ich hier erzähle, liegt erst zwei Jahre zurück. Deshalb glaube ich, es ist so gewesen. Genau so. Wieso ich mich an all das so genau erinnere? Weil uns nur überraschende, unerwartete, besondere, erfreuliche oder schmerzhafte Ereignisse in Erinnerung bleiben. Niemals das Alltägliche. Und doch könnte es anders gewesen sein. Wir wissen ja, dass Erinnerungen gefärbt sind, dramatisiert, wie ein Film geschnitten werden, neu zusammengefügt, sie also nie genau so gewesen sind, wie im Moment erlebt und erinnert.
1
So früh konnte das nichts Gutes bedeuten. Ich presste das Kopfkissen über beide Ohren. Wieder läutete es Sturm. Die frischen Croissants werden doch immer an die Tür gehängt. Ich tappte nach Hose und Hemd, öffnete einen Spaltbreit den Vorhang, blickte in den grauen Novemberhimmel und lief ins Vorzimmer. Durch den Türspion ermittelte ich die Lage. Erleichtert, dass nicht die Polizei vor meiner Wohnung stand, öffnete ich (sie war noch nie vor meiner Tür gestanden, aber ich kannte die Angst seit jeher von Oma). Der Postbote übergab mir einen Brief. Stumm, die Paste zur Aufhellung klebte noch an meinen Zähnen, hinterließ ich meine Unterschrift. Mist. Der Text für die Agentur war längst fällig. Nur die Headline hatte ich bisher geschafft: Ein strahlend weißes Lächeln muss kein Traum bleiben. Mit einem angedeuteten Nicken verabschiedete ich mich vom Boten, nahm das Säckchen, in dem ich das Croissant wusste, von der Türschnalle und warf das Kuvert auf die anderen Briefe, die sich auf dem Esstisch türmten. Im Bad prüfte ich, ob die Paste ihre versprochene Wirkung zeigte (um einen brauchbaren Werbetext hinzubekommen, musste ich die Produkte vorher testen). Ich spülte den Mund aus. Ja, ich schämte mich, solche Texte zu schreiben (wobei ich meine Tätigkeit nicht als Schreiben bezeichnen sollte). Aber sie hielt mich über Wasser und ich musste nicht groß nachdenken dabei. Mit dem Text über die neue Kaffeemaschine, die ich als technisches Meisterwerk anpreisen sollte, war ich auch in Verzug, von meinem Kunden bereits mehrmals ermahnt worden. Aber der Termin zur Abgabe war schon bei Auftragseingang vorbei gewesen. Alles sollte immer gestern geliefert worden sein. Meine Lust auf Kaffee nahm ich zum Anlass, den Kaffeeautomaten zu testen. Wasser eingießen, die Kaffeebohnen aus der beigefügten Packung einfüllen, Tasse auf den bezeichneten Platz stellen. Ich lenkte meinen Blick nach links, rechts, nach oben, unten, beugte mich über den Apparat. Endlich erfühlte mein Zeigefinger eine Stelle, an der er mit einem leichten Druck ein grünes Lämpchen zum Leuchten brachte. Der Automat füllte meine Tasse. Ich sog den Duft ein, drehte die Schale leicht zur Seite, sodass der Kaffee nicht über den Rand schwappte, öffnete den Laptop und tippte: Der cremige, leichte Schaum, der sich an der Oberfläche zu einem kleinen Schneeberg auftürmt, und die intuitive Bedienung des neu entwickelten Kaffeevollautomaten führt die Benutzer (sollte ich gendern?) in fantastische und unbekannte Kaffeewelten. Der Text war übertrieben. Ich ließ ihn stehen. Solches Pathos liebten meine Kunden. Anschließend trank ich die Tasse in einem Schluck leer. Leicht wahrnehmbare Säure, etwas Schokolade, nussig.
Erleichtert, nebenbei und überrascht, ohne Anstrengung mit dem Text weitergekommen zu sein, genoss ich mein morgendliches Kipferl.
Das Telefon läutete.
Mama.
Ich drückte auf »Ich kann gerade nicht sprechen«. Jetzt standen meine täglichen Körperübungen auf dem Programm.
Während ich den Rücken abwechselnd durchdrückte oder zu einer Rundung formte, beschloss ich, mich anschließend all den noch nicht abgesendeten Produktbeschreibungen zu widmen. Wieder überkam mich die mir vertraute bleierne Müdigkeit, die immer dann auftauchte, wenn ich Dinge tun sollte, die ich musste.
Ich verschob die Arbeit auf später.
2
Von Weitem blinkte Espresso-Sport in gelber Neonschrift (der Wirt ließ den Schriftzug trotz gestiegener Strompreise weiterhin auch am Tag an). Ein ehemaliges Gasthaus, das sich vor vielen Jahren in ein Espresso verwandelt hatte. Die Lampen im Inneren bemühten sich, das schwache Tageslicht zu verstärken, die Wände waren bis zur Hälfte mit grün gestrichenem Sperrholz geschützt, die Tische mit Plastiktüchern bedeckt, ein Eisenofen unterstützte die müde gewordene Gasheizung, zwei Männer verfolgten die Sportereignisse, die der Bildschirm an der Wand ausstrahlte. Das Café erinnerte mich immer wieder an Winterabende im Dorf mit Oma im Wohnzimmer bei laufendem Fernseher und unter einer runden Hängelampe. Ich zeichnete ihre regelmäßige Handschrift, mit der sie Rezepte in ein Heft schrieb, nach.
Kaum hatte ich mich gesetzt, wurden mir eine Melange und eine Buttersemmel serviert. Meine Stimmung hob sich. Auch hier wusste man, was ich wollte. Zufrieden nahm ich die Gratiszeitung zur Hand (es gab keine andere). Am Leitartikel blieb ich hängen, der aufgrund seiner Kürze und seines dünnen Inhalts eher einem Fernschreiben glich.
Herbert, »Herr Professor«, wie er von uns Freunden gerufen wurde, zertrat, die Süddeutsche Zeitung unterm Arm, vor der offenen Eingangstür eine Zigarette. Meine Nase hatte ihn schon vor dem Betreten des Lokals erkannt.
»Guten Morgen, Herr Professor«, rief der Wirt, während er mit einem Tuch Biergläser trocken wischte.
In Wien war schnell einer ein Doktor oder Professor, auch wenn er keiner war. Herbert war einer.
Ich deutete auf die Überschrift.
Er setzte sich, bestellte ein Paar Frankfurter und verschwand hinter seiner Zeitung, während mein Tagesblatt gerade einmal mein Gesicht verdeckte.
»Das war klar, nur nicht wann«, hörte ich ihn sagen, »die Russen, nicht alle, die Elite träumt von einem Großrussischen Reich, aber Eliten haben keine Zukunft, sie greifen auf Modelle der Vergangenheit zurück. Ihre Zukunft ist die Vergangenheit.«
Ich dachte an Opa. Auch er hat aus der Vergangenheit heraus gelebt.
Herbert legte die gefaltete Zeitung zur Seite.
»Sie nehmen ihre Realität als eine vom Schicksal oder von Gott gegebene absolute Wahrheit. Dies dient nur dazu, die vermeintliche Unausweichlichkeit der eigenen Aktionen einem anderen in die Schuhe zu schieben.«
Ich nickte.
Der Bildschirm zeigte ein Pferderennen, unterbrochen von Werbung mit Sportwetten. Die beiden Fußballfans riefen nach Bier. Ich bestellte einen weiteren Kaffee. Herbert ließ eines der beiden Würstel im Senf kreisen, bis sich genug davon daran festhielt.
»Man sollte den Krieg so rasch wie möglich beenden«, sagte ich.
»Ohne die Welt dahinter zu kennen, kann der Krieg nicht beendet werden. Der Mensch vermag nur zu erkennen, was er selbst gemacht hat. Das hat Vico schon vor mehr als dreihundert Jahren geschrieben.«
»Wie auch das Auge alles sehen kann, nur sich selbst nicht«, sagte ich stolz.
Jetzt war es mir wieder eingefallen. Über Giambattista Vico hatte ich im Studium in Paris gelernt, auch wenn ich inzwischen vergessen hatte, wofür der Philosoph stand. Auf die Seminararbeit hatte ich eine gute Note bekommen.
Herbert ergriff das zweite Würstel, tunkte es in den Senf und setzte, von Kauen unterbrochen, fort.
»Die Menschen fallen in alte Muster zurück, sie halten sich selbst für das Gute und den jeweiligen Feind für das Böse.«
Er wischte sich den Mund sauber, klemmte sich eine Zigarette zwischen die Finger und stellte sich vor das Café. Husten folgte auf den ersten Zug. Der Fernseher schaltete zwischen Fußballspielen und Pferderennen hin und her. Einer der Männer schlug auf den Tisch.
Ich müsste noch Bücher über Vico und von anderen Soziologen und Philosophen im Keller haben (ich hatte mir schon Hunderte Male vorgenommen, ihn zu räumen, jetzt werden sie von Mäusen zerfressen).
Herbert saß mir wieder gegenüber.
»Du kennst Vico! Nimm dein Studium wieder auf und schließ es ab«, sagte er.
Kennen konnte man es nicht nennen. Nur manche Titel und wenige Sätze. Ich wehrte ab.
»Nein, die Studentinnen würden mich für den Professor halten.«
»Ich habe viel Ältere als dich in den Vorlesungen.«
Konnte man Frieden mithilfe von Vicos Thesen finden?
Wir sprachen weitere zwei Kaffee und eine halbe Packung Gauloises lang darüber.
Während die Glocken der nahe gelegenen Kirche die Mittagszeit einläuteten, winkte ich dem Wirt um die Rechnung. Herbert zahlte.
3
Die Glühbirne war kaputt. Ich erleuchtete mit meinem Mobiltelefon den finsteren Gang. Verdeckt in einer der Ecken fand ich den Karton. Sauber beschriftet: Philo, 1997/Paris. Werke von Vico, Comte, Michelet. Die Bücher zwischen Oberarm und Brust geklemmt, kämpfte ich mich die Stufen hinauf, öffnete die Wohnungstür, legte die Bücher zu den ungeöffneten Briefen, lief ins Bad und wusch den Schmutz von den Händen und Herberts Zigarettenrauch aus dem Gesicht. Ich sah mich im Spiegel. Die Haut ist noch jung. Gut, dass du nie geraucht hast, Philip. Man wird auch das, was man raucht, sagte ich mir, während ich bemerkte, dass sich weiße Haare zwischen den schwarzen hervorgekämpft hatten. Meine Freunde meinten, ich sähe aus wie Anfang vierzig und nicht wie beinahe fünfzig. Auf einmal ist man älter. Erst im Nachhinein bemerkt man es. Plötzlich ist das Dorf überschwemmt, fällt der Berg zu Tal, tötet die im Winter ersehnte Kälte.
Nun musste ich aber mit den Texten beginnen. Wieder die Müdigkeit. Trotz des vielen Kaffees. Anfangs dachte ich, ich sei faul oder arbeitsscheu. Oder es sei eine Ankündigung des nahenden Alters. Mit der Zeit hatte ich mir angewöhnt, Unangenehmes als ermüdende Pflicht zu sehen, die ich ohne viel Nachdenken abzuspulen hatte. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung, je älter man werde, desto weniger Schlaf brauche man, war es bei mir umgekehrt. Ich wurde schnell müde. Bislang hatte ich keine eindeutige Erklärung dafür gefunden – aber einen Trick, um mich zum Schreiben zu überlisten: anspruchslose Sendungen sehen oder hören, um die Langeweile während des Verfassens der Werbetexte zu überbrücken. Ich schaltete den Fernseher ein und zappte nach einem Krimi. Nun war ich bereit. Zugleich wollte ich den Recherchen der Kriminalkommissarin (es waren seit einiger Zeit öfter Kommissarinnen) und den sofort als solche zu erkennenden Mördern (sie waren immer prominent besetzt) folgen.
Wären nur die Briefe auf dem Esstisch nicht gewesen. Rechnungen, vielleicht sogar Mahnungen. Zum Glück waren sie nicht als Einschreiben gekommen. Noch nicht. Nur der eine von heute Morgen. War er von der Hausverwaltung? Mit der Miete war ich bereits Monate im Rückstand. Ich wollte ja bezahlen. Aber.
Nach zwei Stunden hatte ich die Texte im Laptop und der Mörder war derjenige, von dem ich es vermutet hatte. Erschöpft sendete ich meine Werke ab.
Ich hatte Karten für Tarkowskis Film Stalker im Filmmuseum. Den verschlossenen Kuverts wollte ich mich erst widmen, sobald es dem Konto wieder besser ging. Geht’s dem Konto besser, geht’s dir besser. Den Spruch hatte ich für eine Bank geschrieben. Autobiografisch. Sozusagen.
Doch der eingeschriebene Brief schrie nach Öffnung.
Mit einem Stück beruhigender Nougatschokolade im Mund, mit der dunklen Vorahnung, gleich die Kündigung der Wohnung in Händen zu halten, näherte ich mich dem mit Nervengift kontaminierten Kuvert. Mit Daumen und Zeigefinger an einer Ecke greifend, zog ich es vom Stoß. Ich sah auf den Stempel. Der Brief war vor zwei Wochen aufgegeben worden.
Vorsichtig wendete ich ihn.
Florence Bochais, Notaire, Paris …
Paris ließ meine Stimmung steigen. Plötzlich war ich wach. Dachte an Céline. Dort hatte ich meine schönsten Zeiten erlebt, mich in die französische Sprache vertieft, weg aus der Enge meines Heimatorts, fort von den Vorstellungen, wie ein ordentliches Leben zu sein hatte, fünf Semester Philosophie studiert. Ewig her. Vier- oder fünfundzwanzig Jahre. Ich war Schorschi nachgefahren, der nach der Matura zum Georg und in Paris zum Georges wurde und länger als ich geblieben war. Wir waren die Ersten in unseren Familien, die das Gymnasium besucht hatten. Beide in Französisch maturiert. Beide Céline geliebt. Die Erinnerungen waren nur mehr in Bruchstücken vorhanden.
3, Cité Bergère, 75009 Paris.
Die Gegend kannte ich. Im Chartier gegenüber konnte ich mich satt essen. Mit wenig Geld. In der Sackgasse ein billiges Hotel. Bilder tauchten wie Blitze auf. Ich hatte Papa im Stich gelassen, war aus dem Dorf und von der Familie geflohen. Ich hatte mich schuldig gefühlt. Seit ich mich erinnern konnte, fühlte ich mich schuldig und wusste nie, warum.
Ich atmete tief aus und ein (wie bei meiner letzten Lungenuntersuchung) und riss das Kuvert auf.
Monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une procuration à votre nom permettant de régler la succession et de signer les actes.
Mein Französisch war noch nicht völlig verschwunden. Ich sollte in zwei Tagen im Büro eines Notars erscheinen. Notwendige Formalitäten erledigen.
Hatte ich Nennenswertes vergessen? Schlimmes angestellt, das mich nun einholte? War mit Céline etwas geschehen? Mit Georg? Zu beiden war der Kontakt bald nach meiner Abreise aus Paris abgebrochen.
Im Geist fuhr ich all meine Pariser Winkel ab. Ehemalige Wohnorte, Freunde, Universität, Freundinnen, Restaurants, Cafés. Erschrocken über die Zeit, die inzwischen vergangen war, las ich Papas Namen.
Julius Muzak
Papa war seit zwanzig Jahren tot!
Philip Muzak
Mein Name in fetten Lettern.
Louis Pichereau
Wer sollte das sein?
Succession
Der Notar beendete den Brief mit einer ausführlichen Beileidsbekundung.
Irrtum, Fälschung! Eine Falle? Karl musste her. Als Anwalt sollte er wissen, was zu tun war. Er klärte für mich rechtliche Probleme und hatte mich gratis, aber erfolglos durch die Scheidung getragen. Beide sammelten wir Oldtimer. Ich Modelle, die auf den Fensterbrettern meiner Wohnung geparkt waren, er die originalen, großen Autos. Ich war zufrieden, Freundschaften wie mit Karl und Herbert über die Jahre gerettet zu haben.
Ich scannte den Brief ein und schickte ihn Karl in der Hoffnung, dass er noch heute antwortete.
Er rief bald zurück. Brief und Notariat befand er als echt und glaubwürdig.
»Kennst du den Herrn?«, fragte er.
»Nein.«
»Du erbst.«
»Wer will mir etwas vererben?«
»Louis Pichereau. Steht doch im Brief. Ich kann es von hier aus klären, das dauert aber mehrere Wochen. Wenn du es schneller wissen willst, musst du anrufen oder den Termin persönlich wahrnehmen.«
»In Paris? Ich habe Aufträge zu erledigen, Abgabetermine.«
»Dann ruf an. Aber Vorsicht, das französische Erbrecht unterscheidet sich deutlich vom österreichischen.«
4
Eine Erbschaft! Kaum dämmerte Aussicht auf Geld am Horizont, meldeten sich bei mir körperliche Reaktionen: Jucken auf der Innenseite der linken Hand und verstärkter Speichelfluss. Das hatte ich von meiner Großmutter übernommen. Und vieles mehr, wie ich heute weiß. Von der einen, der Erna-Oma. Zu ihr sagte ich Oma. Mit der anderen hatte ich kaum Kontakt gehabt. Wie Mama war sie aus einem anderen Dorf.
Ich warf mich aufs Bett.
Der Brief schürte Hoffnungen. Würden meine ständigen Geldsorgen ein Ende finden?
Obwohl ich ihre Fragen fürchtete, die sich immer als eine Melange aus Sorgen und Vorwürfen tarnten, rief ich Mama an. Vielleicht wusste sie etwas.
»Ist etwas passiert?«, fragte sie.
»Nein, ich möchte fragen, ob …«
»Musst du nicht arbeiten?«
»Ich arbeite, Mama. Weißt du etwas über eine Verbindung unserer Familie nach Frankreich?«
Ich schämte mich, sie nach etwas Vergangenem zu fragen. Irgendwann hatte ich solche Fragen aufgegeben. Sie hatte sie ohnehin immer weggeschoben, stumm mit derselben Handbewegung, mit der sie die Tische sauber wischte. Manches aus früheren Zeiten wurde von ihr in mühevoll gestrickte Pullover und Fäustlinge verarbeitet, die zu Weihnachten und an Geburtstagen an Papa und mich verschenkt wurden.
»In Frankreich waren wir nie«, antwortete sie, »nur einmal an der Adria. Immer auf dem Hof geblieben. Was soll das? Du bist doch der, der damals unbedingt nach Paris wollte. Ohne Netz! Du kanntest niemanden dort außer dem Schorschi. Und der kannte auch nur dich. Ich wollte ja, dass du studierst, aber nicht im Ausland.«
Man sollte aus dem normalen Leben nicht ausscheren, war das Credo bei uns gewesen. Papa hatte es mehrmals erfolglos versucht.
»Mama, das ist mehr als zwanzig Jahre her. Also, gibt es da etwas?«
Sinnlos. Ich verabschiedete mich, nahm den Brief wieder zur Hand und las laut.
Florence Bochais, Notaire. Monsieur, je vous prie de …
Das Französisch klang für mich wie eine Liebeserklärung und nicht wie ein amtlicher Brief. Die Wörter flossen dahin, mochten sich voneinander nicht trennen. Auf Deutsch hätte es härter geklungen.
Florence Bochais, Monsieur, je …
Halt. Der Notar war eine Frau!
Ich verschob die Textarbeit.
5
Als ich eintrat, lief der Fernseher. Vom Öffnen am Morgen bis zum Schließen am Abend. Die Männer saßen noch am selben Platz. Mehrere leere Gläser vor ihnen. Zwei volle mit Bier.
»Heute Wiederholungstäter?«, sagte der Wirt und grinste.
Sei froh, wenn du mehr Geschäft machst. Den Kaffee schickte ich zurück und bat um Cognac und Wasser.
War ein Wunder geschehen, wie ich es nicht mehr erhofft hatte? Öffnete sich eine ersehnte Tür? Und wie viel sollte ich erben? Hatte Céline etwas damit zu tun? Blödsinn. Sie hieß ursprünglich Delaval und nicht Picher … oder wie der hieß. Tage zuvor hatte ich sie wieder einmal gegoogelt und nichts über ihren Tod gelesen. Er konnte aber natürlich auch plötzlich gekommen sein. Unverhofft kommt oft. Umfassende Absicherung für Freizeit und Fortbildung. Merkur (noch so ein Slogan). Ich dachte schon länger an eine Gesundenuntersuchung, hatte mich aber wegen der Angst, nicht mehr aufzuwachen, bisher davor gedrückt.
Wer war dieser Pischerer?
Nein. Besser hierbleiben. Karl beauftragen, er sollte der Sache nachgehen. Oder doch nach Paris? Zu lange war ich nicht mehr dort gewesen. Ich könnte nach Céline suchen, selbst zum Termin bei der Notarin erscheinen und das Geld gleich mitnehmen. Das Risiko war es wert, das Konto noch weiter zu überziehen. Eine Erbschaft wäre ein Argument gegenüber der Bank.
Mit meinem Mobiltelefon suchte ich schnelle Züge und günstige Flüge, fand aber nur teure und schnelle Flüge und ebenso teure, aber mit mehrmaligem Umsteigen verbundene langsame Zugreisen (so konnte die Klimakrise ja nicht bewältigt werden).
Der günstigste Flug war ein Air-France-Flug um sechs Uhr zwanzig. Ich sah meine Hand zittern. Tippte mehrmals auf falsche Tasten. War es die Vorfreude auf Paris, die Erwartung einer Erbschaft oder der Ärger über das frühe Aufraffen? Das Warum und Von-wem waren in den Hintergrund gerutscht. Einfach eine große Summe. Dann könnte ich die Marketingtexte sein lassen und mich auf Sinnvolleres stürzen. Erbte ich ein Haus, wollte ich es sofort verkaufen und von dem Geld leben. Erbte ich Geld und Haus, in Frankreich wohnen, ein neues Leben aufbauen, wie ich es einst vorgehabt hatte.
Ich wählte die Nummer der Notarin, ließ lange läuten. Versuchte wieder, sie zu erreichen. Kurz vor sechzehn Uhr müsste sie doch noch im Büro sein. Nicht einmal ein Anrufbeantworter.
Die Sehnsucht nach Paris und die Erwartung einer großen Summe Geld gewannen das Rennen zwischen Umweltschutz und Bequemlichkeit.
6
Unruhig geschlafen. Geschwitzt. Immer wieder in der Angst aufgewacht, das Flugzeug zu versäumen.
Papa lebt, ist fröhlich, steht im Licht, klopft mir auf die Schulter. Hol dir, was dir gehört. Hör nicht auf deine Mutter!
War es ein Traum oder war Papa am Leben?
Etwas berührte meinen Hinterkopf. Ich drehte mich um. »Ein Krieg ohne Ende?« Der Mann hinter mir las Zeitung. Der Krieg war in Europa angekommen und alles lief wie gewohnt weiter.
Ich richtete meine Haare und schob die Angst vor einem nuklearen Armageddon zur Seite.
Die Flugbegleiterin bot mir Kaffee an.
»Un café pour l’autre chien?«, fragte ich.
Stolz, mich an den Wortwitz, den ich von Georgs Vater kannte, zu erinnern, wartete ich auf das Lachen der Flugbegleiterin. Sie sah mich an. Hatte sie den alten Spruch nicht verstanden? Die Jungen kennen ihn wohl nicht mehr.
Ich öffnete das Gepäckfach und zog ein Buch aus dem Koffer hervor. Lange hatte ich keines mehr zu Ende gebracht. Bücher stapelten sich in meiner Wohnung. Auf der Lehne des Sofas. Neben dem Bett. Auf dem Esstisch, den ich für Gäste gekauft hatte, ohne bisher welche eingeladen zu haben.
Eines nach dem anderen lesen, hintereinander. Nicht alles anfangen. Durchhalten (ja, Mama!).
Der Klappentext erzählte von einer erfolgreichen Frau, die mit Mann und kleinem Sohn unglücklich in einer schicken Gegend lebt. Sie trifft sich mit anderen Männern, schläft mit ihnen, hat Angst, die Familie zu verlieren.
Ich hatte während meiner kurzen Ehe mit keiner anderen Frau geschlafen. Wir kannten uns seit der Volksschule. Aber die Beziehung hatte bald nach der Hochzeit Risse bekommen. Wie Craquelés auf Gemälden. Schlecht fixiert. Ich hatte sie nicht halten können. Karl war zum zweiten Mal verheiratet. Herbert mit einer neuen Freundin, seiner sechsten oder siebten. Wie hält man eine Ehe trotz Enttäuschungen über Jahre durch?
Wieder fühlte ich mich schuldig. Ohne Abschied hatte ich Céline damals in Paris zurückgelassen, seitdem mehrmals ihre Artikel gelesen, sie auf Bildern und im Fernsehen gesehen. Würde sie mich heute noch erkennen? Ich nahm mein Handy, suchte im Internet nach einem Foto. Fand eines mit kurzen Haaren, dachte an uns, an uns, an …
»Mon Petit.«
Wie früher.
Streicht mir über den Kopf.
»Mon Fou.«
Ich auf der Couch, die Gitarre in der Hand.
»Elle avait des yeux d’opale.«
Ihre Opalaugen sehen mich lange an.
Lautes Schnarchen weckte mich. Hatte ich geschnarcht? Wie peinlich. Ich fischte mein Mobiltelefon vom Boden auf. Der Mann hinter mir las noch immer in der Zeitung. Ich tauschte den Roman mit meinem Terminkalender. Wohnte Céline noch dort? Rasch die Sache bei der Notarin klären, ihre Adresse herausfinden und das Konto abdecken. Alle Schulden zahlen, den Rest in Fonds anlegen. Ich hätte Geld. Der Bankbeamte würde freundlich um mich werben. Diesmal würde ich selbst entscheiden, mir die Bank selbst auswählen, selbst die Bank prüfen und mich nicht mehr prüfen lassen.
Plötzlich rüttelte das Flugzeug. Sackte kurz ab. Die Tragflächen hoben sich. Links. Rechts. Links. Ich drängte den Arm meines Nachbarn zur Seite und klammerte mich an die Lehnen, presste den Nacken an die Rücklehne.
Statt dunkler Gewitterwolken leuchtete nun ein klarer Himmel durch die Fenster, der Flieger hatte sich beruhigt. Druck in den Ohren und eine von Rauschen begleitete Stimme kündigten die baldige Landung an. Ich löste die Hände von der Lehne, die der Nachbar sofort wieder in Besitz nahm, den Gurt vom Körper und wusch auf der Toilette ausgiebig die Hände. Drei Durchgänge. Mit Seife. Auch zwischen den Fingern. Sauberkeit war von Opa gefordert. Ich befeuchtete mein Gesicht, kämmte die Haare flach und den Scheitel gerade.
7
Die Regionalbahn RER führte mich zur Gare du Nord, dorthin, wo ich seinerzeit gewohnt hatte. Unter dem Dach. Das Bett beinahe so groß wie das Zimmer. Die Toilette auf dem Gang. Nur von mir und meinem Mitbewohner benutzt. Einem Schweizer, zum Glück, der die kleine Küche sauber hielt. Und die Toilette. Zumindest in dieser Angelegenheit hatten wir uns verstanden.
Das trübe Wetter ließ meine Zeit auferstehen. Meine Zeit. Damals. Fort aus einer Umgebung, in der ich nicht leben wollte. Vom Dorf, wo eine klebrige Schutzhülle die Menschen zufrieden erscheinen ließ. Nur die Abwesenheit von Papa und mancher meiner Freunde hatte mich traurig gestimmt.
Von hier aus wollte ich zu Fuß gehen, der Stadt wieder näherkommen. Ich ärgerte mich über die Busse, die von Flaschengrün auf Türkis umgefärbt worden waren, und über die Polizisten, die ihre runden Deckel gegen Schirmmützen getauscht hatten. Ich ging über den Platz vor dem Bahnhof. Über löchrige Trottoirs. Querte die Boulevards Magenta und Strasbourg. Die Rue du Faubourg Saint Denis war für Autos gesperrt. Räder drängten auf den für sie markierten Routen. Fußgänger inmitten der Straße. Das sollte man in Wien fordern.
Mein Trolley ratterte über das Pflaster. Wasserbäche quollen aus der Tiefe, trieben Abfall in Kanäle. Die kleinen Geschäfte links und rechts hatten sich nicht verändert. Die verkommenen Typen waren dieselben geblieben.
Noch vor dem Einchecken im Hotel musste ich in mein ehemaliges Café: Chez Jeannette.
Ich umfasste den Türgriff, sah durch die Glasscheiben ins Innere. Die Stühle unverändert mit dunkelrotem Plastik überzogen. Die Tür nach wie vor nur mit Anstrengung zu öffnen. Nur das Personal war neu. War Jeannette nicht mehr die Besitzerin? Mittags war sie in der Küche gestanden, eine Kochecke am Ende der Theke, hatte alle Arten warmer und kalter Speisen hervorgezaubert.
Mithilfe meines Reiseführers, der aus einer Zeit stammte, als man solche noch kaufte, stabilisierte ich den wackelnden Tisch. »Paris bis 2026 autofrei.« Auf dem Nebentisch lag aufgeschlagen die Libération. Ich rief dem Kellner zu, dessen Kopf hinter einem Regal voller Flaschen verschwunden war. Er bückte sich, deutete, ich solle mich an die Bar bewegen.
Heute kein »Salut, Philip, comment vas-tu?«. Nur ein »Merci, Monsieur« bestätigte die Bestellung eines Expresso.
Die Sonnenbrille abgenommen (ich hoffte auf einige sonnige Stunden), das schwarze Notizbuch und den Stift aus dem Trolley hervorgeholt, schrieb ich: 16.11., Paris, au Café Chez Jeannette. Mein Gehirn arbeitete wieder auf Französisch.
Hier waren wir gesessen. Georg, Freunde, Schülerinnen der nahe gelegenen Schauspielschule, die sich verhielten, als wären sie bereits Stars, junge Männer, die Delon oder Belmondo imitierten.
Und Céline.
In meinem Film spazierte ich in der Nähe ihrer Wohnung. Setzte mich in ein Café gegenüber. Es sollte zufällig wirken. So hatte ich es schon in der Volksschule gehalten. Hatte ich mich in eine Mitschülerin verliebt, fuhr ich in der Nähe ihres Zuhauses mit meinem Tretroller auf und ab.
Lärm riss mich aus meinen Gedanken. Die Bar hatte sich gefüllt. Gemüsehändler, grüne und graue Schürzen umgebunden. Ein Fleischverkäufer in weißem Arbeitsmantel mit roten Flecken, dort, wo er sich die Hände abwischte. Junge Männer in schwarzen Anzügen. Panachés und Kirs wurden ausgeschenkt. Einer wollte einen Expresso, ein anderer öffnete die Zeitung. Die Lautstärke schwoll an, als wären alle im Streit. Zuprosten, schimpfen, lachen, diskutieren. Auch in den Gasthäusern meines Heimatorts war es gelegentlich laut geworden. Es wurde gestritten. Geschrien. Manchmal endeten die Dispute, von reichlich Alkohol begleitet, in einer Schlägerei. Aber hier war der Lärm für mich kein Lärm. Die Melodie der Sprache ließ die Stimmung leicht erscheinen.
Du könntest mit dem Erbe das Café kaufen. Den Namen Chez Jeannette müsstest du aber behalten. Auch die Einrichtung.
Ich lachte laut auf. Wie der Scheich, der das Hotel Imperial in Wien gekauft hatte, weil er darin übernachten wollte.
»J’ai perdu du temps«, sagte ich laut vor mich hin, fand den Satz gut (auch wenn er an Proust erinnerte).
Ich hielt ihn im Notizbuch fest.
»Nous l’avons tous«, sagte der Kellner, während er den zweiten Expresso auf den Tisch stellte.
Ich fragte mich, ob der Kellner ein heimlicher Schriftsteller war.
Was, wenn die Sache gar nicht stimmte und ich einem Irrtum aufsaß? Es musste einer sein. Niemand aus meiner Familie außer mir soll je in Frankreich gewesen sein. Oder war es eine Angelegenheit, die nur mich betraf? Die Notarin und das Schreiben waren echt. Karl hatte es bestätigt. Hatte der Verstorbene keine Verwandten gehabt?
8
Das Hotel Michelet war mir unbekannt. Nicht sein Patron. Stolz zeigte ich dem Portier Jules Michelets »Die Frauen der Revolution«. Ich hatte das Hotel wegen des Namens ausgewählt, das Buch noch rechtzeitig aus dem Keller geholt und zu den anderen Büchern gepackt. Aber er schien es nicht zu kennen, sagte nur, das Zimmer wäre erst ab drei Uhr bereit.
Ich war zu früh vor dem Haus des Notariatsbüros angekommen. So lief ich die rechte Straßenseite der Rue du Faubourg Montmartre hoch, vorbei an einem Häufchen Protestierender, überquerte die Straße und spazierte auf der anderen Straßenseite wieder abwärts in Richtung Boulevard. Neben dem Torbogen, durch den man zum Eingang des Notariatsbüros gelangte, leuchtete an der Fassade des Varietétheaters Pallace der Name des Chansonniers Michel Polnareff. Mit roten Lettern und Lämpchen angekündigt, solche, wie ich sie aus dem Zirkus kannte (den Polnareff gibt es noch immer?).