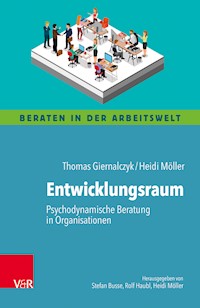
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Rationalität ist nicht selbstverständlich, sondern eine Leistung, die unter Berücksichtigung von Emotionalität erarbeitet werden muss – auch in Organisationen Hier setzt psychodynamische Beratung an. Psychodynamische Beratung in Organisationen berücksichtigt sowohl die rationale als auch die emotionale und unbewusste Seite von Menschen und arbeitet an der Schnittstelle von Organisationsstruktur und Persönlichkeit. Sie sorgt für haltende Bedingungen in Organisationen, unter denen besondere Entwicklungen möglich werden. Thomas Giernalczyk und Heidi Möller beschreiben kurz und kompakt zentrale Arbeitsprinzipien psychodynamischer Beratung und zeigen auf, wie diese in unterschiedlichen Beratungsformaten wie Coaching, Teamentwicklung und Strategieberatung eingesetzt werden können. Die psychodynamische Beratung vertraut auf den gesunden, interessierten, entwicklungsorientierten Ich-Anteil der Kunden und Klientinnen. Durch Beschreibungen, Interpretationen und Geschichten wird ein neuer Blick auf die Organisation zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht dann häufig einen Entwicklungsschritt im zu beratenden System. Psychodynamische Organisationsberatung achtet neben den »Spielregeln« einer Organisation besonders auf den Umgang mit Emotionen und dem Unbewussten in der Organisation. Dies führt zu Fragen wie: »Welche Gefühle und Empfindungen erzeugt die Art der Arbeit und wie werden diese bewältigt?« Die Autoren zeigen, wie psychodynamische Berater/-innen immer damit rechnen müssen, zeitweise von der Systemdynamik »infiziert« zu werden, und wie sie dies im Sinne einer erlebten Gegenübertragung in der Beratung nützen können: »Welche Rolle wird mir gerade zugewiesen? Was sagt das über die anderen Beteiligten aus?« Als Haltung der Beratenden empfehlen sie Containment. Damit ist eine Haltung gemeint, in der Berater/-innen oder Führungskraft Spannungen, Konflikte, kurz »Unverdauliches« aus dem System zunächst in sich aufnehmen, innerlich halten, darüber nachdenken und es erst dann in einer geeigneten Weise zurückgeben. Diese stellvertretende Verarbeitung hat oft eine verblüffende ansteckende und förderliche Wirkung auf die gesamte Organisation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Thomas Giernalczyk / Heidi Möller
Entwicklungsraum: Psychodynamische Beratung in Organisationen
Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Yindee/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-90121-3
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Vorwort
1Organisationen im Wandel
2Arbeitskonzepte – Theorien für die Praxis
2.1Primäre Aufgabe
2.2Primäres Risiko
2.3Emotionalität der Arbeit
2.4Psychosoziale Abwehr
2.5Übertragung und Gegenübertragung
2.6Containment
2.7Innovationskultur
2.8Rolle und Erwartungen
2.9PS-Modus und D-Modus als unbewusste Handlungsmuster
2.10Führungskräfte als Übertragungsfiguren
2.11Führung und Gefolgschaft
2.12Umgang mit negativen Emotionen und Erzeugung von Engagement und Leidenschaft
2.13Mentalisierung in der Arbeitswelt
2.13.1Regression
2.13.2Mentalisierung im Team und in der Organisation
2.13.3Zum methodischen Vorgehen
3Coaching – Triangulierung verstehen
3.1Die Triangulierungskompetenz im psychodynamischen Coaching
3.2Containment als Arbeitshaltung
3.3Konfliktachsen der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik als Koordinatensystem
3.4Das Objektbeziehungsdreieck
3.5Zusammenfassung wesentlicher Arbeitsprinzipien
4Teamentwicklung – neue Muster der Zusammenarbeit ermöglichen
4.1Ablauf einer Teamentwicklung
4.2Modell zur Teamdiagnose
4.3Merkmale psychodynamischer Teamentwicklung
5Teamsupervision – fortlaufende Reflexion der Primäraufgabe
5.1Nutzung von Spiegelungsphänomenen
5.2Interventionsebenen des Supervisors
5.3Methodik psychodynamischer Teamsupervision
6Konfliktmediation – von der Vulnerabilität zur symbolischen Decke
6.1Erweiterung des Konfliktverständnisses
6.2Untersuchung des manifesten und latenten Konfliktes
6.3Bearbeitung aktivierter psychodynamischer Konfliktthemen
6.4Das gemeinsame Gespräch der Konfliktparteien
7Organisationskulturen gestalten – Eigendynamiken erkennen und Spielräume eröffnen
7.1Hilfreiche Fragen zur Organisationskultur
7.2Evolution als Perspektive auf Organisationskulturen
7.3Kann man als psychodynamischer Organisationsberater Kulturen gestalten und diese aktiv verändern?
8Changemanagement – Subkulturen als Initiatoren nutzen
8.1Nowland und Nextland, die Arbeitsweisen wandeln sich
8.2Containment als Innovationsmotor
8.3Diagnosemodell für Organisations- und Kulturentwicklung
8.4Emotionalität als Changefaktor
8.5Die Förderung von Subkulturen
9Strategieentwicklung – Komplexität beidhändig bearbeiten
9.1Das Graswurzelmodell
9.2Die Antworten psychodynamischer Strategieentwicklung
9.3Das Cynefin-Framework
10Selbstreflexion als persönliche Voraussetzung des Beraters
10.1Die Rolle der eigenen Emotion
10.2Stetige Supervision oder Intervision
10.3Die Bedeutung der Selbsterfahrung
11Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mitgestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Vorwort
In Zeiten raschen Wandels und disruptiver Entwicklungen gewinnt die Perspektive der psychodynamischen Organisationsberatung eine besondere Aktualität. Um diesen Wandel gestalten und leben zu können, brauchen Organisationen und ihre Mitglieder mehr denn je ein passendes psychologisches Verständnis und psychologische Kompetenzen wie innezuhalten, über Emotionen nachzudenken und mit komplexen und dabei vorläufigen Lösungen zu arbeiten.
Thomas Giernalczyk und Heidi Möller sind ausgewiesene Experten im Schnittfeld von praktischer Organisationsberatung in unterschiedlichen Organisationskulturen, neuester universitärer Forschung und angewandter Psychoanalyse. Sie stellen mit diesem konzeptuell präzisen und für die Praxis relevanten Band ein ungemein lesbares Update von klassischen psychodynamischen Organisationskonzepten vor. Spannend ist insbesondere, wie sie das im psychologisch-psychotherapeutischen Feld bewährte diagnostische Instrument der OPD (operationalisierte psychodynamische Diagnostik) auf die Diagnostik im Coaching und die Darstellung von Konflikten in Organisationen anwenden. Oder wie das zentrale psychodynamische Konzept des Containments, also der Fähigkeit, auch unter Stress nachdenken und Eindrücke verarbeiten zu können, auf die Arbeit mit Führungskräften angewandt und fruchtbar gemacht wird. Giernalczyk und Möller verbinden diesen kompakten Überblick elegant mit aktuellen Entwicklungen in der allgemeinen Organisationstheorie, die durch die Entwicklungen von New Work, Arbeiten 4.0 und Digitalisierung angestoßen wurden. Sie lenken unseren Blick insbesondere auf die psychologische Dimension von Change Management und Transformation und verbinden sie mit frischen Konzepten aus der psychologisch-psychotherapeutischen Forschung und Praxis. So zeigen sie z. B. eindrücklich die Bedeutung der Fähigkeit zu mentalisieren, also die Welt mit den Augen des Gegenübers sehen zu können bzw. ihm die Einfühlung in die eigene Sicht zu ermöglichen. Sie analysieren die Rolle von »inner work«, der Reflexions- und Verarbeitungsfähigkeit von Widersprüchen und Dilemmata, wie sie insbesondere in neuen Arbeitsformen auftreten. Und sie entwickeln die Bedeutung der »symbolischen Decke« als Boden der Gemeinsamkeit in der Konfliktmoderation.
Damit gewinnen Leser/-innen eine klare Orientierungshilfe beim Umgang mit den Problemstellungen von Führung und Beratung und vielfältige Anregungen, wie sie in Zeiten raschen Wandels führen und beraten können. Daher sei allen aus dem Bereich Führung, Beratung, aber auch Forschung und Ausbildung dieser kompakte und spannend zu lesende Band wärmstens empfohlen.
München
Mathias Lohmer
1Organisationen im Wandel
Die psychodynamische Beratung bietet einen geschützten Reflexionsraum in Organisationen, wie z. B. in Wirtschaftsunternehmen, in der öffentlichen Verwaltung, in sozialen Dienstleistungsunternehmen, in Bildungseinrichtungen und im Gesundheitswesen. Die Nachfrage hierfür ist in den letzten Jahren gestiegen – vor dem Hintergrund der »üblichen Verdächtigen«, wie Kühl (2008, S. 19) die Determinanten des erhöhten Beratungsbedarfs nennt: die immense Komplexität der Organisationen, die kaum noch zu bewältigenden Entscheidungsanforderungen, die Tempoverschärfung, der technologische Fortschritt, die Entgrenzung der Arbeitswelt, die Digitalisierung und schließlich die Globalisierung mit ihren Anforderungen und Krisen. All diese strukturellen Veränderungen haben zur Folge, dass sich das Verhältnis von Erwerbstätigkeit und Privatsphäre verschiebt. Den Arbeitskraftunternehmern1 (auch Angestellte verstehen sich als Unternehmerinnen ihrer eigenen Arbeitskraft) wird immer mehr Flexibilität und Mobilität abverlangt. Die zeitliche und räumliche Entgrenzung der Arbeit hat zur Folge, dass über neue Arbeitszeitmodelle nachgedacht wird und die Arbeit nicht mehr an einen festen Ort gekoppelt ist. Das birgt einerseits Chancen, wie Telearbeit für junge Eltern, andererseits Gefahren, wie Überforderung durch ständige Erreichbarkeit. Viele junge Menschen befinden sich in prekären Arbeitsverhältnissen, befristeten Verträgen oder Projekten, was dazu führt, dass eine zusammenhängende Berufsbiografie kaum noch geschrieben werden kann (Möller, 2010). Auf der anderen Seite gibt es neben Arbeit 4.0 vielversprechende »New-Work«-Ansätze in Unternehmen, in denen aufgrund der veränderten Produktionsverhältnisse neue, selbstgesteuerte Arbeitsformen und sinnerfüllte Arbeit als Erfolgsfaktoren gesetzt werden (Lalaux, 2015). Die psychodynamische Beratung greift diese Spannungsverhältnisse auf und setzt sich explizit mit Emotionalität als vernachlässigtem Faktor in der Unternehmenswelt auseinander. Sie fördert emotionales Denken, bei dem assoziative Momente eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus hat sie elaborierte Konzepte, die beschreiben, unter welchen Bedingungen sich Innovation und Veränderungen entfalten können. Psychodynamische Beratung bezieht in ihrem soziotechnischen Ansatz sowohl Individuen als auch Organisationsstrukturen und -prozesse systematisch in den Prozess mit ein (Giernalczyk u. Lohmer, 2012).
1In diesem Band werden abwechselnd die weibliche und männliche Form verwendet. Im Sinne der gendersensiblen Sprache mögen sich alle Geschlechtsidentitäten mitgemeint fühlen.
2Arbeitskonzepte – Theorien für die Praxis
Die Tradition der psychodynamischen Organisationsberatung ist durch Zentren wie das Tavistock Institute of Human Relations in London mit Autoren wie Anton Obholzer und Eric Miller, durch die Gruppe um Larry Hirschhorn in den USA, durch Manfred Kets de Vries in den Niederlanden und durch eine deutsche Tradition mit Autorinnen wie Heidi Möller, Ross Lazar, Rolf Haubl, Thomas Giernalczyk und Mathias Lohmer etabliert worden. International sind diese Berater in der ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations) miteinander verbunden. Wir wollen zu Beginn vier Merkmale psychodynamischer Organisationsberatung herausstellen, die wir im Folgenden anhand zentraler Arbeitskonzepte (vgl. Abbildung 1) vertiefend darstellen.
1.Neben den »Spielregeln« einer Organisation achtet die psychodynamische Beratung besonders auf den Umgang mit Emotionen und dem Unbewussten in der Organisation. Dies führt zu Fragen wie: Welche Gefühle und Empfindungen erzeugt die Art der Arbeit und wie werden diese bewältigt? Welche psychosozialen (kollektiven, organisationalen) Abwehrmechanismen werden benutzt, um schwierige Emotionen abzuwehren? Gelingt es der Organisation, Leidenschaft (»passion«) für die Arbeit zu wecken? Kann sinnvolle Arbeit geschehen oder wird diese durch Abwehrmanöver behindert?
2.Psychodynamische Beraterinnen rechnen immer damit, zeitweise von der Systemdynamik »infiziert« zu werden – nutzen dies aber im Sinne einer erlebten Gegenübertragung als wichtiges Diagnostikum in der Beratung (Welche Rolle wird mir gerade zugewiesen? Was befürchte ich oder will ich unbedingt?). Das Beraterteam, die Kolleginnengruppe, Supervision und Intervision werden deshalb regelmäßig genutzt, um diese Verwicklung, Ansteckung und Gegenübertragung erkennen und nutzen zu können.
Abbildung 1: Arbeitskonzepte psychodynamischer Organisationsberatung (Giernalczyk, Lazar u. Lohmer, 2015)
3.Für die Haltung des Beraters, die Gestaltung einer Beratungsarchitektur, aber auch für die Haltung von Führungskräften ist uns der psychoanalytische Begriff des Containments wichtig. Damit ist eine Haltung gemeint, in der Beraterin oder Führungskraft Spannungen, Konflikte – kurz: »Unverdauliches« – aus dem System zunächst in sich aufnehmen, innerlich halten, darüber nachdenken und es erst dann in einer geeigneten Weise zurückgeben. Diese stellvertretende Verarbeitung hat oft eine verblüffende, ansteckende Wirkung auf das zu beratende System.
4.Die psychodynamische Beratung vertraut darauf, den »gesunden, interessierten, entwicklungsorientierten Ich-Anteil« der Kunden und Klientinnen durch Beschreibungen, Interpretationen und »Geschichten«, die zur Verfügung gestellt werden, zu erreichen. (»Wenn ich miterlebe, wie Sie gerade hier diskutieren, habe ich den Eindruck, dass es angesichts dieser schwierigen strategischen Entscheidung sehr verführerisch ist, in diese polaren Gegenpositionen zu gehen – obwohl Sie vermutlich alle beide Seiten in sich erleben.«) Dies ermöglicht dann häufig einen Integrationsschritt im zu beratenden System (Wimmer et al., 2017).
2.1Primäre Aufgabe
Aus der Perspektive des Tavistockmodells hat jede Organisation eine Primäraufgabe. Die Primäraufgabe ist die vordringliche Aufgabe, die eine Organisation ausfüllen muss, um ihr Fortbestehen zu sichern. Sie leitet sich aus dem Verhältnis von Input und Output ab. Außerdem bestimmt die Primäraufgabe, welcher Input in welchen Output verwandelt werden soll. Somit beschreibt sie die zentralen Zwecke und die wesentlichen Praktiken der Organisation (Miller u. Rice, 1990). In anderen Modellen der Organisationsdiagnostik wird von der Identität (Glasl, Kalcher u. Piber, 2014) gesprochen: Wer sind wir und welchen einmaligen Nutzen stiften wir?
Die Primäraufgabe ist ein heuristisches Konzept, das den Zweck der Organisation und seine wichtigsten Vorgehensweisen in das Zentrum der Betrachtung rückt. Aus der Primäraufgabe lassen sich also Ziele, Strategien und konkrete Maßnahmen ableiten. Die Diskussion mit Führungskräften über die Primäraufgabe ihrer Organisation zeigt jedoch oft, dass es keine gemeinsame Klarheit über sie gibt. Dementsprechend werden die Aktivitäten nicht in diesem Sinne, sondern eher entlang bekannter Routinen organisiert, die vor Ängsten und unbequemen Einsichten schützen. Aufgrund permanenter Veränderungen der Umwelt und des Marktes müssen sich Organisationen an die Erfordernisse anpassen, um überlebensfähig zu bleiben. Diese Veränderung wandelt auch die Primäraufgabe der Organisation. Lautete die Primäraufgabe von Kliniken in der Vergangenheit »Patienten behandeln«, so heißt sie inzwischen »Patientinnen behandeln und dabei gewinnbringend sein«. Das Konzept ist somit eine effektive Komplexitätsreduktion. Durch die Diskussion der Primäraufgabe kommen Führungskräfte und Mitarbeiter auf die Grundfragen: Um was geht es hier eigentlich? Was müssen wir tun, um unser Überleben zu sichern? Was bestimmt unser Vorgehen über die offizielle Strategie hinaus? Wie müssen wir uns verändern, damit wir die Primäraufgabe optimal erfüllen?
Leitfragen für die Primäraufgabe
Mit welchen Praktiken und Vorgehensweisen werden die wichtigsten Ziele erreicht?
Was sichert unsere Existenz?
2.2Primäres Risiko
Das primäre Risiko beschreibt die Gefahr, falsche Entscheidungen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung einer Organisation zu treffen. Es geht um das Risiko, das entsteht, wenn sich eine Elektronikherstellerin aus der Produktion von Mobiltelefonen zurückzieht, statt sie weiterzubetreiben. Das primäre Risiko beschreibt damit auch die Unsicherheit und die emotionalen Auswirkungen, die mit strategischen Entscheidungen verbunden sind (Hirschhorn, 2004).





























