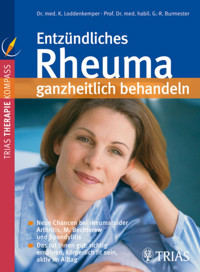
19,99 €
Mehr erfahren.
Sie leiden an Gelenkschmerzen und steifen Gelenken am Morgen, fühlen sich abgeschlagen und appetitlos - und vermuten, dass Rheuma der Grund sein könnte? Dann verlieren Sie keine Zeit. Denn je früher Sie Klarheit erhalten, desto besser sind die Chancen, gezielt gegen den Schmerz und die Veränderungen vorzugehen. Ihr Therapiebegleiter zeigt Ihnen den Weg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Dr. med. Konstanze Loddenkemper ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologin. Seit 1994 ist sie an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immunologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Mitte, im stationären und ambulanten Bereich tätig.
Forschungsschwerpunkte: Besonderheiten des Knochenstoffwechsels bei Patienten mit entzündlichen-rheumatischen Erkrankungen und die steroidinduzierte Osteoporose.
Prof. Dr. med. habil. Gerd-Rüdiger Burmester ist seit 1993 Universitätsprofessor für Innere Medizin und Rheumatologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin Campus Mitte. Für seine bisherige Arbeit erhielt er seit 1977 verschiedene wissenschaftliche Preise. Von 2001–2004 war er Präsident und zweiter Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Er ist Mitglied in Editorial Boards mehrerer internationaler wissenschaftlicher Journale. Forschungsschwerpunkte: Klinische und experimentelle Rheumatologie und Immunologie, Immuntherapie, Tissue Engineering.
Danksagung
Folgenden Personen danken wir herzlich für Ihre Unterstützung bei der Entstehung dieses Buches: den beiden Betroffenen, die ihre persönliche Geschichte hier so offengelegt haben und mit deren Veröffentlichung sie einverstanden waren, den Betroffenen, deren Hände zur Demonstration des typischen Befallsmusters bei RA abgebildet sind, Frau U. Gombert (Ergotherapeutin an der Charité-Mitte, Berlin in der Rheumatologie) und Herrn Dr. K.-G. Hermann, Institut für Radiologie der Charite-Mitte/Berlin für die Überlassung der radiologischen Bilder.
Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Die rheumatischen Erkrankungen umfassen mehr als 400 verschiedene Krankheitsbilder. Nach ihrer Ätiologie lassen sie sich in degenerative, stoffwechselbedingte und entzündlich-rheumatische Erkrankungen einteilen. Zu den entzündlich-rheumatischen Krankheiten zählen die entzündlichen Störungen des Bewegungsapparates, unter anderen die rheumatoide Arthritis, der Morbus Bechterew und viele mehr.
Das vorliegende Buch ist ganz den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen gewidmet. Hier handelt es sich um chronisch verlaufende Erkrankungen, die die Betroffenen oft über Jahre begleiten. Durch den rasanten Fortschritt in der Medizin ist es heute möglich, die Diagnose immer frühzeitiger zu stellen. Daher kann eine optimale Therapie, die den Verlauf der Krankheit maßgeblich zum Positiven verändert, zu einem sehr frühen Zeitpunkt eingeleitet werden. Doch allein eine optimale medikamentöse Therapie ist oft nicht ausreichend. Die umfassende Aufklärung über die Ursachen und den Verlauf der Gesundheitsstörung sowie begleitende Maßnahmen, die die Betroffenen selbst durchführen können, lassen ein multimodales Therapiekonzept entstehen. Im Rahmen dieses ganzheitlichen Therapieansatzes kann der bestmögliche Krankheitsverlauf erzielt werden. Daher ist das vorliegende Buch an betroffene Patienten, niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und andere betreuende Mitarbeiter von Rheumapatienten gerichtet. Es sollen neben den theoretischen Grundlagen vor allem additive/alternative Heilmethoden, physikalische/physiotherapeutische Anwendungen und psychologische Maßnahmen erörtert werden, um ein besseres Verständnis der Grundlagen der entzündlich-rheumatischen Gelenkerkrankungen zu vermitteln und ein aktives Mitgestalten des Krankheitsverlaufes durch den Patienten zu erzielen. Sollten Sie nach dem Lesen des Buches Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge haben, wären wir über deren Zusendung sehr dankbar.
Berlin, im Frühjahr 2007
Dr. med. K. Loddenkemper
Prof. Dr. med. habil. G.-R. Burmester
Basiswissen
Kaum eine Erkrankung zeigt sich in so vielen Facetten wie das Rheuma, wörtlich übersetzt »der fließende Schmerz«. In medizinischen Lehrbüchern findet man mehr als 400 rheumatische Erkrankungen. Allen gemeinsam ist der Schmerz am Bewegungsapparat, also an Gelenken, Muskeln, Sehnen und Bändern. Das Verständnis um die Ursachen erleichtert den Umgang mit der Krankheit.
Zur Geschichte des Rheumatismus
Die Geschichte des Rheumatismus beginnt mit den Schriften von Hippokrates von Kós (460–375 v. Chr), dem berühmtesten Arzt des Altertums und Zeitgenossen Platons. Er nahm bereits eine Unterscheidung verschiedener entzündlich-rheumatischer Erkrankungen vor und beschrieb erstmals Gelenkentzündungen, die bevorzugt jüngere Menschen befielen und oft einen chronischen Verlauf hatten. Galenos von Pergamon, auch bekannt als Galen, war griechischer Philosoph, Arzt und Anatom und lebte von 129 bis 199 n. Chr. Er fasste alle verschiedenen Gelenkerkrankungen unter dem Begriff Arthritis (Gelenkentzündung) zusammen, was zu vielen Unstimmigkeiten führte.
Wegweisende Persönlichkeiten in der Geschichte des Rheumatismus
Erst im 16. Jahrhundert wurden die Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises neu entdeckt und beschrieben. Jean-Baptiste Bouillaud prägte das Wort Rheumatismus für eine Krankheit, die läuft, abläuft und vorübergeht und unterschied so die Gelenkerkrankungen in akute, vorübergehende und chronische (einschließlich der Gicht). Erst zwei Jahrhunderte später wurde die Gicht vom »Rheumatismus« abgegrenzt. Es erfolgte eine Unterteilung der rheumatischen Erkrankungen in einen so genannten Muskelrheumatismus und einen Gelenkrheumatismus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden die rheumatischen Erkrankungen nach anatomisch-klinischen, ätiologischen, pathogenetischen und therapeutischen Ansätzen neu eingeteilt – ein Meilenstein in der Medizingeschichte.
Der lange Zeitstrahl macht ersichtlich, wie viel Zeit vergehen musste, um den komplexen Krankheitsbildern des rheumatischen Formenkreises mit einer entsprechenden Systematik gerecht zu werden.
Als Kriterium der Gliederung dienen heute die Verteilung der Schmerzen und Entzündungen auf die Gelenke, die Ausprägung von Begleiterscheinungen sowie das unterschiedliche Ansprechen auf Therapiemaßnahmen. Heute werden die nahezu 400 verschiedenen rheumatischen Erkrankungen in degenerative, stoffwechselbedingte und entzündlich-rheumatische Erkrankungen eingeteilt. Im vorliegenden Ratgeber stehen die entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates im Vordergrund, zu denen unter anderem die rheumatoide und die reaktive Arthritis sowie der Morbus Bechterew gehören.
Wir möchten Ihnen helfen, das diagnostische Vorgehen zu verstehen sowie schulmedizinische und alternative Heilmethoden und Hilfsmöglichkeiten kennen zu lernen. Betroffenen und Mitarbeitern in Rheumasprechstunden soll fundiertes rheumatologisches Wissen vermittelt werden.
»Rheuma« – ein Name – viele Krankheitsbilder
Bei den rheumatischen Erkrankungen werden, je nach Ursache, verschiedene Formen unterschieden:
WISSEN
Einteilung rheumatischer Erkrankungen:
degenerative Gelenkerkrankungen (Arthrose)stoffwechelsbedingte Gelenkerkrankungen (z. B. Gicht)entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis)entzündliche Bindegewebserkrankungen (z. B. systemischer Lupus erythematodes)entzündlich bedingte Gefäßerkrankungen (Vasculitiden)All diese Erkrankungen besitzen den Schmerz sowie Funktionseinschränkungen des Bewegungsapparates als gemeinsame Symptome. Schwellungen, Rötungen und auch Überwärmung sind häufige Begleiterscheinungen. Befallen werden können in der Regel alle Gelenke. Oft gibt uns – rein äußerlich betrachtet – allein schon das Befallsmuster einer Gelenkerkrankung Aufschluss über deren Genese.
Die entscheidenden Unterschiede finden sich bei den Abläufen der Krankheitsentstehung.
WISSEN
Was versteht man unter Rheuma?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fasst in einer sehr umfassenden Definition alle vorübergehenden oder chronischen, mit Schmerzen oder Funktionsverlusten einhergehenden Störungen des Bewegungsapparates und der Stützorgane, also Muskeln und ihre Hüllen, Sehnen, Knochen, Gelenke und Bänder, zum rheumatischen Formenkreis zusammen.
Unterschiede gibt es bei diesen Erkrankungen nicht nur bei der Entstehung, sondern auch bei der Behandlung. So wird z. B. eine Arthrose in der Regel von den Orthopäden und eine entzündlichrheumatische Erkrankung vorwiegend von Rheumatologen oder Internisten behandelt.
Viele Patienten, die in unsere Sprechstunde kommen, haben einen langen Leidensweg hinter sich. Häufig wurden sie bereits über lange Zeit mit unzureichenden, herkömmlichen Schmerzmitteln behandelt, bevor die Diagnose einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung gesichert wurde.
Aus diesem Grund möchten wir einen Wegweiser geben, der es Ihnen leichter macht, hinsichtlich Ihrer Gelenkbeschwerden den »richtigen« Arzt aufzusuchen.
WISSEN
Ursachen rheumatischer Erkrankungen
Bei degenerativen Erkrankungen kommt es im Rahmen einer Fehlbelastung (z. B. bei X-Beinen) zu einer Druckbelastung auf ein bestimmtes Gelenkareal, dies führt nachfolgend zu Gelenkspaltverschmälerung mit Reduktion der Knorpelschicht und nicht zuletzt zu knöchernen Umbauten.Bei stoffwechselbedingten Gelenkerkrankungen, zu denen die Gicht gezählt wird, kommt es durch eine unzureichende Ausscheidung von mit der Nahrung aufgenommenen Eiweißen zu einer Anreicherung des Abbauproduktes der Eiweiße, der Harnsäure. Diese kann sich in Form von Kristallen in Gelenkflüssigkeiten anreichern und dort zu Entzündungen der Gelenkhaut und somit des ganzen Gelenkes führen.Bei den entzündlich-rheumatischen Erkrankungen finden wir eine Fehlfunktion des Immunsystems als Ursache. Diese führt zu einer Entzündung der Gelenkinnenhaut mit nachfolgender Ausbildung eines Gelenkergusses und Anreicherung von Entzündungsbotenstoffen, was letztendlich zur Zerstörung des Knorpels und des Knochens führt. Typischerweise findet man daher in fortgeschrittenen Stadien dieser Erkrankungen gelenknahe Knochendefekte.Einblicke in den Körper
Bevor wir auf die einzelnen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen im Detail eingehen wollen, möchten wir zunächst den Aufbau und die Funktionsweise der Gelenke und des Immunsystems darstellen.
Wie ist ein Gelenk aufgebaut?
Unser Stütz- und Halteapparat, das Skelett, besteht aus nahezu 200 Knochen. Diese Knochen sind durch Gelenke miteinander verbunden, die uns Bewegungen in verschiedene Richtungen und zielgerichtete Tätigkeiten ermöglichen. Wir unterscheiden so genannte »echte Gelenke« von den »unechten Gelenken«:
Die echten Gelenke werden unterschieden in
Scharniergelenke,
z. B. Finger- und Zehengelenke, welche sich strecken und beugen lassen und daher an ein Scharniergelenk einer Tür erinnern,
Sattelgelenke,
z. B. das Daumengrundgelenk, bei dem neben dem Beugen und Strecken noch Vor-, Rück- und Seitbewegungen möglich sind und
Kugelgelenke,
z. B. das Schultergelenk, das eine Rundum-Bewegung ausführen kann.
Die unechten Gelenke werden als Fuge oder Synarthrose bezeichnet. Hier sind zwei Knochen über einen Füllstoff, Bindegewebe, Knorpel oder Knochenmaterial miteinander verbunden, sodass nur eine sehr geringe Bewegung, die dem Menschen meist nicht bewusst wird, möglich ist. Die Schädelnähte, die die Knochen des Schädeldachs verbinden, sind Bandfugen, die fünf verschmolzenen Wirbel des Kreuzbeins dagegen sind durch Knochensubstanz (Knochenfuge) miteinander verbunden.
Das Gelenk im Detail. Gehen wir nun ins Detail und schauen uns ein Gelenk im Einzelnen an. Als Beispiel hierzu nehmen wir das Hüftgelenk, bei dem es sich um ein Kugelgelenk handelt. Der runde Gelenkkopf (Hüftkopf) sitzt in der Gelenkpfanne, der als Widerlager fungiert und eine Stabilität bietet. Beide Anteile des Gelenkes sind besonders gut aufeinander abgestimmt und ermöglichen im Zusammenspiel mit den Sehnen und Muskeln eine Bewegung in alle Richtungen. Die Gelenkpfanne und der Gelenkkopf sind im Bereich der kommunizierenden Anteile von Knorpel überzogen, um die Reibung so gering wie möglich zu halten. Dieser Knorpel wirkt wie eine Art Stoßdämpfer. Zusätzlich wird das Gelenk bei nahezu jeder Bewegung durch die Gelenkflüssigkeit, die so genannte Synovia, geschmiert. Diese wird von der Gelenkinnenhaut, der Synovialis, produziert. Somit kann der Gelenkwiderstand sehr gering gehalten werden. Neben der Schmierung des Gelenkes übernimmt die Synovia die Versorgung des Knorpels mit Nährstoffen, da der Knorpel selbst keine eigenen versorgenden Blutgefäße besitzt. Dies ist für den Knorpel auch ein Vorteil, da er somit stärkeren Belastungen ausgesetzt werden kann, ohne dass seine Ernährung durch abgedrückte Blutgefäße Schaden nimmt.
Der Aufbau des Gelenkes am Beispiel des Hüftgelenks
Was passiert nun bei den entzündlichrheumatischen Erkrankungen mit unseren Gelenken? Der Grundmechanismus ist in der Regel bei allen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen ähnlich. Durch eine Fehlsteuerung im Immunsystem kommt es zu einer Entzündung der Gelenkinnenhaut. Diese produziert durch die Entzündung vermehrt Synovia, die mit einer Vielzahl Entzündungsbotenstoffen angereichert ist. Diese Stoffe können ihrerseits Zellen des Abwehrsystems des Menschen aktivieren, die zu weiteren Entzündungsreaktionen führen. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einer Schädigung des Knorpels und letztendlich zur Zerstörung des gelenknahen Knochens.
Die Bedeutung des Immunsystems
Die genauen Ursachen der entzündlichrheumatischen Erkrankungen sind bis heute nicht endgültig geklärt. In den letzten Jahren erhärtet sich aber die Meinung, dass es sich um so genannte Autoimmunerkrankungen, also fehlgeleitete Abwehrreaktionen gegen Strukturen des eigenen Körpers, handelt. Unser Abwehrsystem, das Immunsystem, hat normalerweise die Aufgabe, Infektionserreger und entartete Zellen im Körper zu erkennen und zu vernichten. Dies gelingt dem Immunsystem in der Regel sehr gut, da es in der Lage ist, »körperfremdes« Material von »körpereigenem« zu unterscheiden. In diesem Prozess kommt spezialisierten weißen Blutkörperchen, den B- und T-Zellen, eine große Bedeutung zu. Diese Abwehrzellen erkennen Infektionserreger und machen sie unschädlich. Körpereigene Zellen oder auch nützliche Darmbakterien werden als körpereigen erkannt und nicht angegriffen. So scheint unser Immunsystem nahezu perfekt. Eine Störung in diesem System kann jedoch dazu führen, dass das Immunsystem körpereigene Bestandteile als fremd ansieht und fälschlicherweise bekämpft. Solche Störungen findet man bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. B- und T-Zellen scheinen Zellen der Gelenkinnenhaut mit Krankheitserregern zu verwechseln und zu zerstören. Bis heute ist die letztendliche Ursache dieser Störungen nicht in allen Einzelheiten bekannt.
Kommunikation zwischen Zellen. Die Abwehrreaktion der B- und T-Zellen gegen die Zellen der Gelenkinnenhaut löst eine Entzündung im Körper aus. Die falsch arbeitenden B- und T-Zellen schütten eine Reihe von Botenstoffen aus. Im weiteren Verlauf werden auch andere Immunzellen aktiviert und entzündungsfördernde Stoffe freigesetzt. Dadurch kommt es zur Entzündung, die durch die Zellen der Gelenkinnenhaut unterhalten wird, Knorpel und Knochen werden angegriffen. Eine Hauptrolle innerhalb dieses Krankheitsprozesses kommt den Zytokinen zu. Zytokine sind Botenstoffe, die von Zellen ausgestoßen werden und eine »Kommunikation« zwischen Zellen ermöglichen. Diese Botenstoffe werden von verschiedenen Zellen produziert und ausgeschieden. Andere Zellen, die so genannten Zielzellen, besitzen ihrerseits an der Zelloberfläche Bindungsstellen für diese Zytokine. Wird ein Botenstoff an einer Bindungsstelle gebunden, so verändert sich die Struktur der Bindungsstelle. Dies ist für die Zelle ein Signal, das im Zellinneren wahrgenommen wird. Die Zielzelle kann auf dieses Signal beispielsweise mit der Produktion eines Stoffes antworten. So beeinflussen sich die Zellen gegenseitig und unterhalten dadurch Entzündungsprozesse.
WISSEN
Gibt es eine genetische Veranlagung für eine rheumatische Erkrankung?
Sicherlich kann man die rheumatischen Erkrankungen nicht als Erbkrankheiten im engeren Sinne betrachten, es gibt jedoch Hinweise auf eine genetisch bedingte Veranlagung. Damit sich die Krankheit entwickelt, müssen jedoch weitere, bislang nicht im Einzelnen geklärte Faktoren hinzukommen. Forschungsprojekte untersuchen die Zusammenhänge zwischen verschiedenen rheumatischen Krankheitsbildern und deren genetischen Grundlagen. Interessant sind hier besonders Familien, in denen mehrere Personen an verschiedenen Formen der rheumatischen Erkrankungen leiden. Genetiker beschäftigen sich außerdem mit der Frage, welche Gene in den fehlgesteuerten Zellen des Immunsystems an- oder abgeschaltet werden. Diese Forschungen dienen der Weiterentwicklung der Diagnostik und Therapie rheumatischer Erkrankungen.
Der Weg des Betroffenen – vom ersten Schmerz bis zum ersten Arztkontakt
Aus Angst vor der Diagnose scheut sich so mancher vor dem Besuch des Arztes – aber seien Sie sicher, es ist der erste Schritt zur Linderung Ihrer Beschwerden.
»Habe ich etwa Rheuma?«
Die ersten Beschwerden werden von Rheumapatienten schon lange vor dem ersten Besuch beim Arzt bemerkt. Gut in Erinnerung ist mir eine 45-jährige Frau, die angab, schon 11/2 Jahre vor der Vorstellung in unserer Ambulanz Gelenkschmerzen und Schwellungen im Bereich der Finger- und Handgelenke bemerkt zu haben. Leider sind die ersten Beschwerden häufig nicht so klar und eindeutig, dass die Diagnose »Rheuma« auf Anhieb gestellt werden kann. Oft sind die Beschwerden diffus und die Betroffenen jung. Die Diagnose »Rheuma« ist landläufig jedoch an ein höheres Lebensalter gekoppelt, und so verdrängen selbst die Betroffenen oft ihre Schmerzen. Frei nach dem Motto
»Weil nicht sein kann, was nicht sein darf!«
Die Schilderungen von ganz unterschiedlichen Krankheitsgeschichten im vorliegenden Buch helfen vielleicht dem einen oder anderen, seine Symptome frühzeitiger einzuordnen und einen Arzt aufzusuchen.
Beschwerden des Bewegungsapparates führen die meisten Menschen zuerst zu ihrem Hausarzt. Oft handelt es sich bei Gelenk- und Muskelschmerzen nur um harmlose Verspannungen, Muskelkater oder Zerrungen, die durch physikalische Maßnahmen rasch behebbar sind. Bei anhaltenden Gelenkbeschwerden oder Rückenschmerzen überweist der Hausarzt seinen Patienten in der Regel an einen Orthopäden oder Arzt für Physikalische Therapie. Dieser klärt ab, inwieweit die Beschwerden durch Abnutzungserscheinungen oder muskuläre Fehlbelastungen entstanden sind.
WISSEN
Mögliche erste Symptome einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung:
GelenkschmerzenGelenkschwellungenMüdigkeit/AbgeschlagenheitAppetitlosigkeitNachtschweißMorgensteifigkeitGewichtsverlustDer Weg zur Diagnose
Alarmzeichen, die auf einen entzündlichen Schmerz hindeuten und bei denen Sie an Rheuma denken sollten, sind:
morgendliche und nächtliche Gelenk- oder Rückenschmerzen
chronische Schmerzen bei jungen Patienten (da in der Regel noch keine Abnutzungserscheinungen zu erwarten sind) und
das Vorhandensein von hohen Entzündungswerten im Blut.
Die letztgenannten Symptome sollten dazu führen, den Betroffenen bei einem Rheumatologen vorzustellen, um eine entzündlich-rheumatische Erkrankung abzuklären.
Ein erfahrener Rheumatologe kann oft schon nach Erhebung der Krankengeschichte die Diagnose »entzündliches Rheuma« mit großer Wahrscheinlichkeit stellen. Zur Feststellung des Ausmaßes der Erkrankung und zur Festlegung der Therapie sind meist weitere Diagnoseverfahren notwendig (siehe → S. 29, »Die rheumatischen Erkrankungen«).
WISSEN
Die rheumatische Diagnosesicherung stützt sich auf drei wesentliche Punkte
Krankengeschichte (Anmanese) und klinische Untersuchunglaborchemische Untersuchungen (Entzündungswerte, Autoantikörperdiagnostik, genetische Erbmerkmale, Infektionsdiagnostik)apparative Diagnostik (Röntgen, Ultraschall, nuklearmedizinsche Untersuchungen, in selteneren Fällen auch computertomographische (CT) und magnetresonanztomographische (MRT) Untersuchungen)Deutschlandweit gibt es relativ wenige Fachärzte für Innere Medizin, die sich auf das Gebiet der Rheumatologie spezialisiert haben.
WISSEN
Nutzen Sie Wartezeiten!
Manchmal müssen Sie auf einen Termin beim Rheumatologen längere Zeit warten. Nutzen Sie die Zeit sinnvoll. Röntgenuntersuchungen der betroffenen Gelenkregionen und laborchemische Untersuchungen kann auch Ihr Hausarzt anordnen. Die Ergebnisse können Sie dann dem Rheumatologen vorgelegen.
Anamnese. Die Erhebung der Krankengeschichte, der Anamnese, nimmt eine zentrale Stellung bei der Diagnosestellung ein. Ihr Arzt wird Ihnen eine Reihe typischer Fragen stellen.
Wann besteht der Verdacht auf entzündliches Rheuma?
Sie Sollten einen Arzt aufsuchen, wenn Sie folgende Symptome an sich beobachten:
Schwellungen und Schmerzen von Gelenken, die ohne vorangegangene Verletzung auftreten
Rötung und Überwärmung eines Gelenkes
immer wiederkehrende Schmerzen in demselben Gelenk
WISSEN
Typische Fragen des Arztes:
Seit wann bestehen Ihre Gelenk-/Rückenbeschwerden?Haben die Gelenk-/Rückenschmerzen plötzlich oder schleichend begonnen?Welche Gelenke sind betroffen? Eher die kleinen Gelenke an Fingern oder Zehen oder eher die großen an Knie und Schultern?Gab es vor dem Auftreten der Gelenkbeschwerden irgendwelche Besonderheiten, z. B. eine Verletzung, eine Durchfallerkrankung, Halsschmerzen, eine Operation oder Ähnliches?Stören die Gelenk-/Rückenschmerzen Ihren Schlaf?Spüren Sie morgens eine Steifigkeit der Gelenke? Wenn Ja, wie lange hält sie an?Gelenk- und Rückenschmerzen, die besonders in Ruhephasen in den Vordergrund treten (nachts oder in den Morgenstunden)
besonders ausgeprägte morgendliche Schwellung von Fingergelenken mit deutlicher Morgensteifigkeit; Problem nach dem Händeschütteln
Nachweis hoher Entzündungswerte beim Hausarzt, z. B. Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und C-reaktives Protein (CrP)
Flussdiagramm – vom Symptom zur Diagnose
Anhand der Antworten kann Ihr Arzt bereits eine erste Zuordnung Ihrer Beschwerden zu einer eventuell bei Ihnen vorliegenden entzündlich-rheumatischen Erkrankung vornehmen. Er kann dann die nachfolgende Diagnostik mit laborchemischen und radiologischen Untersuchungen gezielt in die Wege leiten.
Laborchemische Diagnostik. Die laborchemische Diagnostik beginnt mit einer Basisdiagnostik, bei der zunächst eher allgemeine Entzündungswerte (Blutsenkungsgeschwindigkeit – BSG und C-reaktives Protein – CrP) gemessen werden. Diese Entzündungswerte sind bei allen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen erhöht. Ausnahmen können bei Erkrankungen wie Psoriasis Arthritis, Spondyloarthropathien und Morbus Bechterew auftreten. Allerdings kann die BSG auch durch andere Entzündungen im Körper, z. B. eine Grippe oder Blasenentzündung verursacht sein.
Laborbefunde alleine erlauben noch keine sichere Diagnose. Beispielsweise lassen sich Rheumafaktoren auch bei ca. 5% der gesunden Bevölkerung nachweisen.
Radiologische Diagnostik.





























