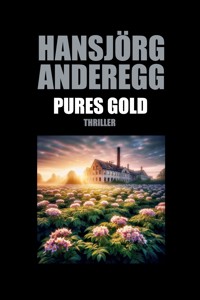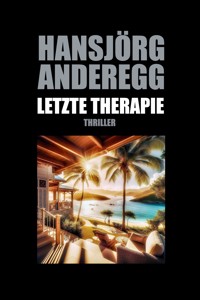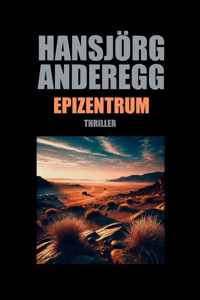
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Wahrheit ist tödlicher als jede Krise. Schüsse mitten im Frankfurter Bankenviertel. Ein Spitzenbanker ist tot. Ein Beben wie in der grossen Finanzkrise reißt die Börsen in den Abgrund. Terror? Oder steckt ein perfider Plan dahinter? Hauptkommissarin Chris Roberts vom BKA stürzt sich ins Chaos. Sie sucht nach einem Täter, findet aber eine geopolitische Verschwörung. Zu spät erkennt sie, dass der Anschlag nur der Anfang war. Die Jagd nach den Strippenziehern führt Chris von den sterilen Vorstandsetagen Frankfurts direkt ins Pulverfass des Nahen Ostens. Eine mörderische Jagd beginnt – und Chris läuft die Zeit davon. Der 17. Fall mit BKA-Kommissarin Chris
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
EPIZENTRUM
THRILLER
HANSJÖRG ANDEREGG
INHALT
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Über den Autor
Bücher von Hansjörg Anderegg
EINLEITUNG
Die Wahrheit ist tödlicher als jede Krise.
Schüsse mitten im Frankfurter Bankenviertel. Ein Spitzenbanker ist tot. Ein Beben wie in der grossen Finanzkrise reißt die Börsen in den Abgrund. Terror? Oder steckt ein perfider Plan dahinter?
Hauptkommissarin Chris Roberts vom BKA stürzt sich ins Chaos. Sie sucht nach einem Täter, findet aber eine geopolitische Verschwörung. Zu spät erkennt sie, dass der Anschlag nur der Anfang war.
Die Jagd nach den Strippenziehern führt Chris von den sterilen Vorstandsetagen Frankfurts direkt ins Pulverfass des Nahen Ostens. Eine mörderische Jagd beginnt – und Chris läuft die Zeit davon.
Der 17. Fall mit BKA-Kommissarin Chris
Texte: © Copyright 2025 Hansjörg Anderegg
Umschlag: © Copyright by hjanderegg, created with bing.com
Verlag: Hansjörg Anderegg
Druck: epubli.com und neobooks.com
Printed in Germany
All rights reserved
Alle Personen und Namen in diesem Roman sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Formatiert mit Vellum
1
FRANKFURT
Der Kopf im Fadenkreuz bewegte sich keinen Millimeter, als zielte der Schütze auf ein Foto an der Wand. Ein gutes Gefühl, er war jetzt am Drücker. Die Waffe fühlte sich leicht an in seinen Händen nach all den Jahren. Der Banker Kramer saß an seinem Schreibtisch im sechsten Stock des Turms aus Glas, Stahl und Beton, keine zweihundert Meter entfernt. Wie ein König wartete der junge Schnösel mit verschränkten Armen lässig zurückgelehnt auf die nächste Kundin. Oder das nächste Opfer, dachte der Mann am Zielfernrohr verbittert. Der Schütze schloss kurz die Augen, um sich zu konzentrieren. Es eilte nicht. Kramer würde noch mindestens eine Stunde im Büro verbringen bis zur Rauchpause. Der Schütze atmete bewusst und ruhig, wie er es vor langer Zeit gelernt hatte. Ohne das leiseste Zittern hielt er die Waffe aufs Ziel gerichtet, mühelos wie damals beim Training. Er fühlte sich stark wie lang nicht mehr, hatte alles unter Kontrolle. Er bestimmte, wann Schluss war. Seelenruhig wartete er, bis Kramer aufstand und ans Fenster trat, wie nach jeder Besprechung. Der Schütze atmete aus und hielt den Atem an.
Intern nannte man die sechste Etage der World Partners Bank die Notenpresse. Die Zinsmargen bei Krediten für Unternehmen sorgten für einen zuverlässigen, seit Jahren stetig wachsenden Einnahmenüberschuss, als würden sie Geld drucken. Dutzende Kreditspezialisten wie Kramer sorgten dafür, dass es kaum Ausfälle gab. Sie alle waren darin geschult, die Kreditwürdigkeit von Kunden zu riechen, bevor sie das Schufa-Dossier öffneten. Kramer grinste zufrieden beim Gedanken daran. Er war der unangefochtene König auf dieser Etage, obwohl er das Büro mit dem bequemen Ledersessel und dem edlen Chefschreibtisch vom italienischen Designer erst vor drei Jahren bezogen hatte. Er sorgte für nachhaltige Profite bei bescheidenem Risiko, ganz anders als die Spieler im Casino zwei Stockwerke über ihm. Bezüglich Risikomanagement könnten die sich bei ihm eine Scheibe abschneiden, war er überzeugt.
Der Blick aus dem Fenster auf die belebte Straße hinunter hob seine Stimmung jedes Mal. Hoch über den Ameisen dort unten fühlte er sich allen und allem überlegen.
Es klopfte. Die nächste Kundin war da, ein problemloser Fall. Zehn Minuten, mehr würde er nicht brauchen, um der Erbin der kleinen Schreinerei die neuen Konditionen zu erklären. Er hatte ihre Unterschrift praktisch schon in der Tasche.
»Herein!«, rief er und wandte sich um.
Die Frau stand noch unter der Tür, als das Geschoss die Scheibe mit einem dumpfen Knall durchschlug, sein Herz durchbohrte und im Aktenschrank an der gegenüberliegenden Wand stecken blieb. Der König der Kreditabteilung kippte lautlos vornüber, der Frau vor die Füße. Sie begann erst zu schreien, als sich in der Fensterscheibe krachend Risse ausbreiteten. Finger aus Blut krochen unter dem Leichnam hervor, dehnten sich rasch aus und tasteten nach den schwarzen Lackschuhen der Besucherin. Unfähig, sich zu bewegen, begann sie lauter zu schreien, als könnte sie so Kramers Blut aufhalten.
Leute stürzten aus den Büros und rannten durch den Flur auf die schreiende Frau zu. Weitere Schüsse schlugen ein wie Hammerschläge, die den Nagel verfehlten, kaum zu hören im Lärm der Schreie und Ausrufe entsetzter Angestellter und Besucherinnen. Glas splitterte hinter verschlossenen Türen. Eine junge Frau eilte als Letzte herbei und begriff als Erste, was im Gange war. Telefon am Ohr forderte sie lautstark dazu auf, die Etage zu räumen.
»Jemand schießt auf uns!«, rief sie in die Menge und wiederholte die Warnung, bis alle verstanden hatten.
Zwei Frauen aus dem Sekretariat am Ende des Flurs versuchten, die schreiende Kundin zu beruhigen, griffen ihr beherzt unter die Arme und schleppten sie zum Treppenhaus. Dann endeten die Hammerschläge. Der sechste Stock der World Partners Bank glich dem Innern eines Geisterhauses auf einem Übungsgelände.
Oberkommissar Günther Prinz kniff die Augen zu, als er an der Fassade der WPB an der Grenze zum verrufenen Bahnhofsviertel hochblickte.
»Siehst du irgendwelche Löcher?«, fragte er seine Partnerin Miri.
Miri hörte ihm nicht zu. Sie wandte sich an den Leiter des Spezialeinsatzkommandos, der eben aus dem Haus trat.
»Wie sieht’s aus?«
»Nicht gut«, antwortete der Mann stirnrunzelnd. »Elf Einschüsse in sieben Büros, sechste Etage Nordseite. Ein Angestellter stand wohl am Fenster. Das Projektil traf ihn mitten ins Herz.«
»Gibt es weitere Opfer?«, fragte Prinz, weniger gelangweilt.
»Drei Streifschüsse, nichts Gravierendes. Wir ziehen jetzt ab. Ihr Spielplatz.«
Die Bemerkung fachte den Widerstand des Kommissars an.
»Was heißt abziehen?«, entgegnete er aufgebracht. »Interessiert sie der Schütze gar nicht? Woher kamen die Schüsse? Doch nicht aus einem Helikopter oder von einer verdammten Drohne?«
Der Einsatzleiter ließ sich nicht provozieren. Ruhig antwortete er:
»Letztlich kann nur die KT mit Sicherheit sagen, woher die Schüsse kamen. Es sieht allerdings ganz danach aus, dass der Schütze vom Dach des gegenüberliegenden Altbaus geschossen hat. Unsere Leute sind noch dabei, das Haus zu durchsuchen. Bisher gibt es keinen Hinweis auf den Schützen.«
Damit ließ er sie stehen. Die Männer des SEK zogen ab, als der Rechtsmediziner eintraf, Gerätewagen der Kriminaltechnik im Schlepptau.
»Ein Terroranschlag? Was meinst du?«, fragte Miri, während sie sich mit dem Arzt einen Weg durch die verängstigten Angestellten auf dem Platz vor der Bank bahnten.
»Terror«, spuckte Prinz verächtlich aus. »Ein Irrer war das, jede Wette.«
Ein älterer, weißhaariger Herr in grauem Anzug mit Weste, wo nur die goldene Taschenuhr fehlte, empfing sie bei der Leiche.
»Wer sind Sie?«, fragte Prinz ungehalten. »Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Das ist ein Tatort.«
Der Herr stand offensichtlich unter Schock.
»Wer tut so was?«, fragte er, ohne den Blick vom Toten zu wenden.
Miri versuchte es etwas sanfter als ihr Kollege:
»Wer sind Sie?«
Der Mann blickte sie verstört an. »Schrader«, murmelte er, »Martin Schrader.« Nach kurzer Pause fügte er wie eine Entschuldigung an: »Ich war in einer Sitzung oben im zehnten, als die …«
Seine Stimme versagte den Dienst. Während der Rechtsmediziner den Leichnam untersuchte und Prinz ihm zusah, nahm sie den Herrn beiseite und fragte weiter.
»Kennen Sie das Opfer?«
»Ja, natürlich, das ist – war mein bester Sachbearbeiter. Kramer heißt er. Ich bin der Chef dieser Abteilung.«
Sie versuchte, mehr über den verstorbenen Sachbearbeiter Kramer zu erfahren, doch dessen Chef stand neben sich. Nachdem sie seine Personalien notiert hatte, übergab sie ihn der Obhut einer uniformierten Kollegin. Der Arzt beendete die Leichenschau und erhob sich.
»Todesursache ist, wie man sieht, ein Schuss mitten durchs Herz«, sagte er. »Der Mann war sofort tot.«
»Der Präzisionsschuss eines Scharfschützen?«, fragte sie.
»Oder ein Zufallstreffer«, warf die Kriminaltechnikerin ein, die gerade das Projektil aus der Wand herauslöste. »Kaliber 7,62, Sturmgewehrmunition, nichts Besonderes.«
Prinz räusperte sich verächtlich. »Sage ich doch, ein Spinner!«
»Da bin ich nicht so sicher«, widersprach Miri. »Warum hat der Schütze hier präzise getroffen und in den andern Büros mehr oder weniger bloß Sachschaden angerichtet?«
Prinz antwortete nicht darauf, aber sie wusste, dass es hinter seiner Stirn genauso heftig arbeitete wie bei ihr.
»Wissen wir, wo der erste Schuss fiel?«, fragte sie.
Die Kollegin von der Kriminaltechnik schüttelte den Kopf. Prinz warf Miri einen anerkennenden Blick zu. Er hatte verstanden, dass das die alles entscheidende Frage war. Vielleicht würden die Aufzeichnungen der Überwachungskameras Klarheit schaffen. Sie glaubte allerdings nicht daran.
Der Rechtsmediziner verabschiedete sich stumm, und sie sahen sich die anderen betroffenen Büros an. Am Ende herrschte weiterhin Unklarheit über das Motiv des Täters. Es gab Hinweise, die auf einen gezielten Anschlag auf den Sachbearbeiter Kramer deuteten. Ebenso viele sprachen dagegen.
»Wir sollten uns auf dem Haus gegenüber umsehen«, schlug Prinz vor.
Die Straße auf der Nordseite trennte zwei Welten. Eine Häuserzeile wie eine historische Filmkulisse stand dem futuristischen Turm der Bank gegenüber. Die alten fünf- und sechsstöckigen Gebäude aus Backstein hatten schon bessere Zeiten gesehen. Teilweise fehlten die Fensterläden, andere blieben auch tagsüber geschlossen.
Die letzte Gruppe des Einsatzkommandos verließ das Haus, von dessen Dach aus wahrscheinlich geschossen worden war, als sie die Straße überquerten. Der Anführer des Teams schüttelte nur den Kopf im Vorbeigehen.
»Da hat sich einer in Luft aufgelöst«, brummte Prinz verdrießlich.
Miri fragte sich, ob ihre Annahme über die Position des Schützen überhaupt stimmte. Hatte er womöglich aus einem Fenster geschossen? Nachdenklich stieg sie mit dem Kollegen die enge Holztreppe hinauf, die bei jedem Schritt unter ihren Füßen ächzte. Zwei Mitarbeiterinnen der KT waren dabei, die Dachterrasse nach Spuren zu untersuchen. Miri fragte nach dem Stand der Ermittlungen. Eine Kollegin im Schutzanzug zeigte auf die mit gelbem Nummernschild markierte Stelle am Rand der Terrasse.
»Der Täter hat von dort aus geschossen. Der Diphenylamin-Test zeigt eine eindeutige Verfärbung. Wir werden Bodenproben im Labor genauer untersuchen, aber der Test weist die Schmauchspuren sicher nach. Patronenhülsen haben wir allerdings keine gefunden.«
Miri trat an den Rand der Terrasse. Der Schütze hatte die ideale Position gewählt. Von hier aus gab es ein freies Schussfeld über die gesamte Breite der sechsten Etage gegenüber. Ihr Kollege wartete im Hintergrund nahe beim Treppenabgang.
»Nicht schwindelfrei?«, fragte sie, nur um ihn wachzurütteln.
Er war wach, denn er hatte etwas bemerkt, was ihr entgangen war.
»Unten neben dem Eingang gibt es eine Kamera«, sagte er, »beim Pfandleiher.«
Wenig später staunte sie. Die Kamera über der Tür des kleinen Ladens war tatsächlich in Betrieb und zeichnete alle Bewegungen vor dem Laden und am Hauseingang auf. Viele waren es nicht. Sie benötigten trotzdem eine geschlagene Stunde, um die Aufzeichnungen zusammen mit dem Ladenbesitzer zu sichten.
»Alles Hausbewohner, sind Sie sicher?«, fragte sie am Ende noch einmal.
»Sagte ich doch«, antwortete der Ladenbesitzer ohne Zögern.
Seit dem frühen Morgen hatten fünf Leute das Haus verlassen, drei waren eingetreten, Männer und Frauen, die hier wohnten. Eine Waffe oder auch nur ein Paket war nicht zu sehen.
»Fehlanzeige«, fasste Prinz zusammen.
Sie blickte nachdenklich ins Leere, sagte dann entschlossen:
»Wir müssen noch einmal aufs Dach.«
Prinz protestierte und blieb stehen, als sie den Laden verließ. Oben bestätigte sich der Verdacht. Selbst ihr Kollege mit Höhenangst könnte problemlos von der Dachterrasse zur Luke auf dem Dach des Nachbarhauses gelangen. Die Damen der Kriminaltechnik waren zu früh abgezogen. Die Luke ließ sich leicht öffnen. Sie stieg in die Dachkammer hinunter, von der eine unverschlossene Holztür ins Treppenhaus führte. Das ganze Haus roch penetrant nach Knoblauch. Zwei Stufen aufs Mal nehmend rannte sie hinunter. Im Flur beim Hauseingang stoppte sie der Ruf des Kollegen hinter ihr. Sie fuhr herum und keuchte:
»Woher kommst du denn?«
»Das wollte ich dich gerade fragen.«
Sie traten ins Freie, und sie atmete durch.
»Der Täter muss durch dieses Haus auf die Dachterrasse gelangt sein«, behauptete sie.
Er nickte zustimmend. »Offensichtlich, und abgehauen ist er durch die Hintertür. Die führt auf einen Hof, von dem aus man auf zwei Gassen gelangt. Kameras kannst du dort vergessen.«
Spätabends standen sie im Büro des Polizeipräsidiums vor der Pinnwand. Man hatte ihnen einen Raum in der nordwestlichen Ecke des Betonkolosses an der Adickesallee zugewiesen. Ihr normaler Arbeitsplatz befand sich im Landeskriminalamt in Wiesbaden, zu weit weg vom Geschehen. Die Kollegen der Landespolizei hatten nichts gegen die Verstärkung aus dem LKA, wie es schien. Sie waren allerdings auch keine große Hilfe, hatten genug andere Aufgaben. Für Miri war das O. K., für Prinz sowieso. Er hätte den Fall am liebsten allein gelöst, vor allem ohne Staatsanwaltschaft.
»Was bildet die Kuh sich eigentlich ein?«, zischte er wütend, kaum war die Staatsanwältin außer Hörweite. »Zu behaupten, wir hätten nichts Konkretes in der Hand, eine verdammte Frechheit.«
Miri konnte die Frau auch nicht leiden, musste ihr aber zustimmen. Die paar Fotos und Notizen an der Wand beschrieben zwar die Opfer des Anschlags auf die WPB und den Sachschaden, aber Hinweise auf den Täter gab es so gut wie keine.
»Du musst aber zugeben …«, begann sie.
Prinz fiel ihr sofort ins Wort. »Ja, wir tappen im Dunkeln, sie hat recht. Das macht sie kein bisschen sympathischer.«
»Stimmt auch wieder«, lächelte sie verkrampft. »Wir wissen noch nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau oder ein Einzeltäter war.«
Prinz griff zum Telefon. »Warum braucht die KT eine Ewigkeit, um die paar Proben vom Dach zu untersuchen?«, schnaubte er abfällig, während er auf ein Lebenszeichen am andern Ende der Leitung wartete.
Die Verbindung kam zustande, und er schaltete den Lautsprecher ein.
»Sie sind also noch da«, sagte die Kollegin von der Kriminaltechnik. »Zu Ihnen wollte ich gerade.«
»Klar sind wir noch da, was glauben Sie denn?«, brauste Prinz auf.
Miri warf ihm einen warnenden Blick zu und fragte:
»Gibt es einen Treffer mit der DNA vom Dach?«
»Das leider nicht, aber wir können jetzt von einem Einzeltäter ausgehen. Männlich, zwischen 40 und 50, kaukasischer Typ.«
»Ein Weisser wie ich«, brummte Prinz.
»Ihre DNA hatten wir leider nicht zur Verfügung für einen Abgleich«, quittierte die Technikerin am andern Ende seinen Griesgram augenblicklich.
»Das saß«, lachte Miri. Sie staunte über die Angaben der Kollegin und fragte nach. »Wie könnt ihr sicher sein, dass es ein Einzeltäter war?«
»Sicher ist ein großes Wort, aber wir können zu neunzig Prozent davon ausgehen. Der Täter hat sich in der Dachluke an einer vorstehenden Schraube verletzt. Es gibt noch andere DNA, aber nur das Blut an der Schraube ist frisch. Die Probe ist noch keinen Tag alt.«
»Fantastisch«, freute sie sich. »Das hilft uns weiter. Gute Arbeit, vielen Dank.«
Prinz war noch nicht zufrieden und wollte wissen, ob das alles war.
»Es gibt da noch etwas«, überraschte sie die Technikerin. »Die Rückstände am Ort der Schussabgabe lassen darauf schließen, dass der Täter Munition aus alten Beständen der Bundeswehr verwendet hat.«
»Was heißt das genau?«
»Steht im Bericht, aber ich lese es Ihnen gerne vor. Es handelt sich um die alte NATO-Munition G3 für das gleichnamige Sturmgewehr, Kaliber 7,62 x 51 mm.«
Die Pinnwand enthielt nun doch einige spezifische Informationen über den Täter. Ein weißer Mann mittleren Alters hatte mit einem ausgemusterten Sturmgewehr der Bundeswehr geschossen.
»Wenn wir jetzt noch wüssten, weshalb er geschossen hat«, sinnierte sie, »dann wären wir wirklich einen Schritt weiter.«
Prinz mochte nicht widersprechen. Sie hatten zusammen begonnen, Kramers Kundendossiers nach möglichen Verdächtigen zu durchsuchen. Weit waren sie nicht gekommen, da sich der Untersuchungsrichter lange geweigert hatte, den entsprechenden Beschluss zu unterschreiben. Bisher war ihr nur etwas aufgefallen. Es gab keine Hinweise auf abgelehnte Kreditanträge in Kramers Unterlagen. Alle Geschäfte waren problemlos abgewickelt worden, kein Kunde in Verzug mit Zahlungen. Sie kehrte an ihren Schreibtisch zurück, um weiterzusuchen. Nach einer Weile bemerkte sie, dass ihr Kollege nur auf sein Handy starrte.
»Tinder?«, provozierte sie ihn.
Er murmelte etwas, das sie nicht verstand, ohne aufzublicken. Sie trat zu ihm, sah ihm über die Schulter und staunte.
»Was ist das?«
Die Frage weckte sein Interesse. »Telegram«, erklärte er, »ein Messenger, den Extremisten und Verschwörungstheoretiker gerne benutzen.«
Sie lächelte. »Du glaubst also nicht an einen Racheakt am Kreditsachbearbeiter.«
Er zuckte die Achseln. »Ich möchte mich einfach nicht zu früh festlegen. Wie es aussieht, können wir noch stundenlang in Kramers Akten wühlen, ohne etwas zu finden.«
»Du treibst dich stattdessen in rechtsextremen Chatgruppen herum.«
Jetzt grinste er und korrigierte: »Links. Banken zu zerdeppern ist eher eine linke Spezialität. Kapitalismus abschaffen, so etwas.«
Da lag er wohl nicht ganz falsch. Sie musste zugeben, sich allzu einseitig auf das Todesopfer konzentriert zu haben.
»Und was sagt uns dieses Telegram mit einem M?«
Er hatte einen Hinweis entdeckt und erläuterte seinen Verdacht. Sie zog einen Stuhl heran und setzte sich zu ihm. Eine Nachricht auf dem kleinen Bildschirm des Smartphones war ihm aufgefallen. Der Tag ist gekommen, Freunde, stand da, und nieder mit den Kapitalisten-Schweinen! Das ist erst der Anfang. An die Waffen, Brüder und Schwestern!
So krass der Aufruf zur Gewalt daherkam, er überzeugte sie nicht.
»Glaubst du, diese Tirade hat etwas mit unserem Fall zu tun?«
Er nickte überzeugt. »Sieh dir Datum und Zeit des Posts an und den Eintrag vom selben Benutzer weiter oben.«
Beide Nachrichten stammten von einem gewissen Molotow77, und der erste Post bezog sich eindeutig auf das, was am Morgen in der World Partners Bank passiert war. Molotow77 lud alle Brüder und Schwestern ein, sein Werk dort zu bewundern. Worte nützen nichts, meinte der Benutzer mit dem aggressiven Pseudonym. Jetzt schreiten wir zu Taten.
»Bedenklich«, fasste sie zusammen.
Er nickte. »Jetzt fehlt uns nur noch der Name und die Adresse dieses Kerls.«
»Wer betreibt Telegram?«
Er seufzte. »Das ist das Problem. Die Software stammt aus Russland, aber betrieben wird die Plattform von einer Gruppe in den Vereinigten Arabischen Emiraten, soweit ich mich erinnere.«
Sie stöhnte innerlich auf. Unter diesen Umständen konnten sie keine Auskunft von den Betreibern erwarten, richterliche Anordnung hin oder her.
»Kann man etwas über den Netzbetreiber erfahren?«, fragte sie ohne große Hoffnung.
Er schüttelte stumm den Kopf.
»Vielleicht gibt es noch andere Hinweise in der Chatgruppe«, schlug sie vor.
Er hatte sicher schon daran gedacht, vertiefte sich trotzdem wieder in die Arbeit am Handy. Sie kehrte zu Kramers Akten zurück, konnte sich aber nicht darauf konzentrieren.
»Sagt dir das Pseudonym KRA etwas, oder KOLK?«, fragte er unvermittelt.
»Sagt mir nichts.« Seltsame Pseudonyme, dachte sie, Krähe, Kolkrabe. »Doch!«, rief sie aus. »Die Raben, das könnten die Raben sein.«
»Die beiden scheinen Molotow gut zu kennen. Was hat es mit den Raben auf sich?«
Sie erinnerte sich nur schwach an zwei Geschwister, mit denen sie vor Jahren beim Diebstahl zu tun gehabt hatte.
»Das war ganz am Anfang meiner Karriere«, begann sie.
»Im letzten Jahrhundert«, musste Prinz unbedingt betonen.
»Richtig, damals erwischten wir zwei Geschwister, die alle nur die Raben nannten. Elstern hätte besser gepasst, denn sie stahlen, was immer ihnen in die Finger kam, vertickten es und finanzierten so ihren Drogenkonsum. Wiederholungstäter, unverbesserlich, schrecklich. Sie saßen ein oder zwei Jahre im Jugendknast und im Entzug.«
»Dann gibt es vielleicht Fingerabdrücke und DNA im System«, vermutete Prinz.
»DNA wird es nicht geben«, widersprach sie, »heikel bei Jugendstrafen.«
»Darum auch kein Match in der Datenbank.«
»Aber die Namen und die damalige Adresse sind im System.«
Es war eine solide Spur, die sie verfolgen konnten. Zwei Stunden später, nach vielen Telefonanrufen, wussten sie, dass die beiden immer noch in Frankfurt lebten. Miri gähnte und streckte die Glieder.
»Die knöpfen wir uns morgen vor«, entschied sie.
Ohne Verstärkung von der Landespolizei würde es sowieso nicht gehen. Das Licht im Großraumbüro war längst erloschen. Prinz sprang auf, als hätte er nur auf ihr Signal gewartet.
»Genug ist genug«, sagte er und verabschiedete sich mit dem üblichen stummen Pfadfindergruß.
Am frühen Morgen fuhren sie mit zwei Streifenwagen beim Nachtclub im Bahnhofsviertel vor. Die Raben wohnten im ersten Stock über dem Lokal.
»Ich gehe mal um den Block«, sagte Prinz. »Vielleicht gibt es einen Hinterausgang.«
»Gute Idee«, murmelte sie und betrat das Haus mit zwei Beamten.
Eine Hand am Griff der Waffe drückte sie auf die Klingel. Der Knopf fiel heraus. Kein Klingelton war zu hören. Was hatte sie erwartet im Haus, dessen Fassade schon nach Abbruch aussah? Sie klopfte laut an die Tür und rief den Namen des offiziell gemeldeten Mieters, den sie hinter dem Pseudonym Kolk vermutete. Das dünne Holz und der Spalt unter der Tür, wo die Schwelle fehlte, ließen jedes Geräusch durch. Schlurfende Schritte näherten sich.
»Wer stört?«, fragte eine verschlafene Männerstimme.
»Polizei, wir müssen mit Ihnen sprechen.«
Stille folgte, als hielte das ganze Haus den Atem an. Miri trat geräuschlos zur Seite und bedeutete den Beamten, vorsichtig Abstand von der Tür zu halten. Sie traute den Raben zu, wahllos abzudrücken. Es blieb ein paar Sekunden still in der Wohnung. Dann hörte sie ein Geräusch, mit dem sie nicht rechnete.
»Der haut ab durch ein Fenster!«, rief sie und versetzte gleichzeitig der Tür einen kräftigen Fußtritt.
Augenblicke später stand sie in einem mit leeren Bierflaschen und Pizzaschachteln zugemüllten Wohnzimmer. Das Fenster zur Seitengasse stand offen.
»Halt, Polizei!«, rief sie hinaus.
Der flüchtige Kolkrabe sprang unten auf ein Moped, kickte es an und fuhr ab, als ein Kollege aus dem zweiten Streifenwagen um die Ecke bog. Er fluchte, rannte zurück, sie fluchte und rief Prinz an. Ihr Partner befand sich hinter dem Haus und reagierte zu spät, wie sie alle.
Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, während sie im Dienstwagen auf Prinz wartete.
»Kolk ist uns entwischt«, sagte sie, als er sich auf den Beifahrersitz fallen ließ.
»Und wo ist Kra?«, fragte er.
»Keine Ahnung, vielleicht liegt sie zugedröhnt unter den Pizzakartons. Die Wohnung ist eine Müllhalde. Zwei Kollegen von der Streife durchsuchen sie gerade.«
»Viel Spaß dabei«, brummte Prinz angewidert.
Sie hörten im Polizeifunk, wie die Kollegen Verstärkung anforderten.
»Folgen auf der Kaiserstraße Richtung Osten«, meldete die Stimme im Lautsprecher, und kurz danach: »Verdächtiger biegt rechts in Elbstraße ab. Einbahnstraße. Falsche Richtung.«
»Wenn der so weitermacht, bringt er sich um«, kommentierte Prinz stirnrunzelnd.
»Untermainkai Richtung Friedensbrücke«, quäkte der Lautsprecher.
Sie fuhr los. Auf der kurzen Strecke zum Main jagten sich die Durchsagen im Polizeifunk. Die Lage war verworren. Fahrzeuge stauten sich bis weit vor die Brücke. Bevor sie verstanden, was geschehen war, bahnte sich ein RTW mit Blaulicht und Sirene einen Weg durch die Rettungsgasse.
»Der Verdächtige liegt am Boden«, meldete ein Kollege aus dem Streifenwagen. »Zusammenstoss mit Kombi beim Versuch, den Baseler Platz zu überqueren.«
Prinz schüttelte den Kopf. »Den scheiß Platz kann man so gar nicht überqueren.«
Miri fragte über Funk, während sie im Stau standen:
»Lebt er?«
»Scheint so. Die Sanitäter schieben ihn gerade in den RTW.«
Sie atmete auf. Um ein Haar wäre die einzige vielversprechende Spur buchstäblich erkaltet.
Kolk lag schon auf der Krankenstation, als sie im BG Unfallklinikum an der Friedberger Landstraße im Norden der Stadt eintrafen. Ein Bein und einen Arm im Gips, starrte er an die Decke, hellwach und mit einem Gesicht, als hätte er mit allem abgeschlossen. Sie trat ans Bett, öffnete den Mund, und er sagte, ohne sie anzusehen:
»Bullen, mit euch rede ich nicht.«
»Ein Hellseher«, sagte sie zu Prinz.
Lächelnd hielt sie Kolk den Dienstausweis vor die Nase und fragte:
»Wie geht es Ihnen?«
Prinz verfolgte den fruchtlosen Versuch, Kontakt aufzunehmen, mit zunehmender Ungeduld.
»Kein Grund, vor uns auszureißen, Herr Berger«, sagte Miri, »oder soll ich Sie Kolk nennen? Wir möchten Ihnen nur ein paar Fragen stellen.«
Der Mann im Krankenbett schien nicht überrascht, mit dem Pseudonym angesprochen zu werden. Sie deutete das als Bestätigung, dass der ehemalige Rabe mit bürgerlichem Namen Berger tatsächlich unter dem Pseudonym Kolk linken Unsinn verbreitete.
»Du hasst Bullen«, fuhr Prinz dazwischen. »Das verstehe ich. An deiner Stelle würde ich Bullen auch hassen.«
Miri warf ihrem Partner den Worauf-willst-du-hinaus-Blick zu, doch er fuhr ungerührt weiter:
»Schließlich hast du einiges zu verlieren. Hättest du uns die paar Fragen einfach beantwortet, müssten unsere Kollegen jetzt deinen Saustall zu Hause nicht auseinandernehmen. Dann hätten sie auch das Crack nicht gefunden, und du würdest nicht hier liegen.«
Gute Argumente, musste sie zugeben. Sie wartete mit Prinz auf eine Antwort. Die Kollegen hatten tatsächlich eine kleine Menge Drogen gefunden im Durcheinander seiner Wohnung, allerdings nicht genug, um ihm ein Verfahren wegen Drogenhandels anzuhängen. Eine Waffe war bisher nicht aufgetaucht, und von seiner Schwester Kra fehlte nach wie vor jede Spur. Sie bewegten sich also auf dünnem Eis, aber das wusste Berger alias Kolk nicht. Sie sah ihm die Verunsicherung an und versuchte den Trick, der schon vor Jahren beim Diebstahl gut funktioniert hatte. Da er nicht antwortete, sagte sie:
»Das Dope interessiert uns im Grunde nicht. Wir möchten bloß wissen, wo wir Molotow77 finden.«
Es blitzte auf in seinen Augen. Er kannte Molotow77. Sie waren auf der richtigen Fährte, aber er schwieg auch jetzt. Prinz trieb das Spiel weiter.
»Wenn du uns sagst, wo wir deinen Kumpel finden, könnten unsere Kollegen vielleicht so tun, als hätten sie das Crack gar nicht gesehen. Was sagst du?«
»Alles schon vorgekommen«, pflichtete sie Prinz bei.
Als einschlägig Vorbestrafter wusste Kolk genau, was ihm blühte mit dem Crack und vielleicht noch anderen Substanzen in seiner Wohnung. Er knickte ein und verriet ihnen den Namen, der sich hinter Molotow verbarg. Beim Gesuchten handelte es sich um einen gewissen Ulf Schreiber.
»Und wo finden wir deinen Freund Ulf?«, fragte Prinz.
»Er ist nicht mein Freund.«
Beide blickten ihn nur fragend an. Nach einer Weile kapierte er, was es bedeutete, und sagte ungehalten:
»Keine Ahnung.«
»Verarschen lassen wir uns nicht!«, fuhr Miri ihn scharf an, dass er erschrak.
»Ich – weiß es wirklich nicht«, stammelte er. »Wir treffen uns manchmal im Eck.«
»Toll, von welcher Ecke sprichst du?«, fragte Prinz.
»Das ist eine Kneipe.«
Sie notierte sich die Adresse und verabschiedete sich mit den besten Wünschen für die Genesung. Zurück im Dienstwagen rief Miri im Präsidium an und verlangte Auskunft über den gesuchten Ulf Schreiber. Die Antwort traf prompt ein. Ulf Schreiber, 43, war noch in der Wohnung seiner Mutter gemeldet, die jedoch vor anderthalb Jahren gestorben war. Eine andere Familie lebte jetzt in der Wohnung. Es gab wenigstens ein mehr oder weniger aktuelles Foto. Jemand hatte Ulf Schreiber nach einer Kneipenschlägerei wegen Körperverletzung angezeigt. Der Gesuchte hatte aber nicht gesessen. Prinz reagierte enttäuscht auf die Nachricht. Sie wusste, weshalb. Dieser Verdächtige erschien ihr wie ein armes Würstchen.
»Der soll ein kaltblütiger Killer sein?«, sprach Prinz aus, was sie dachte.
Die Kneipe öffnete erst am Nachmittag. Miri nutzte die Zeit, um noch einmal in den Akten des erschossenen Kreditsachbearbeiters Kramer nach unzufriedenen Kunden zu suchen. Prinz blieb an den Raben dran und studierte den Bericht der Spurensicherung. Die KT hatte Kolks Wohnung nach der Streife gründlich durchsucht. Es gab keinen Hinweis auf eine Waffe, aber Prinz ließ nicht locker.
»Wir müssen diesen Molotow unbedingt auftreiben, bevor Kolk ihn warnen kann«, knurrte er.
»Der hat keinen Zugriff auf ein Telefon, solange er ans Bett gefesselt ist«, erinnerte sie ihn.
»Wie lange noch?«
Kurz nach dem Mittagessen in der Kantine drängte er zum Aufbruch. Sie fuhren zu zweit ohne Begleitung uniformierter Kollegen zur Adresse, die Kolk angegeben hatte. Eine Ecke des alten Wohnblocks im Westend bildete den Eingang des Eck. Sie parkte in der Nähe am Straßenrand, wo sie die Kneipe im Blick hatten.
»Gehen wir rein«, drängte Prinz, nachdem lange Zeit niemand ein- oder ausgetreten war.
»Noch eine halbe Stunde«, entschied sie aus einem Bauchgefühl heraus.
Er stellte den Timer auf seiner Smartwatch. Kurz danach belebte sich die Strasse. Ein Spaziergänger mit Hund betrat das Eck. Zwei ältere Damen folgten nur Minuten später, in ein Gespräch vertieft. Lachend traten sie ein. Prinz prüfte ungeduldig seinen Timer. Ein Radler fuhr an ihnen vorbei, hielt bei der Kneipe an, schloss das Rad ab, schaute sich kurz um und trat ebenfalls ein. Er trug einen Rucksack. Sein langes, dunkelblondes Haar entsprach genau dem Foto in der Akte Ulf Schreiber.
»Das könnte er sein«, rief sie wie elektrisiert.
Sie eilten zur Kneipe.
»Ich gehe rein«, sagte sie. »Du wartest am besten draußen, falls er abhaut.«
Der Vorschlag gefiel ihm nicht, aber er verstand die Logik. Sie trat ein und schaute sich um. Die hagere Wirtin hinter dem Tresen verfügte wie Kolk über hellseherische Fähigkeiten. Die Frau erkannte die Polizistin trotz der Zivilkleider augenblicklich. Sie ließ den Zapfhahn los, klatschte den halb vollen Bierkrug auf den Tresen und gab dem Langhaarigen ein stummes Zeichen mit dem Kopf. Der Mann, den Miri sofort als Ulf Schreiber identifizierte, sprang auf, rannte wie vom Leibhaftigen gehetzt an ihr vorbei und zur Tür hinaus, bevor sie Prinz warnen konnte. Ihr Partner war besser vorbereitet. Sie hörte, wie der Flüchtige stürzte, aufschrie und fluchte. Dann fiel die Tür hinter ihm zu.
Miri ließ den Blick durchs Lokal schweifen, breitete die Arme als stumme Entschuldigung aus und verließ das Eck ebenfalls. Ulf Schreiber lag bäuchlings auf dem Kies am Fuß der Treppe, die Hände in Handschellen auf dem Rücken. Prinz stand grinsend daneben mit dem Rucksack in der Hand.
»Keine Waffe«, sagte er.
»Gute Arbeit, Partner«, lachte sie.
Sie saßen schon wieder im Dienstwagen, der Gefangene auf dem Rücksitz, als die Wirtin wagte, den Kopf durch den Türspalt am Eck zu stecken.
»Und mein Rad?«, fragte Schreiber alias Molotow77.
Ausser mit ein paar Schürfungen hatte er sich beim Sturz nicht verletzt. Sie brauchten ihn nicht mit Samthandschuhen anzufassen.
»Das Rad ist gerade dein geringstes Problem«, versicherte Prinz.
»Warum führen Sie mich ab? Das ist illegal.«
Prinz drehte sich verärgert zu ihm um. »Ich sage dir, was illegal ist«, fuhr er ihn an. »Leute erschießen ist illegal.«
Wenig später, sie saßen noch keine Viertelstunde im Vernehmungszimmer, als sie die Staatsanwältin herausholte.
»Wiesbaden«, verkündete sie mit steinerner Miene und deutete auf den Fernseher an der Wand, wo der Nachrichtensender lief.
WIESBADEN
»Sieht gar nicht gut aus«, murmelte Miri.
Sie liess das Seitenfenster des Dienstwagens herunter und zeigte dem Beamten den Ausweis. Der Mann nickte und hielt das blau-weiße Band hoch, damit sie auf den Parkplatz fahren konnten.
»Auch für uns nicht«, brummte Prinz zerknirscht auf dem Beifahrersitz.
Immerhin handelte es sich beim zweiten Tatort um den Platz vor dem hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz. Das grosse Besteck war aufgefahren, der Parkplatz abgesperrt, das Ministerium versiegelt. Niemand sollte es verlassen oder betreten. Mitarbeiterinnen der Spurensicherung waren am Werk. Sie stießen spät dazu. Das Opfer befand sich bereits auf dem Weg in die Rechtsmedizin, doch der Arzt war noch da. Er unterhielt sich mit einer Kollegin aus dem LKA. Beide standen nur ein paar Schritte von der Kreidezeichnung entfernt, welche den Umriss des Opfers am Boden markierte. Eine Blutlache befand sich dort, wo die Brust gelegen hatte. Miri schauderte und wandte sich an die Kollegin, die sie beide kannten.
»Was ist geschehen?«
»Anke Freitag ist auf dem Weg zu ihrem Auto erschossen worden. Schuss aus großer Entfernung, wie es aussieht. Die Kriminaltechnik ist daran, den Standort des Schützen zu ermitteln.«
Miri sah sich um. Hatte jemand aus einem Fenster geschossen? Der Schütze hatte wohl kaum auf dem Platz gestanden, wo er ebenso exponiert gewesen wäre wie das Opfer. Was war so schwer daran, den Standort zu ermitteln? Die Kollegin beantwortete die Frage, ohne dass sie sie stellen musste.
»Die Leiche des Opfers ist bewegt worden. Frau Freitags Privatsekretär wollte helfen.«
»Wer war die Frau?«
Der Arzt antwortete. »Frau Freitag leitete Hessen3C, das hessische Cyber Competence Center im Innenministerium. Das Projektil hat sie mitten ins Herz getroffen. Ein Schuss, sie war sofort tot.«
Miri lief es heiß und kalt über den Rücken. Prinz ging es wohl ähnlich.
»Nur ein Schuss diesmal?«, fragte sie.
»Was heißt diesmal?«, stutzte die Kollegin.
Miri wischte die Frage mit einer Handbewegung weg und stellte eine Gegenfrage.
»Gibt es Hinweise auf die Tatperson, das Motiv?«
»Bis jetzt keine. Die Befragung der Anwohner und in den umliegenden Geschäftshäusern hat noch nichts ergeben. Es scheint sich um einen Geist zu handeln.«
Der Arzt verabschiedete sich. Wenige Schritte entfernt lag eine Mitarbeiterin der Kriminaltechnik im weißen Overall auf dem Boden und fischte etwas unter dem Auto des Opfers hervor. Kurz danach stand sie bei ihnen und zeigte das Projektil, das gerade ein Leben ausgelöscht hatte.
»Etwas verformt, aber mit deutlichen Spuren aus dem Lauf der Waffe«, erklärte sie dazu. »Kaliber 7,65, schätze ich.«
»Sturmgewehr G3, wetten?«, brummte Prinz.
Als hätte ihn ein Gedankenblitz getroffen, sagte er hastig zur Kriminaltechnikerin:
»Kommen Sie mit und nehmen Sie diesen Dingsbums-Schmauchspurenspray mit.«
»Dimethylamin?«
»Genau das.«
»Darf ich erfahren, worum es geht?«, fragte die Kollegin vom LKA verblüfft.
Prinz deutete stumm mit dem Kopf in die Richtung des schmalen Hochhauses, das im Norden des Platzes über die Baumwipfel ragte. Miri verstand sofort und erklärte es ihr.
»Möglicherweise hat der Täter vom Dach jenes Hauses geschossen.«
»Vom Dorint? Das dürften knapp 150 Meter sein. Ein Scharfschütze?«
Miri zuckte die Achseln. »Wir kennen jedenfalls einen solchen Schützen.«
»Ihr kennt ihn?«
Sie wehrte ab. »Kennen ist der falsche Ausdruck, aber der Täter oder die Tatperson in unserem Fall in Frankfurt hat genauso operiert. Schuss ins Herz aus 100 Metern Distanz vom gegenüberliegenden Dach aus.«
»Zufälle gibt’s.«
Eine sarkastische Bemerkung. Beiden war klar, dass das kaum Zufall sein konnte. Die Kollegin fragte denn auch:
»Gibt es Gemeinsamkeiten oder Beziehungen der Opfer?«
Wieder zuckte Miri mit den Schultern. »Das müssen wir herausfinden, aber warten wir ab, was mein Partner auf dem Dach findet.«
Eine gute Stunde verging, bis er mit der Kollegin der KT zurückkehrte. Miri hatte inzwischen versucht, im Ministerium mehr über das Opfer zu erfahren. Die wenigen Mitarbeiter, die nicht unter Schock standen, zeichneten das Bild einer Frau mit Charisma, die ihren Laden fest im Griff hatte und das Team an der kurzen Leine führte. Das war nicht negativ gemeint, eher respektvoll. Anke Freitag setzte klare Prioritäten und Ziele bei der Durchsetzung von Massnahmen, um Cyberkriminalität vorzubeugen und zu bekämpfen. Miri fand beim besten Willen keine Gemeinsamkeiten mit dem Job des Kreditsachbearbeiters Kramer bei der World Partners Bank. Warum sollte ein Täter ausgerechnet diese zwei so unterschiedlichen Menschen umbringen? Die Annahme, es könnte sich bei beiden Anschlägen um denselben Täter handeln, geriet arg ins Wanken. Gerade als sie die These verwarf, stieß Prinz zu ihr und verkündete mit zufriedenem Grinsen:
»Bingo! Sieht genau gleich aus wie bei der Bank. Ich wette, die KT findet die identische Zusammensetzung der Munitionsrückstände. Es war derselbe Täter!«
»Das beweist noch gar nichts«, erwiderte sie trotzig.
Er versuchte weiter, sie von seiner Theorie zu überzeugen, während sie mit ihm zum Hotel eilte. Sie mussten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras sichten.
»Wir brauchen die Videos der letzten 48 Stunden«, verlangte sie vom Manager.
Der Mann war ein Nervenbündel, konnte nicht fassen, dass von seinem Haus aus aufs Ministerium geschossen worden war. So etwas passte einfach nicht in sein Weltbild. Die Aufzeichnungen der Kameras am Eingang ergaben keinen Hinweis auf einen möglichen Täter. Miri sah ihre Vermutung bestätigt.
»Der Täter ist wohl nicht durch den Haupteingang hereinspaziert«, sagte sie.
Prinz nickte nachdenklich und betonte:
»Die anderen Eingänge sind permanent von innen verriegelt, das habe ich schon überprüft. Bleibt noch die Tiefgarage.«
»Werden die Fahrzeuge der Gäste ein- und ausgecheckt?«, fragte sie den Manager.
Der schüttelte den Kopf. »Aber die Kameras an der Ein- und Ausfahrt zeichnen alles auf. Die Aufzeichnungen werden allerdings nach 72 Stunden gelöscht. Datenschutz, Sie verstehen?«
Miri verstand zwar die Obsession ihrer Landsleute für Datenschutz nicht, hatte sie noch nie verstanden, sagte jedoch nur:
»Das dürfte reichen.«
Eine weitere Stunde am Monitor verging, bis Prinz rief:
»Halt, etwas zurückspulen, bitte.«
Die Angestellte des Sicherheitsdienstes befolgte die Anweisung. Das Standbild zeigte ein SUV bei der Einfahrt ins Parkhaus. Dahinter war eine Gestalt zu erkennen, halb verdeckt vom Fahrzeug, nicht viel mehr als ein Schatten.
»Ist das ein Angestellter?«, fragte Prinz die Mitarbeiterin der Security.
Die Frau war unsicher. »Nicht viel zu erkennen«, sagte sie und versuchte vergeblich, ein besseres Bild zu bekommen. »Normalerweise haben Angestellte dort nichts zu suchen«, erklärte sie dann.
Es erwies sich als unmöglich, das Gesicht der Person zu erkennen.
»Wir müssen den Halter dieses SUVs befragen«, sagte Prinz. »Vielleicht hat der etwas bemerkt.«
Miri hatte das Kennzeichen schon notiert, eine Schweizer Autonummer.
»Das wird dauern«, klagte sie.
Die Aufzeichnung lieferte keinen weiteren Hinweis bis zur Tatzeit. Der Timecode zeigte fünf Minuten nach dem Zeitpunkt der Schussabgabe, als die Gestalt wieder auftauchte. Die Kamera an der Ausfahrt hatte die Person von hinten erfasst, die Silhouette eines Mannes mit Baseballkappe. Diesmal versteckte der Unbekannte sich nicht hinter einem Fahrzeug. Er marschierte ohne Hast aus der Garage. Die Tasche in seiner Hand war groß genug für ein Sturmgewehr G3, schätzte Miri.
»Haben wir dich«, knurrte Prinz zufrieden.
»Noch nicht ganz«, murmelte sie. Ihr Telefon klingelte: Staatsanwaltschaft. Sie hörte kurz zu, legte auf und seufzte: »Wir werden im LKA erwartet. Krisensitzung.«
HEIDELBERG
Das Telefon von Hauptkommissarin Chris Roberts klingelte Sturm. Widerwillig blickte sie aufs Display: Joshi. Joshi Tanaka war ihr Partner beim Bundeskriminalamt, Abteilung für schwere und organisierte Kriminalität. Ein waschechter Berliner mit den japanischen Gesichtszügen seines Vaters und hartnäckig wie sie, wenn es um den Job ging.
»Nicht jetzt!«, sagte sie ärgerlich und drehte das Handy um.
Es gab Wichtigeres zu tun im Erker des alten Hauses am Neckar. Sie musste endlich die Krise in der Familie in den Griff kriegen. Schluss mit Arbeit als Ausrede, hatte ihr Mann Jamie zurecht gefordert. Auch er verbrachte als Arzt lange Tage im Institut, wo er medizinische Forschung betrieb. Beiden blieb wenig Zeit für Lukas, den 16-jährigen Teenager. Zu wenig, wie sie jetzt bitter feststellte. Der Junge ließ empfindlich nach im Gymnasium. In den letzten drei Monaten waren seine Noten durchs Band in den Keller gerauscht, obwohl es vorher nie Probleme gegeben hatte. Ein Jahr vor dem Abitur bedeutete das Krise, nichts weniger. Sie wusste es, Jamie wusste es, aber Lukas selbst schien es nicht zu kümmern.
Er saß zwar am runden Tisch, tippte aber laufend ins Handy, sah und hörte sonst nichts.
»Lukas, hör zu«, forderte sie ungeduldig. »Wir sprechen von dir, es geht um deine Zukunft.«
»Weg mit dem Handy«, doppelte Jamie nach.
Lukas sah kurz auf und sagte zu Chris:
»Du kannst doch auch nicht ohne.«
So weit waren sie schon. Konversation in Kurzschrift, dachte sie. Lukas legte zwar das Telefon neben sich auf die Bank, ohne es loszulassen, saß aber weiterhin teilnahmslos am Tisch, als hätte er nichts beizutragen. Jamie nahm einen neuen Anlauf.
»Jetzt sind Ferien«, begann er. »Wäre doch eine gute Gelegenheit, den Stoff aufzuarbeiten, der dir Schwierigkeiten bereitet.«
Lukas reagierte unerwartet. Er lachte kurz auf und erwiderte verächtlich:
»Ich habe keine Schwierigkeiten. Das Zeug interessiert mich bloß nicht.«
Sie erschrak. »Das sind ja ganz neue Töne. Ich kenne dich nicht wieder.«
Lukas hörte nicht zu. Er las eine neue Nachricht auf dem Handy.
»Lass das bitte«, sagte sie. »Ich sehe doch, dass dich etwas bedrückt. Sprich mit uns.«
Sein Mund blieb verschlossen. Sie sah Jamie ratlos an. Die Befragung des Sohnes erwies sich als ungleich schwieriger als die Befragung von Zeugen oder Verdächtigen. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was in Lukas gefahren sein könnte. Es gab keine Beweise, die sie dem Jungen unter die Nase reiben könnte, um ihn zum Reden zu bringen – außer den schlechten Noten. Ihr Ehemann schien genauso ratlos zu sein. Jamie saß steif und mit leerem Blick am Tisch, wie die Karikatur des Engländers beim Lösen des Kreuzworträtsels in der Sunday Times. Sie versetzte ihm heimlich einen Stoß, um eine Reaktion zu provozieren. Es funktionierte. Als säße Lukas nicht mit am Tisch, sprach er in der dritten Person von seinem Sohn.
»Er braucht eine Abwechslung vom Schulbetrieb. Weniger Theorie, mehr Praxis wie im richtigen Leben. Irgendetwas mit IT, das ihn fesselt.«
Der Gedanke erschien ihr wie ein Rettungsring. »Das ist es«, stimmte sie freudig zu, und blieb bei der dritten Person. »Er könnte doch eine Weile bei euch im Institut im PC-Support mitarbeiten, als Praktikant. Er kennt sich gut aus …«
Sie hielt inne, erschrocken über Jamies schmerzverzerrtes Gesicht.
»Nicht unsere IT«, stöhnte er und schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, nicht bei uns, das wäre nicht gut.«
Sie fragte nicht nach dem Grund. Es ging jetzt um Lukas, nicht um die Defizite im Max-Planck-Institut. Jamies Augen leuchteten überraschend auf.
»Da fällt mir ein, wie eine Kollegin letztes Jahr von ihrem Sohn geschwärmt hat«, sagte er. »Der Junge war ganz begeistert von einem Schülerpraktikum bei der IT einer großen Versicherung.« Er stand auf und ging vom Tisch weg in sein Büro. »Ich rufe sie gleich an.«
Chris wechselte wieder zur ersten Person. Sie tätschelte Lukas’ Hand, die er schnell wegzog, ohne sie anzusehen, und sagte tapfer lächelnd:
»Siehst du, es gibt für alles eine Lösung.«
Jamie kehrte zufrieden grinsend zurück.
»Hatte ich eine geniale Idee oder nicht?«, fragte er niemand Bestimmten. »Ich habe gerade erfahren, dass die WPB Schülerpraktikanten sucht für eine groß angelegte Testreihe in der IT-Abteilung.«
»Wunderbar«, freute sie sich anstelle des apathischen Sohnes, »und da kann man jetzt noch aufspringen?«
»Offenbar schon, wenn wir uns beeilen. Es gibt allerdings einen kleinen Haken.«
»Was denn?«
»Der Test findet in Frankfurt statt.«
»Frankfurt?«, fuhr Lukas auf, als wäre er gerade aus dem Koma erwacht. »Ein Praktikum in Frankfurt? Geil!«
Er hatte offenbar die ganze Zeit zugehört. Sie fragte sich allerdings, was an Frankfurt geil sein sollte. Ihr Handy klingelte wieder Sturm. Es wollte keine Ruhe geben. Joshi würde die ganze Nacht nicht aufgeben, also wischte sie nach rechts, um den Anruf anzunehmen. Sie brauchte nur kurz zuzuhören, um zu verstehen, dass die Familienkonferenz zu Ende war.
»Guys, tut mir leid. Wiesbaden ruft. Krisensitzung.«
WIESBADEN
Die meisten Lichter im Präsidium des hessischen Landeskriminalamts in Wiesbaden waren gelöscht, als Chris mit Joshi eintraf. Das große Sitzungszimmer im obersten Stockwerk hingegen war spätabends zu neuem Leben erwacht. Staatsanwalt Krüger saß schon am ovalen Tisch und unterhielt sich mit einer Dame im Zweiteiler, angegrautes Haar, harte Gesichtszüge, die wohl selten ein Lächeln zeigten.
Die Dame stellte sich als Staatsanwältin im LKA vor. Zwei weitere Sitzungsteilnehmer, ein Mann und eine Frau, beide mittleren Alters und mit ungesunder Gesichtsfarbe, waren unschwer als Ermittler wie Chris und Joshi zu erkennen.
»Hauptkommissarin Miriam Wernicke und Oberkommissar Günther Prinz vom LKA«, stellte die Staatsanwältin ihre Ermittler vor.
Krüger ergriff das Wort. »Ich darf Ihnen KHK Dr. Chris Roberts und KOK Joshi Tanaka vom BKA vorstellen. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass wir auf ausdrücklichen Wunsch des hessischen Innenministeriums da sind. Das Attentat auf Anke Freitag von Hessen3C hat Schockwellen bis nach Berlin ausgelöst, wie wir uns alle vorstellen können.«
»Kann man wohl sagen«, betonte seine Kollegin vom LKA.
Ein kurzer Austausch von Höflichkeitsfloskeln folgte, während die Ermittler des Landeskriminalamts Chris und vor allem Joshi misstrauisch beobachteten. Erwarteten die beiden jeden Augenblick ihre Verwandlung zu Echsen? Chris schob den Gedanken beiseite und räusperte sich.
»Wir kennen bisher nur, was über die offiziellen Kanäle zu uns durchgesickert ist«, sagte sie. »Ich habe gelesen, dass bereits eine Festnahme erfolgt ist.«
Es hörte sich an wie eine Frage und war auch so gemeint. Die Kollegin vom LKA, Miriam Wernicke, antwortete sofort.
»Der Verdächtige Ulf Schreiber ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Erstens hat er ein hieb- und stichfestes Alibi für die Tat in Wiesbaden – er befand sich zu der Zeit bei uns in U-Haft, und zweitens steht jetzt fest, dass beide Male, bei WPB in Frankfurt und am Innenministerium in Wiesbaden, mit derselben Waffe, einem Sturmgewehr G3, geschossen wurde.«
»Das wissen Sie weshalb?«, fragte Joshi. »Haben Sie die Tatwaffe sichergestellt?«
Miriam Wernicke schüttelte den Kopf. »Unsere KT hat Projektile an beiden Tatorten gefunden. Alle weisen die gleichen Spuren aus dem Lauf der Waffe auf. Es besteht kein Zweifel …«
»Wir zweifeln auch nicht daran«, fiel Chris ihr lächelnd ins Wort. »Es geht nur darum, alle Fakten auf dem Tisch zu haben.«
Die Staatsanwältin nickte beifällig und sagte:
»Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei der Tatperson wahrscheinlich um einen Mann mittleren Alters mit kräftiger, untersetzter Statur handelt.«
»Es gibt ein Video aus dem Hotel, von dessen Dach aus geschossen worden ist«, ergänzte Miriam Wernicke.
Ihr Partner, Günther Prinz, warf ein:
»Man sieht den Verdächtigen zwar nur von hinten, Gesichtserkennung ausgeschlossen, aber unsere Spezialisten haben Haltung und Gang analysiert.«
»Verstehe«, sagte Chris. »Gibt es Videos oder Zeugenaussagen vom ersten Tatort in Frankfurt, die auf diesen Täter schließen lassen?«
Für einen Moment herrschte betroffenes Schweigen, bis die Staatsanwältin antwortete.
»Niemand hat den Täter am ersten Tatort gesehen. Es gibt weder Zeugen noch Aufzeichnungen. Weshalb fragen Sie?«
»Das Vorgehen des Täters macht mich stutzig. In Frankfurt sieht es aus, als hätte er wild um sich geschossen, während er Anke Freitag mit einem einzigen, gezielten Schuss getötet hat. Das ist zumindest ungewöhnlich für einen Täter.«
Oberkommissar Prinz wusste auch darauf eine Antwort.
»Das hat uns auch gewundert. Die naheliegende Erklärung ist wohl, dass er in Frankfurt vertuschen wollte, wer das eigentliche Ziel des Anschlags war.«
»Schon klar«, warf Joshi ein, »aber warum verzichtet er in Wiesbaden auf dieses Vertuschungsmanöver? Es sieht ganz danach aus, dass zwischen den Morden etwas geschehen ist, das sein Handeln verändert hat.«
Chris dachte ähnlich und fügte an:
»Möglicherweise liegt der Schlüssel in der Arbeit oder im Verhalten des zweiten Opfers, Anke Freitag, oder überhaupt im Ministerium.«
»Oder es gibt kein zusammenhängendes Motiv für beide Taten«, spielte Staatsanwalt Krüger den Advocatus Diaboli.
»Oder so«, stimmte Chris nachdenklich zu.
Sie waren jetzt auf dem neusten Stand, sinnlos die Sitzung in die Länge zu ziehen. Daher schlug sie eine Arbeitsteilung vor, um wenigstens noch etwas Schlaf zu kriegen in dieser Nacht.
»Wir sollten diesen Ansatz weiterverfolgen«, sagte sie. »Mein Partner und ich werden morgen im Ministerium ermitteln. Das LKA fahndet nach dem Täter, einverstanden?«
Alle schienen erleichtert über den Vorschlag. Die Staatsanwältin schloss die Sitzung mit der Bemerkung:
»Wir haben 24 Stunden, um Ergebnisse vorzuweisen, sonst wird uns Berlin eine SOKO vor die Nase setzen.«
Mirjam Wernicke vom LKA sprach Chris auf dem Weg zum Parkplatz hinter vorgehaltener Hand an.
»Ist der Personalmangel im BKA schon so dramatisch, dass Sie Verstärkung aus Japan holen müssen?«
Mirjam grinste dabei, um die heikle Frage als Scherz zu tarnen. Chris lachte nicht.
»Joshi ist ein waschechter Berliner«, antwortete sie schroff.
»So meinte ich das nicht«, wehrte Mirjam sich erschrocken. »Ich sollte manchmal besser den Mund halten. Eigentlich wollte ich bloß ein paar Worte mit Ihnen wechseln. Sie sind so etwas wie eine Legende bei uns.«
Chris war beim Auto angekommen. Statt aufzuschließen, drehte sie sich zu Mirjam um und fragte verblüfft:
»Eine Legende? Wieso?«
»Das fragen Sie noch?«, platzte Mirjam heraus. »Ich sage nur Mefisk, Ndrangheta, der Drogenkrieg. Mein Name ist übrigens Miri. Alle nennen mich so.«
»Na dann, Miri, danke für die Blumen, aber ich sollte mich jetzt bald hinlegen. Morgen wird ein langer Tag.«
»Sicher. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Dr. Roberts.«
»Chris«, korrigierte sie und stieg ein.
Dunkle Nacht herrschte noch, als Joshi am Morgen das Büro im Präsidium des BKA betrat. Lotte hatte tief geschlafen, als er nach der späten Sitzung nach Hause gekommen war. Die einzige gemeinsame Nacht in diesem Monat war vorbei gewesen, bevor sie angefangen hatte. Ihre beiden Berufe schlossen sich gegenseitig aus. Er als Ermittler verbrachte eher zufällig hin und wieder ein paar ungestörte Stunden zu Hause, während Lotte als gefragte Beraterin großer Pharma- und Chemiekonzerne oft wochenlang durch die Welt jettete. Warum hatten Sie geheiratet?, fragte er sich manchmal betrübt, und jedesmal lautete die Antwort gleich: weil sie sich liebten.
Widerwillig schob er den Gedanken an seine Lotte beiseite und setzte Tee auf. Matcha, Premium Grüntee, der teuerste auf dem Markt, nur bei seinem Asiaten erhältlich. Dieser Luxus musste sein. Er bereitete ihn selbstverständlich mit entkalktem Wasser zu. Alles andere hätte den Tee ruiniert.
Mit der ersten Tasse setzte er sich an den PC. Statt ihn einzuschalten, nahm er das Handy, um die KI zu befragen. Das neuste Modell fand vollständig Platz im Speicher des Telefons und kommunizierte nicht nur mit dem Internet, sondern auch über einen verschlüsselten Kanal mit den Datenbanken des BKA. Niemand außer ihm und dem Partner seines Vaters, Generalbundesanwalt Osterhagen, wusste davon. Er besaß das modernste Ermittlungswerkzeug im ganzen Land, verborgen in seinem bescheidenen Telefon. Eines nicht allzu fernen Tages würde er auch das Handy nicht mehr brauchen. Dann würde er nur noch mit seiner Smartwatch kommunizieren – oder mit einem eingepflanzten Chip. Er freute sich darauf.
Was war bei Hessen3C oder im Ministerium zwischen dem Attentat bei der World Partners Bank und dem Mord an Anke Freitag geschehen? Gab es einen Zusammenhang zwischen der Arbeit des Cyber Competence Centers und dem Kreditsachbearbeiter bei der Großbank? Joshi hatte bereits nach Berührungspunkten zwischen den Opfern gesucht. Es gab keine. Würde die KI Zusammenhänge entdecken, die er nicht sah? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Software ihm auf die Sprünge helfen würde.
Ungeduldig wartete er auf die Antwort. Die KI spuckte nur Minuten später einen sauber strukturierten Bericht inklusive Zusammenfassung aus. Ein Absatz erregte sofort Joshis Aufmerksamkeit.
Anke Freitag lehnte den Antrag auf strengere Regulierung der Cyber Security in Banken mit der Begründung ab, die bestehenden Vorschriften würden eingehalten und genügten. Im Übrigen würden die Vorschläge der Antragsteller den Datenschutz von Bankkunden massiv schwächen.
Anke Freitag hatte diesen Beschluss einen Tag nach dem Attentat auf den Sachbearbeiter Kramer veröffentlicht. Der Kommentar der KI dazu öffnete Joshi die Augen. Die Software schrieb:
Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten könnte darin bestehen, dass kriminelle Hacker Geld vom Konto des Täters abgezogen haben, die Bank jedoch nicht oder ungenügend reagiert und einen Notkredit verweigert hat.
Reine Spekulation, warnte die KI gleichzeitig, doch Joshi erkannte einen neuen Ermittlungsansatz.
»Das könnte ein Motiv sein«, murmelte er erregt und schlürfte etwas Tee.
Er stürmte mit der Aktentasche aus dem Büro, als Chris um halb acht aus dem Lift trat. Staunend fragte sie:
»Schon wieder nach Hause? Gefällt es Ihnen nicht bei uns?«
Joshi schnitt eine Grimasse. »Darüber sprechen wir noch. Ich fahre schon mal ins Ministerium.«
Dr. Bodo Matuszek, der Innenminister des Landes Hessen, hatte keine Zeit für den Ermittler des BKA.
»Dann möchte ich bitte mit der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der verstorbenen Anke Freitag sprechen«, sagte er zur Dame am Empfang.
Die griff noch einmal zum Telefon, blass im Gesicht und mit ängstlichem Blick. Die Hand am Hörer zitterte leicht. Der Schock des Vortags saß ihr noch in den Knochen. Sie hörte nur kurz zu und legte wieder auf.
»Das geht jetzt leider nicht«, sagte sie. »Herr Waldvogel ist in einer Sitzung mit Dr. Matuszek.«
Joshis Geduldsfaden drohte zu zerreißen. Er zwang sich, ruhig zu antworten.
»Das trifft sich gut. Ich muss dringend mit beiden Herren sprechen. Es geht um deren Sicherheit.«
Die Dame erschrak, witterte schon den nächsten Anschlag.
»Wo finde ich die Herren?«, fragte Joshi freundlich lächelnd.
Eine ältere Dame öffnete auf sein wiederholtes Klopfen. Joshi hatte den Eindruck, das Maß an Höflichkeit nähme proportional zur Höhe des Stockwerks ab.
»Können Sie nicht lesen?«, herrschte die Dame ihn an. »Da steht besetzt in Leuchtschrift.«
Er verspürte keine Lust auf diese Spielchen mit geborgter Autorität und trat wortlos ein. Ihr Protest verhallte ungehört. Zwei Männer unterbrachen ihr Gespräch am runden Tisch und blickten feindselig in seine Richtung. Joshi zeigte den Dienstausweis und stellte sich vor.
»Oberkommissar Joshi Tanaka vom BKA. Tut mir leid, wenn ich stören muss, meine Herren.«
Einer stand auf und wollte sich mit einer kurzen Entschuldigung verabschieden. Das musste Anke Freitags Stellvertreter sein. Joshi hielt ihn auf.
»Herr Waldvogel, mit Ihnen muß ich auch sprechen, jetzt.«
Der Mann setzte sich wieder im Zeitlupentempo, ebenso blass im Gesicht wie die Empfangsdame in der Eingangshalle. Die Sekretärin überlegte noch, womit sie den Eindringling verprügeln könnte, setzte sich dann aber doch wieder den beiden Herren gegenüber an den Tisch. Der Notizblock vor ihr deutete darauf hin, dass sie das Protokoll führte. Joshi blieb stehen, da ihm niemand einen Stuhl anbot.
»Ich ermittle im Fall des Attentats auf Frau Freitag, wie Sie sich denken können«, begann er. »Dieser Fall hat höchste Priorität nicht nur im Landeskriminalamt, sondern auch bei uns im BKA.«
»Kommen Sie zur Sache«, unterbrach Minister Matuszek unwirsch. »Wir haben nicht ewig Zeit.«
Joshi passte sein Niveau an Höflichkeit der Etage an und antwortete trocken:
»Die Zeit werden Sie sich nehmen müssen. Es geht um Ihre Sicherheit.« Er ließ die Ankündigung für einen Moment einsinken, bevor er weitersprach. »Wir sind im Zuge unserer Ermittlungen auf ein mögliches Motiv der Tatperson gestoßen, das darauf schließen lässt, dass Frau Freitag nicht das letzte Opfer in diesem Haus sein könnte.«
Die Herren am Tisch sahen sich betroffen an. Selbst die Augen der Sekretärin weiteten sich.
Es klopfte, bevor Joshi den Grund des Verdachts nennen konnte. Die Sekretärin sprang wie elektrisiert auf. Sie hatte noch keine zwei Schritte gemacht, da wurde die Tür aufgestoßen. Ein Mann im Overall des Reinigungspersonals, Baseballkappe so tief im Gesicht, dass es nicht zu erkennen war, stieß den Wagen mit dem Putzzeug ins Zimmer und schloss die Tür rasch hinter sich ab.
»Nicht jetzt!«, rief Matuszek wütend mit rotem Kopf. »Was fällt Ihnen ein?«
Der Mann beachtete ihn nicht. Er beugte sich zu seinem Wagen hinunter und zog etwas unter einem Tuch hervor. Im nächsten Augenblick starrten sie in den Lauf seines Sturmgewehrs.
2
WIESBADEN
Der Lauf des Sturmgewehrs richtete sich auf Minister Matuszek.
»Auf den Boden, alle!«, befahl der Eindringling.
Eine Sturmmaske ließ nur die Augen frei. Joshis Hand zuckte automatisch zum Holster unter der Jacke, wo die Dienstwaffe steckte – stecken sollte. Der Eindringling bemerkte es. Der Lauf des Sturmgewehrs schwenkte herum. Ein Schuss löste sich mit ohrenbetäubendem Knall. Das Glas des Fensters hinter Joshi zersplitterte. Er zuckte zusammen, viel zu spät, hätte der Mann auf ihn gezielt. Die Sekretärin begann hysterisch zu schreien, dass die Ohren schmerzten. Im nächsten Augenblick lagen alle flach auf dem Bauch.
»Ruhe!«, schrie der Maskierte die Frau an und hielt ihr die Waffe an den Kopf.
Die Berührung mit dem vom Schuss erwärmten Metall stoppte das Geschrei augenblicklich.
»Ein Mucks und die Frau ist tot«, stellte jetzt der Unbekannte klar, emotionslos, sachlich, wie ein Nachrichtensprecher.
Joshi versuchte zu verhandeln und fragte nach den Forderungen des Angreifers. Der reagierte blitzschnell und mit roher Gewalt. Ein Fußtritt an den Kopf raubte Joshi kurz das Bewusstsein. Nur für Sekunden wurde ihm schwarz vor Augen, dann hörte er, wie der Angreifer Minister Matuszek an dessen Schreibtisch dirigierte.
Joshi blieb reglos liegen, als wäre er außer Gefecht. Es gelang ihm, den Notruf auf seiner Smartwatch unbemerkt zu aktivieren. Der Notruf war so programmiert, dass er zuerst auf Chris’ Handy landete. Nur wenn sie nicht binnen dreißig Sekunden antwortete, würde der Anruf an die 110 weitergeleitet. Er hoffte, Chris würde sich ans vereinbarte Protokoll halten und nur stumm zuhören, solange er sie nicht zum Sprechen aufforderte. So hätte sie ein Ohr am Tatort, ohne ihn zu gefährden.
Die Uhr am Handgelenk blieb still. Das versteckte Miniatur-Mikrofon würde jedes Geräusch zu Chris übertragen. Der Minister saß jetzt an seinem Schreibtisch. Er hatte sich vom ersten Schock erholt und konfrontierte den Angreifer mit dem Hinweis auf dessen ausweglose Lage.
»Was wollen sie überhaupt von mir?«
»Ich will, dass du die Klappe hältst und genau zuhörst.«
Der Lauf des Sturmgewehrs zeigte auf das Herz der Geisel. Bevor der Maskierte weitersprechen konnte, drang der Lärm sich nähernder Polizeisirenen durchs zerbrochene Fenster herein. Der Angreifer fluchte, als wäre die Reaktion der Behörden auf den Schuss im Ministerium eine Überraschung. Joshi konnte wie die andern am Boden liegenden Geiseln nicht sehen, was unten auf dem Platz vor dem Haus vorging. Er wusste auch so, wie der Einsatz ablaufen würde. Das zerschossene Fenster würde die Kollegen unweigerlich zum Büro des Ministers leiten. Vermutlich war ein Spezialeinsatzkommando bereits dabei, das Haus zu evakuieren und die Leute in Sicherheit zu bringen. Bald würde das Telefon auf Matuszeks Schreibtisch läuten.
Er täuschte sich nicht. Das Telefon schrillte. Der Angreifer riss den Hörer von der Gabel, hörte kurz zu und brüllte dann erregt:
»Ich will, dass die Polizei verschwindet. Wenn ich in fünf Minuten noch eine Uniform sehe, stirbt hier jemand.«
Damit knallte er den Hörer auf die Gabel und widmete sich wieder seinem Opfer am Schreibtisch.
»Hör jetzt gut zu, Matuszek. Du wirst das, was auf diesem Zettel steht, handschriftlich abschreiben und unterschreiben.«
Matuszek las den Zettel, den er ihm hinhielt. Joshi sah, wie er erblasste.
»Das – ist – ein Abschiedsbrief«, stammelte Matuszek erschüttert.
»Ganz richtig, und du wirst der Welt da draußen erklären, dass du mit dieser Schuld nicht weiterleben kannst. Macht nichts, wenn’s schnell geht. Schreib!«
Wieder läutete das Telefon. Diesmal schaltete der Angreifer den Lautsprecher ein. Er wollte, dass alle verstanden, was vorging, wohl um die Geiseln noch mehr einzuschüchtern. Die Maßnahme war unnötig. Waldvogel zitterte schon die ganze Zeit, als fegte ein eisiger Nordwind durchs Büro, und die Sekretärin schluchzte verzweifelt.
Die Stimme aus dem Lautsprecher überraschte und beruhigte Joshi gleichermaßen. Chris sagte:
»Die Einsatzkräfte haben sich zurückgezogen, wie Sie verlangt haben. Bevor wir weiter verhandeln, sagen Sie mir bitte, wer sich noch im Büro des Ministers befindet. Ist jemand verletzt?«
Der Maskierte ging nicht darauf ein. Seine Antwort bestand aus zwei Forderungen.
»Ich will 250.000 Euro in gebrauchten, nicht registrierten Scheinen und einen voll aufgetankten BMW M4 auf den Platz vor dem Eingang. Wenn die Tasche mit dem Geld nicht in einer halben Stunde beim Lift im elften Stock ist, stirbt jemand. Wenn ich einen Polizisten sehe, stirbt jemand.«
Damit war das Gespräch beendet. Joshi fielen zwei Dinge auf. Warum die für eine Geiselnahme geradezu lächerliche Summe von 250.000 Euro? Und der Angreifer benutzte konsequent die Bezeichnung Polizist, nicht Bulle oder andere abschätzige Begriffe. Joshi schätzte ihn deshalb trotz seiner Entschlossenheit und Brutalität nicht als abgebrühten Ganoven ein. Der Mann mit der Maske erschien ihm eher verzweifelt und daher nicht weniger gefährlich.
Minister Matuszek legte den Kugelschreiber weg.
»Ich werde das nicht schreiben«, sagte er entschlossen, trotz der auf ihn gerichteten Waffe. »Sie sind wahnsinnig. Wenn Sie mich erschießen wollen, warum nicht gleich?«
War es der Mut des Verzweifelten? Vielleicht nicht die geeignete Taktik, um Zeit zu gewinnen, dachte Joshi. Die Reaktion des Angreifers ließ nicht lange auf sich warten. Er trat vor die am Boden schluchzende Sekretärin hin. Der Lauf des Sturmgewehrs senkte sich auf ihren Kopf.
»Letzte Warnung«, sagte der Maskierte ruhig. »Schreib!«
Matuszek begann zitternd abzuschreiben, was immer der Angreifer ihm vorgelegt hatte. Das Schrillen des Telefons erschreckte Joshi. Der Angreifer drückte die Taste für den Lautsprecher. Chris’ Stimme sagte für alle gut hörbar:
»Das Geld ist beim Lift deponiert. Das Fahrzeug wird in Kürze eintreffen.«
Der Angreifer nahm es wortlos zur Kenntnis, unterbrach die Verbindung und wandte sich an Matuszek.
»Die Unterschrift fehlt noch.«
Zögernd unterschrieb der Minister das erzwungene Geständnis. Was sollte es anderes sein? Der Angreifer dirigierte ihn zum Wagen mit dem Putzzeug. Dort holte er noch etwas aus einer Kiste. Joshis Puls schoss in die Höhe, als er sah, was der Maskierte aus dem Putzlappen wickelte. Eine Walther PPK, vermutete er. Ihm war sofort klar, wozu der Angreifer die benutzen wollte. Er konnte nicht länger schweigen.
»Sie werden doch jetzt nicht den Minister draußen auf dem Flur mit der Pistole erschießen«, rief er.
Die Uhr würde die Information laut und deutlich an Chris übertragen. Er konnte nur hoffen, dass die Scharfschützen ihre Posten bezogen hatten, denn der Angreifer verlor keine Zeit. Der beachtete Joshi nicht, schulterte das Sturmgewehr, lud die Pistole durch und presste den Lauf Matuszek in den Rücken, dort, wo sich das Herz befand.
»Raus!«, befahl er.
Joshi sprang auf, sobald die Tür hinter den beiden zufiel. Hastig schilderte er die Lage über das Mikro seiner Uhr, öffnete dann die Tür einen Spalt und spähte hinaus. Die beiden standen hautnah beieinander am Lift. Die Scharfschützen konnten den Angreifer unmöglich ausschalten, ohne Matuszek zu verletzen oder gar zu töten. Joshi sah, wie die Tür des Lifts aufglitt und verfluchte sich einmal mehr, die Dienstpistole im Auto liegen gelassen zu haben. Verzweifelt zerrte er die Tür auf und rief dem Maskierten zu:
»Tun Sie das nicht! Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Lassen Sie …«
Er brach abrupt ab. Der Angreifer stieß Matuszek von sich in den Gang. Der Minister stürzte und lag am Boden, als sich der Lift schloss und mit dem Angreifer in Bewegung setzte. Kein Schuss war gefallen.
»Verdächtiger im Lift!«, brüllte Joshi und eilte zu Matuszek.
Im nächsten Augenblick sah er sich umringt von Kollegen in Kampfmontur. Befehle hallten durch den Gang. Suchtrupps setzten sich in Bewegung, dann trat Chris auf ihn zu und fragte gepresst:
»Alles in Ordnung?«
»Er steckt im Lift«, sagte er abwesend.
»Die Kollegen kümmern sich darum. Weit kommt er nicht.«