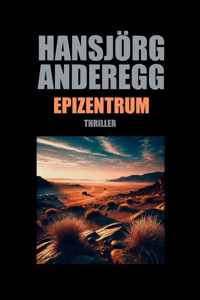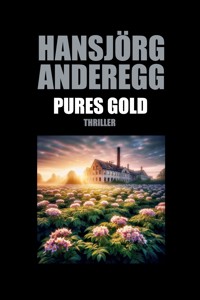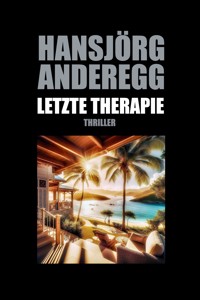Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: BKA-Kommissarin Chris
- Sprache: Deutsch
Ein blondes Haar! Ein einziges blondes Haar am Tatort, einem Schweizer Bergdorf, ruft Europol und Hauptkommissarin Chris Roberts vom BKA auf den Plan. Das Haar ist das Markenzeichen des Serientäters, der in ganz Deutschland und Österreich einflussreiche Politiker ermordet. Parlamentswahlen stehen an, und nur erfolgreiche neue Parteien in beiden Ländern scheint der Täter zu verschonen. Bis auch deren Exponenten in sein Visier geraten. Unruhen und gewaltsame Proteste erschüttern den Kontinent. Städte brennen. Die Ermittler sind machtlos, bis Chris mit ihrem Team die wahre Ursache des Chaos entdeckt, und die ist schlimmer als alles, was Europas Demokratien in den letzten fünfzig Jahren bedroht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hansjörg Anderegg
Die Schatten
Der 14. Fall mit BKA-Kommissarin Chris
Thriller
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-210-5
E-Book-ISBN: 978-3-96752-708-7
Copyright (2023) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter, XOXO Verlag
Unter Verwendung der Bilder
Stockfoto-Nummer: 596722127, 2084069383
Von www.shutterstock.com
Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
KAPITEL 1
ANDERMATT
Es gibt Irrtümer, über die du lachst, andere enden tödlich, wie der des Kollegen Arnold. Der Gedanke wollte Claudia nicht mehr aus dem Kopf beim Anblick des Toten in der Badewanne.
»Ausgerechnet bei der guten Anni«, seufzte Wachtmeister Sepp Arnold, »ein Jammer.«
»Wir hätten ihn besser ernst genommen«, murmelte Claudia.
Sepp fuhr aus seinen Gedanken auf.
»Was soll das heißen?«, fragte er gereizt.
»Du weißt genau, was ich meine.«
Der Vorgesetzte warf ihr einen strafenden Blick zu, dann beugte er sich über das Gesicht im Wasser, um den Toten genauer zu betrachten, als wäre er der Rechtsmediziner.
»Herrgottsternecheib!«, rief er plötzlich und fuhr mit einem Ruck auf. »Das ist ja der Österreicher!«
»Was du nicht sagst.«
Sie konnte sich ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen, obwohl hier nichts zum Lachen reizte.
»Wollt ihr nicht endlich das Wasser ablassen?«, fragte die Besitzerin der kleinen Pension Bergidyll mit unsicherer Stimme im Hintergrund. »Was machen wir jetzt mit ihm?«
»Das Wasser bleibt drin«, antwortete Claudia sofort. »Wir lassen alles so, wie du ihn gefunden hast, Anni, bis der Doktor kommt.«
»Der braucht keinen Doktor mehr«, brummte Sepp verstimmt. Leise wie zu sich selbst fügte er an: »Ausgerechnet der Ausländer.«
Claudia kämpfte gegen Übelkeit. Es war ihre erste Leiche im Dienst. Schlimmer noch wog die Tatsache, dass dies ein angekündigter Tod war.
»Verdammter Mist«, fluchte ihr Kollege, »konnte doch niemand wissen, dass der es ernst meint.«
Ich schon, dachte sie. Laut sagte sie: »Wenigstens haben wir seine Personalie.«
Sepp antwortete mit einem giftigen Blick. Sie sah es ihm an. Er hatte ein schlechtes Gewissen, und das war gut so. Wäre es nach ihm gegangen, hätten sie nicht einmal den Namen des Mannes notiert, als er sich vor zwei Tagen über Todesdrohungen auf seinem Handy beschwerte. Zugegeben, sie waren beide überfordert gewesen mit der Situation. Ein Fremder, der sich über Cybermobbing beklagte. So etwas war neu im Dorf am Fuß des Gotthard, und schließlich waren sie Dorfpolizisten und nicht die Kripo.
»Wo bleibt der scheiß Quacksalber?«, rief Sepp ungehalten, als er sich endlich von der Leiche abwandte.
»Der Quacksalber ist schon da«, tönte es von der Tür her.
Sepp dachte nicht daran, sich zu entschuldigen. Solche Beleidigungen unter Einheimischen zeugten bloß von Respekt. Der Doktor grüßte denn auch mit dem Lächeln des guten alten Bekannten.
»Jetzt sieh dir diese Sauerei an, Doc«, brummte Sepp.
Der Doktor, der sonst nur bei schwerer Grippe oder Beinbruch gerufen wurde, sah sich die Bescherung kurz an, fühlte den Puls, prüfte Atmung und Augenreflexe, nachdem sie ihm geholfen hatten, den Toten ein Stück aus dem Wasser zu ziehen.
»Ihr habt sicher schon selbst herausgefunden, was hier passiert ist«, wandte er sich dann an sie, auf die leere Packung Schlaftabletten am Boden deutend.
Sepp nickte eifrig und warf ihr einen triumphierenden Blick zu.
»Also?«, fragte der Doc augenzwinkernd. »Wie lautet unser Befund, Sepp?«
»Der hat sich selbst umgebracht.«
Der Doc nickte anerkennend. »Tod durch Ertrinken nach einer Überdosis Diazepan.« Er hob die leere Schachtel vom Boden auf und erklärte: »Das ist starker Tobak. Fünf, sechs Tabletten, und du bist für Stunden k.o. wie nach einem Kinnhaken von Cassius Clay.«
»Muhammad Ali«, fuhr sie dazwischen.
Es rutschte einfach heraus, und sie bereute es sofort. Der Doc schätzte es nicht, wenn man ihn korrigierte, statt über seine Witze zu lachen.
»Sind wir etwas zickig heute?«, fragte er denn auch gepresst.
Sepp beendete die folgende peinliche Pause.
»Sie hat recht, Doc.« Bevor der andere auch ihn angreifen konnte, fragte er: »Können wir das Wasser jetzt ablassen und den Bestatter rufen?«
Der Doc nickte verdrossen. Er kramte ein Formular aus seiner Tasche und ging voran ins Zimmer. Dort setzte er sich an den kleinen Schreibtisch und nahm den Kugelschreiber in die Hand.
»Hat der Mann einen Namen?«
»Viktor Gruber, Journalist aus Wien«, antwortete Claudia wie aus der Pistole geschossen.
Sie wollte auch einmal etwas Nützliches zu dieser Unterhaltung beitragen. Der Doc sah Sepp an. Erst als dieser nickte, schrieb er den Namen auf den Totenschein. Dann fügte er die Todesursache hinzu, indem er laut wiederholte, was er schon gesagt hatte. »Suizid«, bemerkte er noch dazu.
»Moment!«, unterbrach Claudia. Ihr ging das alles zu schnell. »Was ist mit den Drohungen auf dem Handy?«
»Welches Handy?«, fragte der Doc und zögerte mit der Unterschrift. »Ich sehe hier kein Mobiltelefon.«
»Ich auch nicht«, beeilte sich Sepp zu versichern, während Giftpfeile aus seinen Augen in ihre Richtung schossen.
»Das ist das zweite Problem«, sagte sie trotzig.
Zu Sepps großer Erleichterung wandte sich der Doc wieder dem Formular zu.
»Der Mann ist seit mindestens vier Stunden tot«, erklärte er. »Ich schreibe Todeszeitpunkt circa drei Uhr nachts. Genauer geht es nicht ohne Obduktion.«
»Das fehlte gerade noch«, platzte Sepp heraus.
Der Doc packte zusammen. Bevor er ging, drückte er Sepp den Totenschein in die Hand mit der Bemerkung:
»Nimm dich in Acht beim Tschau Sepp am Freitag.«
Lachend stapfte er die Treppe hinab, dass das Holz unter seinen schweren Schritten jammerte.
»Der soll mal besser selbst aufpassen«, brummte Sepp. »Beim Tschau Sepp hat er noch fast jedes Mal verloren, der elende Quacksalber.«
»Wenn wir durch sind mit dem Jassen hätte ich noch eine Frage«, warf sie gereizt ein.
Sepp war nicht in der Stimmung, Fragen zu beantworten. Er wollte Annis Pension so schnell wie möglich verlassen und wies sie an, auf die Bestatter zu warten.
»Die sollen die Leiche ins Hauptquartier nach Altdorf hinunter schicken. Für uns ist der Fall erledigt.«
Es wurde still in der Kammer der Pension Bergidyll. Claudia setzte sich an den Schreibtisch und versuchte, den Toten nebenan zu vergessen. War es doch ein einsamer Tod gewesen? War dieser Viktor Gruber in die Berge gereist, um hier zu sterben? Der Talkessel mit den verschneiten Gipfeln ringsum eignete sich gut, um der Welt Lebewohl zu sagen, musste sie zugeben. Sie war auch schon nahe daran gewesen, hatte keinen Sinn mehr gesehen in einer Existenz ohne echte Beziehung, nachdem der fünf Jahre jüngere Schwarm aus Altdorf einfach abgehauen war. Sie wollte nicht einsam sterben wie der Mann mit dem freundlichen, runden Gesicht in der Badewanne. Gib dir endlich einen Ruck, Mädchen, geh aus, lerne einen netten Typen kennen, der dich nicht gleich wieder enttäuscht! Das war das Problem. Als gebranntes Kind war sie zum Mauerblümchen mutiert. So sah es nämlich aus. Sie fuhr erschrocken auf. In Gedanken versunken hatte sie nicht bemerkt, dass sie nicht mehr allein war.
»Kari!«, rief sie aus. »Mein Gott, willst du mich umbringen?«
Annis Sohn stand mit breitem Grinsen im Zimmer, barfuß wie meist. Er zeigte ihr die schwarze Fußsohle.
»Kari leise.«
»Das habe ich bemerkt«, lachte sie. »Ich muss dich leider bitten zu gehen, Kari. Das hier ist ein Tatort, weißt du.«
»Tatort.«
Kari freute sich über das neue Wort. Er wiederholte es noch dreimal in Gedanken versunken, als müsste er es sich merken. Der arme Kerl war ein stattlicher junger Mann mit dem Hirn eines Dreijährigen. Er trat einen Schritt näher und streckte die Hand aus.
»Claudia«, sagte er und zeigte all die gesunden Zähne des Berglers.
Sie gab ihm die Hand und benutzte die Gelegenheit, ihn sanft hinaus zu drängen.
»Du musst jetzt wirklich gehen, mein Lieber. Wegen der Spuren, verstehst du? Sonst hält man dich am Ende für den Mörder.«
Das hätte sie nicht sagen sollen. Kari verstand keine Ironie. Er riss sich von ihr los und starrte sie aufgebracht an.
»Nein!«, schrie er, dass sie unwillkürlich zurückwich. »Nicht Kari! Schatten!«
Sie wurde hellhörig.
»Was meinst du mit Schatten?«
»Schatten!«, betonte er.
Im nächsten Atemzug stand er am Fenster und deutete eifrig auf den Vorplatz hinunter.
»Schatten – weg.«
»Du hast jemanden vom Haus weggehen sehen? Wann war das?«
»Kari kann nicht schlafen.«
»Du meinst in der Nacht?«
Er streckte die Hand aus, dann einen Finger nach dem andern, vier Finger.
»Morgens um vier? Hast du die Kirchenglocke gehört?«
Er nickte und bestätigte: »Kirche.«
Ihre Gedanken begannen sich zu jagen. Viktor Gruber hatte morgens um vier bestimmt schon tot in der Wanne gelegen. Hatte der gute Kari den Mörder gesehen, falls es sich doch um Mord handelte? Das würde jedenfalls das Rätsel des verschwundenen Handys erklären – und das des fehlenden Computers. Ein Journalist ohne Notebook? Eigentlich undenkbar. Sie versuchte, mehr aus Kari herauszuholen.
»War es ein Mann oder eine Frau?«, fragte sie. »Groß, klein, dick, dünn?«
Sie bekam nur eine Antwort auf all ihre Fragen.
»Schatten.«
Ein Schatten als Verdächtiger, nicht gerade ergiebig, und doch gab ihr seine Beobachtung zu denken.
»Kari«, rief Anni von unten herauf. »Wo steckst du? Komm jetzt, du musst Brot holen.«
Claudia sah ihm nach, wie er geräuschlos die Treppe hinunter glitt, als wäre er selbst ein Geist. Sie sah sich im Zimmer um. Da niemand es für nötig hielt, nach Spuren eines möglichen Gewaltdelikts zu suchen, musste sie es tun. Das Bett war aufgewühlt, als würde der Gast nach einem Besuch im WC gleich wieder hineinkriechen. Zuerst fiel es ihr nicht auf, doch bei genauem Hinsehen wirkte das blonde Haar wie ein Fremdkörper, der ganz und gar nicht zum Rest des Zimmers passen wollte.
»Anni«, rief sie hinunter. »Hast du einen Moment?«
Die Besitzerin der Pension näherte sich zögernd.
»Was ist?«
»Komm rein.« Claudia zeigte auf das auffällige Haar auf dem Kissen. »Hatte er Besuch?«
Anni blickte schaudernd aufs Bett, als läge der Tote drin.
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Du hast wirklich nichts festgestellt letzte Nacht?«
Anni zuckte die Achseln, dann erinnerte sie sich.
»Kurz bevor ich zu Bett ging habe ich ihn laut sprechen gehört. Er war, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Ich denke, er hat telefoniert.«
»Nur seine Stimme? Bist du sicher?«
»Klar bin ich sicher. Was soll die Fragerei? Ich dachte, der Fall sei abgeschlossen, und wir warten nur noch auf den Bestatter.«
Claudia versuchte, in Annis Gesicht zu lesen. Verheimlichte sie etwas? Warum sollte sie das tun? Sie verwarf den Gedanken rasch wieder. Trotzdem stimmte hier etwas nicht.
»Woher kommt dann das blonde Haar auf dem Kopfkissen?«, fragte sie. »Der Tote ist nicht blond und von euch auch niemand.«
Das gab der Frau kurz zu denken. Sie konnte es sich auch nicht erklären und reagierte gereizt.
»Willst du andeuten, ich hätte dem Gast ein schmutziges Kissen hingelegt?«
Claudia beschwichtigte sofort und fragte nach einem Plastikbeutel.
»Vielleicht ist es eine Spur, um zu verstehen, was wirklich geschehen ist«, bemerkte sie dazu.
Die Bestatter trafen ein. Sie instruierte die beiden wie Sepp es ihr aufgetragen hatte, und beeilte sich, das Haus zu verlassen. Sepp saß an seinem Schreibtisch auf dem Posten und las Zeitung.
»Rapport schon geschrieben?«, fragte sie spöttisch.
Sie hatte ihn noch keinen Bericht schreiben sehen, seit sie hier angefangen hatte. Solche unangenehmen Arbeiten delegierte er an die untergebene Gefreite Claudia Michel. Widerwillig unterbrach er die Lektüre.
»Warum hat das so lange gedauert?«
Sie fragte sich nicht zum ersten Mal, was ihre ältere Schwester an diesem übellaunigen Mannsbild liebte, dass sie ihn geheiratet hatte. Andererseits musste sie zugeben, die Schwester auch nie verstanden zu haben. Das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Sie setzte sich wortlos an ihren Arbeitsplatz und begann, den Rapport zu schreiben. Viel gab es nicht zu berichten. Die zwei Seiten waren schnell getippt und ausgedruckt.
»Zeig her!«, befahl Sepp.
Während er las, lief er rot an.
»Was zum Teufel soll das?«, fuhr er sie an. »Warum die Betonung auf das fehlende Handy und den Computer? Und was hat dieses Haar im Bericht zu suchen?«
»Das ist das Haar in der Suppe«, antwortete sie grinsend.
»Verflucht, Claudia, muss ich dir jetzt deinen Job erklären? Es war ein klarer Suizid! Lies den Totenschein! Weitere Kinkerlitzchen braucht es nicht im Rapport.«
»Der Doc vermutet Suizid, Sepp. Genau so steht es im Bericht.«
Sepp stieß die Zeitung wütend von sich und schnaubte:
»So geht das nicht nach Altdorf. Das nimmst du raus, verstanden!«
»Den Suizid?«
»Das Haar, verdammt!«
Sie hatte so etwas erwartet und ließ sich nicht einschüchtern.
»Zu spät«, erwiderte sie. »Ich habe den Rapport schon freigegeben. Das bedeutet, er ist bereits in Altdorf. Schließlich ist auch die Leiche dorthin unterwegs. Die müssen doch wissen, worum es geht.«
Sepp konnte nichts mehr dagegen unternehmen. Ihm blieb nur noch ein verhaltener Fluch.
»Sternecheib, Claudia! Hast du eine Ahnung, was da auf uns zukommt? Ich hätte den Scheiß selber schreiben sollen.«
»Keine Sorge, lieber Schwager, ich habe nur geschrieben, was wir beide mit eigenen Augen gesehen haben.«
Sie erhob sich, zog die Uniformjacke an und ging zur Tür.
»Was führst du jetzt wieder im Schilde?«
»Ich muss doch das Haar auf die Post bringen, steht im Bericht.«
Draußen hörte sie einen letzten, dumpfen Fluch.
HEIDELBERG
Chris hakte sich glücklich bei ihrem Jamie unter. Stolz auf sich und dem Schicksal ein wenig dankbar schlenderte sie an seiner Seite zum Neuenheimer Marktplatz, am Turm der alten Johanniskirche aus dem zwölften Jahrhundert vorbei zum Marktstübel. Sie hatte sich vom ersten Augenblick an in diesen kleinen Platz in der Mitte des Heidelberger Stadtteils verliebt. Hier gab es noch ein paar alte Gemäuer, die den Dreißigjährigen Krieg überstanden hatten. Sie liebte solche Symbole des Wiederstandes, Kraftorte für die Seele.
»Ich hätte uns schon etwas Schnelles gekocht, Schatz«, murmelte Jamie beim Betreten des Lokals.
»Du kannst dich nachher hier als Koch bewerben, wenn dir das Essen nicht schmeckt«, antwortete sie lachend.
Sie setzten sich an den runden Tisch, den sie schon jetzt nach wenigen Tagen in der Stadt als ihren Stammplatz betrachtete. Er blieb skeptisch beim Lesen der Speisekarte. Sie fackelte nicht lange und bestellte die Käsespätzle.
»Dr. Roberts, was kann ich Ihnen Gutes tun?«, fragte die Kellnerin ungeduldig, um Jamies Meditation über der Speisekarte zu beenden.
Chris nahm ihm die Karte aus der Hand und sagte:
»Der Herr möchte das Schnitzel mit Saison-Gemüse.«
Jamie ließ es geschehen, erleichtert, nicht wählen zu müssen aus all den Gerichten, denen er nicht traute.
»Du bist heute so gut gelaunt, Schatz«, sagte er. »Was habe ich falsch gemacht?«
Sie beugte sich über den Tisch und küsste ihn lange auf den Mund.
»Du redest wieder nur Blödsinn«, hielt sie ihm lachend vor. Nach einem Schluck Wasser sagte sie verträumt: »Ein echter Glückstag, meinst du nicht? Der erste Schultag unseres Sohnes, und wir waren beide dabei!«
Ein Lächeln umspielte seinen Mund, als er zustimmend nickte.
»Wer hätte das gedacht: Jamie Roberts, Vater eines Erstklässlers.«
»Und die Mutter?«
»Die wollen wir heute auch nicht ganz vergessen.«
»Herzlichen Dank auch«, antwortete sie lachend.
Er nahm ihre Hand. »Sag mal, bereust du den Umzug nach Heidelberg wirklich nicht?«
»Kein bisschen, im Gegenteil, da bin ich etwas weiter weg von Wiesbaden – und du bist näher bei Lukas, wenn was ist.«
Jamies Hand zuckte zurück. Er zeigte das betroffene Gesicht, das sie so liebte.
»Was soll mit Lukas sein?«, fragte er irritiert.
Sie schüttelte den Kopf und seufzte: »Nichts, gar nichts, Schatz. Ich wollte bloß betonen, wie wichtig du für unseren Sohn bist.«
»Das weiß ich doch.«
Die Kellnerin tischte das reich garnierte Schnitzel und die Spätzle auf. Sie begannen zu essen. Ihre Gedanken waren bei Lukas. Was er wohl gerade aß in der Schule? Mit einem Anflug schlechten Gewissens hielt sie plötzlich inne und fragte: »Meinst du, es war falsch, ihn am ersten Tag allein zu lassen?«
Wahrscheinlich sah ihr Gesicht jetzt so betroffen aus wie seins vor wenigen Minuten. Jedenfalls reizte es ihn zum Lachen.
»Er ist doch nicht allein, Liebes. In der Kita hat er auch den ganzen Tag verbracht. Er wird viel zu erzählen haben am Abend.«
Es beruhigte sie nur halbwegs. Andererseits war das jetzt ihr Leben. Tagesschule für Lukas, Arbeit am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung nur einen kurzen Spaziergang von der Wohnung entfernt für Jamie und Bösewichte jagen beim BKA in Wiesbaden für sie. Alle drei Familienmitglieder hatten sozusagen einen Vollzeitjob wie in den meisten andern Familien, die sie kannte. Sie gewöhnte sich besser rasch an die neue Situation. Im Essen stochernd murmelte sie:
»Hofmann fehlt ihm schon.«
»Und umgekehrt«, stimmte er zu.
Der Hund ihrer Freundin Caro, bei der sie vorher gewohnt hatten, besaß durchaus Qualitäten eines Babysitters.
»Lukas wird bald Freunde unter den Mitschülern finden.«
Jamie sagte es so, als müsste er sich selbst überzeugen. Sie hoffte inständig, er möge recht behalten, denn aus ihrer Sicht waren sie hier in einer Art Paradies angekommen. Im Augenblick stimmte einfach alles. Die Wohnung in der Villa des alten Fritz direkt am Neckar mit Sicht auf die zwei Türme des Brückentors an der Alten Brücke schlug Caros umgebauten Stall um Längen. Sogar der Mietpreis war erschwinglich.
»Woher kennst du eigentlich den alten Fritz?«, fragte sie unvermittelt.
Jamie schmunzelte beim Gedanken an den kauzigen Alten, der sich bis zu ihrer Ankunft scheinbar nur mit seinen zwei kaltschnäuzigen Katzen unterhalten hatte. Jetzt war zwischen den Viechern und Fritz ein Wettrüsten um Lukas’ Gunst im Gang.
»Professor Friedrich von Berg war Leiter des Instituts lange vor mir«, antwortete Jamie. »Jetzt ist er sicher schon fünfzehn Jahre in Rente und langweilt sich. Mein Freund Sebastian hat mich auf die leer stehende Wohnung aufmerksam gemacht. Er meinte, der alte Fritz brauche Gesellschaft.«
»Sebastian Heller, dein Chef? Nett von ihm.«
Jamie nickte versonnen. »Ich glaube, so stimmt es für alle.«
»Für mich auf jeden Fall«, gab sie lachend zu.
Nach dem Essen kehrten sie zum Haus des alten Fritz zurück. Beim Anblick der Jugendstilvilla mit den rot eingefassten, hohen Fenstern und dem Erker über dem verwilderten Garten blieb sie stehen und seufzte:
»Was können wir tun, damit er uns dieses Juwel vererbt?«
»Vielleicht adoptiert er uns«, schlug Jamie vor. »Er hat ja keine Nachkommen, und geschieden ist er schon lange.«
»Gute Idee«, grinste sie.
Jamies erste Schritte in der Wohnung führten ihn wie stets zum Erker. Versonnen blickte er auf den Garten hinunter.
»Da wartet einige Arbeit auf uns«, seufzte er.
»Auf dich wolltest du sagen. Ich habe zwei linke Hände, wie du weißt.«
»Du schießt also links? Wusste ich nicht. Wie dem auch sei, das Gestrüpp da unten wird jedenfalls der Kräutergarten. Etwas Dill ist ja schon da.«
Sie trat näher. »Das schlappe Gras soll Dill sein? Bist du sicher?«
»Chris!«
»Ich frage ja nur«, erwiderte sie und gab ihm einen Klaps auf den knackigen Hintern, gefolgt von einem kräftigen Kneifen, dessen Bedeutung er gut kannte.
Sie hatten noch eine Stunde, die galt es zu nutzen. Auf dem Weg zum Schlafzimmer stoppte sie das fordernde Miau einer Katze.
»Lass die fromme Helene«, meinte Jamie ungeduldig. »Wir haben nicht mehr viel Zeit.«
»Die brauchst du auch nicht«, lachte sie und schloss die Wohnungstür auf.
Die Katze rannte an ihr vorbei durch den Flur und blieb mitten im Wohnzimmer stehen.
»Es ist Vetter Franz, nicht die fromme Helene«, stellte sie fest.
Niemand wusste, weshalb Fritz die Katzen nach Wilhelm Buschs Figuren benannte. Beide waren kurzhaarig und schwarz-weiß. Franz unterschied sich von Helene nur durch einen schwarzen Haarkranz auf dem Kopf wie eine Tonsur, passend zu Wilhelm Buschs scheinheiligem Vetter Franz, der die fromme Helene auf der Wallfahrt geschwängert hatte.
»Egal, wer du bist«, sagte Jamie zu Franz, »du sollst jetzt schleunigst wieder verschwinden.«
Die Katze setzte sich in Bewegung. Statt zur Tür trabte sie zum Kinderzimmer, in die Küche und schließlich in ihr Schlafzimmer, jedes Mal begleitet von jämmerlichem Miau.
»Franz sucht Lukas«, schloss sie messerscharf.
»Das reicht«, brummte Jamie. Er sah Franz tief in die Augen, schüttelte heftig den Kopf und schärfte ihm ein: »Lukas ist nicht da!«
Franz starrte mit dem gleichen Blick zurück, dann spazierte er zur Tür. Draußen wartete Helene auf ihn. Beide unterhielten sich kurz, bevor sie abzogen, Schwänze steil nach oben.
»Die sind gar nicht so dumm, wie ich glaubte«, kommentierte sie verblüfft.
»Komm jetzt«, tönte es aus dem Schlafzimmer.
Zwei Stunden später warteten sie mit anderen Eltern vor der Schule auf ihren Erstklässler. Überrascht trat Jamie auf einen etwas älteren Herrn mit Schnauzer in elegantem Zwirn zu.
»Sebastian, was tust du hier?«, fragte er.
Der Herr grüßte sie lächelnd. Jamie stellte ihn als Dr. Sebastian Heller vor, seinen langjährigen Kollegen und Freund vom Institut.
»Ich warte auf unsere Tochter Mia.«
Jamie schluckte leer. »Mia? Du hast eine …«
Sebastian lachte. »Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber meine Frau Emma ist etwas jünger.«
»Er meinte es nicht so«, warf Chris ein, um Jamies peinliches Schweigen zu überbrücken.
Die Glocke im Schulhaus erlöste alle drei. Lukas sprang in ihre Arme. Das Mädchen, das ihm folgte, musste Hellers Tochter sein.
»Mama, das ist Mia«, klärte Lukas sie sofort auf. »Sie wohnt ganz in unserer Nähe.«
»Ich weiß«, antwortete Chris verwundert.
»Darf ich ihr die Katzen zeigen?«, bat Lukas.
Eine neue Art der Anmache, dachte sie amüsiert, besser als die Briefmarkensammlung. Die Frage »Wie war‘s in der Schule?« erübrigte sich. Lukas und Mia dachten nur noch an Franz und Helene.
»Da hat es wohl mächtig gefunkt zwischen den beiden«, sagte Jamie lachend zu seinem Freund.
Sebastian hörte nicht hin. Er war vor einem Wahlplakat stehen geblieben.
»Seht euch das an«, sagte er erregt, »eine Schande.«
Sie hatte sich bisher überhaupt nicht um die anstehenden Wahlen in den Landtag gekümmert. Zum ersten Mal las sie den Text unter dem nicht unsympathischen Bild. Ein Kandidat der Neuen Mitte versprach saubere und transparente Politik für freie Bürger.
»Was ist so schlimm daran?«, fragte sie ratlos.
»Sarkasmus?«, erwiderte Sebastian mit bitterem Lächeln.
Sie schüttelte den Kopf und murmelte: »Ich sollte mich besser informieren, nicht wahr?«
»Allerdings, noch ist Zeit genug bis zu den Wahlen.« Er deutete auf das Plakat. »Dieser Text ist reiner Zynismus. Unter Freiheit versteht die neue Partei nur ihre eigene Freiheit. Wenn Sie mich fragen, verstecken sich hinter den freundlichen Fassaden der Neuen Mitte rechtsextreme Fratzen. Das sind Rattenfänger und Demagogen. Wählen Sie grün!«
Sebastian verabschiedete sich eilig.
»Was war das denn?«, fragte sie verstört.
Jamie kannte Sebastian gut, und obwohl er als Engländer nicht wahlberechtigt war, wusste er besser Bescheid über die Politik in Baden-Württemberg als sie.
»Das war ein klares Votum des Kandidaten Heller, der sich für die Grünen zur Wiederwahl stellt und mit Sicherheit auch wieder gewählt wird.«
»Ach so, für ihn sind also Kandidaten der anderen Parteien die Bösen.«
Jamie sah es nicht ganz so schwarz-weiß.
»Es ist nicht so einfach«, sagte er. »Ich habe mir schon einiges von ihm anhören müssen und auch gelesen. Die Neue Mitte scheint eine durch und durch populistische Partei zu sein mit einem ziemlich kranken Demokratieverständnis.«
»Eine zweite AfD oder gar NPD?«
»So etwas vermutet Sebastian. Was diese Partei gefährlich macht, ist offenbar, wie professionell gemäßigt sie auftritt. Die Kandidaten erlauben sich keine Schnitzer und treten in kein Fettnäpfchen, obwohl die Exponenten ähnlich radikale Standpunkte vertreten wie die Haudegen von rechts außen.«
Sie betrachtete das freundliche Gesicht und den Text auf dem Plakat noch einmal und konnte nicht glauben, was sie eben gehört hatte.
»Meinst du nicht, er übertreibe maßlos?«
Jamie schüttelte nachdenklich den Kopf.
»Das kann ich mir schlecht vorstellen. Sebastian ist ein politisches Schwergewicht in Stuttgart mit echten Chancen, eines Tages den Ministerpräsidenten zu beerben. Und er kennt einige Spitzenkandidaten der Neuen Mitte persönlich.«
Die rosarote Stimmung des Tages war verflogen. War dies am Ende doch nicht das Paradies, fragte sie sich.
DEN HAAG
Hauptkommissar Mike Matter, Verbindungsoffizier Schweiz Suisse Svizzera. Das Schild an der Tür sollte Eindruck schinden. Mike warf einen verächtlichen Blick darauf. So hatte er sich die Arbeit bei Europol nicht vorgestellt. Allzu schnell war er einverstanden gewesen, hier als Abgesandter der Schweizer Bundespolizei zu versauern. Widerwillig setzte er sich an den Computer, die einzige Waffe, die hier zum Einsatz kam. Er langweilte sich schon jetzt, bevor er den Bildschirm einschaltete, obwohl er sich beileibe nicht über mangelnde Arbeit beklagen konnte. Wie viele E-Mails warteten heute auf ihn? Mindestens zwanzig, schätzte er. Im Laufe des Tages würden fünfzig oder mehr an ihm vorbeiziehen. Nur schon alle unwichtigen Nachrichten zu überfliegen würde Stunden in Anspruch nehmen. Recherche, Aktenstudium nannte man das, Polizeiarbeit. Es war eben nicht seine Polizeiarbeit. Deswegen hasste er den Computer, die Arbeit, den Betonklotz am Rande des Botschaftsviertels von Den Haag und die Dachkammer, die er sich mit dem bescheidenen Spesenkonto bloß leisten konnte, wenn wir schon dabei sind. In keinem der drei Fälle, die er bearbeitete, ging es voran. Daran änderte auch die E-Mail-Flut an diesem Morgen nichts. Gegen Mittag nahm er die Sporttasche und fuhr zum Gym hinunter. Auf dem Weg zum Ausgang im neuen Jogginganzug begegnete er der Französin vom zweiten Stock, die ihm stets mitleidige Blicke zuwarf.
»Nicht dein Ernst«, stutzte sie. »Seit wann treibst du Sport?«
»Wer sagt, dass ich Sport treibe?«
»Alles an dir.«
»Dann klappt es ja mit der Verkleidung.«
Sie starrte ihm mit offenem Mund nach. Der große Park in der Nähe war das einzig Gute, das er seiner Situation abgewinnen konnte. Auf den ersten Metern dachte er an die Runden in Bern am Aareufer entlang, damals mit jungen Knochen und Muskeln, die nicht wie jetzt nach zehn Minuten schmerzten. Außer Atem hielt er bei einer leeren Bank an und gab vor, Dehnungsübungen zu machen, um die Gruppe junger Anwärter vom Erdgeschoss ohne Kommentar an sich vorbeiziehen zu lassen.
»Cool Alter«, rief dennoch einer.
War er ein alter Mann geworden? Noch nicht fünfzig und alt? Der Junge musste sich irren, obwohl er sich gerade so fühlte, als hätte er recht. Er trottete langsam weiter, während die Bilder aus seinen früheren Jahren bei der Bundespolizei im Kopf aufflammten. Der Gedanke, früher wäre alles besser gewesen, streifte ihn kurz. Sehr kurz nur, denn das Gegenteil traf zu. Warum hätte er sonst dreimal offiziell sterben und untertauchen müssen? Die Zeiten waren genauso mühsam gewesen wie Aktenstudium am Computer, bloß anders. Syrien und Irak – kein Zuckerschlecken, aber er hatte etwas erreicht, die Waffenlieferungen des korrupten Hilfswerks gestoppt, den hoch angesehenen Kopf der Bande aus dem Verkehr gezogen – praktisch im Alleingang. Das sollten ihm die Schnösel vom Parterre erst einmal nachmachen. Er verlangsamte die Schritte, verließ den Park und steuerte auf die nahe Pommesbude zu.
Mit oder ohne Mayonnaise?, überlegte er, als der Alarm am Handgelenk einsetzte. Die Nachricht versetzte ihm einen Schock.
»Entschuldigung«, schleuderte er dem Mann im Büdchen entgegen und rannte los.
Schon wieder! seufzte er innerlich. Verschwitzt und mit gefährlich hohem Puls stürmte er ins Büro. Die Nachricht auf der Smartwatch war nicht sehr spezifisch. Er wusste zwar, was wieder passiert war, aber nicht wo und unter welchen Umständen. Die entsprechende Meldung am Computer eignete sich nicht, seinen Puls zu beruhigen.
DNA Match Verschlusssache POL 27531, stand in der Überschrift. POL bedeutete politisch motiviertes Gewaltverbrechen, und das Aktenzeichen kannte er seit einem Jahr auswendig. Die DNA, von der die Rede war, hatten Ermittler in Deutschland und Österreich in unmittelbarer Nähe von insgesamt elf Mordopfern sichergestellt. Keiner der Fälle war bisher aufgeklärt worden. Bei allen Opfern handelte es sich um bekannte Politiker aus dem links-grünen Lager, die einzige Gemeinsamkeit außer der identischen DNA, die vermutlich vom Täter stammte. Ein Serienkiller war unterwegs, jetzt offenbar auch in der Schweiz.
»Altdorf?«, murmelte er ungläubig. »Gibt es da überhaupt Linke?«
Die Nachricht verriet nichts über das Opfer. Der Alarm war einzig ausgelöst worden, weil die Urner Kantonspolizei einen Treffer in der DNA-Datenbank gelandet hatte, einen Match mit unbekannter Referenz, nach der gefahndet wurde. Ein stiller Alarm war ausgelöst worden, von dem die Behörde in der Schweiz wahrscheinlich gar nichts bemerkt hatte. Elektrisiert griff er zum Telefon.
»Kantonspolizei Altdorf, Mathis am Apparat«, antwortete der Schweizer Kollege überraschend schnell. »Was kann ich für Sie tun?«
Mike stellte sich vor und fragte nach dem Techniker, der den DNA-Abgleich durchgeführt hatte. Es dauerte etwas länger, aber schließlich hatte er die Spezialistin der KT am Apparat.
»Beschreiben Sie mir die Probe«, verlangte er kurz angebunden.
»Ein blondes Haar unbekannter Herkunft. Es lag auf dem Kopfkissen, die Leiche in der Badewanne.«
»Wo ist die Leiche jetzt?«
»Auf dem Weg ins Krematorium, nehme ich an.«
»Fuck! Sofort stoppen! Die Leiche muss obduziert werden! Haben Sie verstanden? Auf keinen Fall verbrennen!«
»Ich verstehe nicht«, antwortete die verdutzte Frau. »Was hat das Haar mit dem Suizid zu tun?«
»Keine Zeit für Erklärungen«, schrie er ins Telefon. »Sorgen Sie dafür, dass die Leiche schleunigst in die Rechtsmedizin kommt, verdammt. Wir haben es mit einem potenziellen Serientäter zu tun. Wenn wir diese Spur verlieren, geschehen womöglich noch mehr Morde.«
Die drastische Warnung schien sie nachdenklich zu stimmen.
»Ich schicke Ihnen den Eilantrag sofort und bin schon unterwegs.«
Er knallte den Hörer auf die Gabel, füllte hastig das Formular aus und schickte es elektronisch und per Kurier nach Altdorf. Kurz nach 17 Uhr hob der Flieger in Amsterdam Schiphol ab mit Kurs auf Zürich. Endlich wieder im Dienst, dachte er.
Abends um 20 Uhr traf er auf dem Polizeiposten in Altdorf ein. Ein einziger Beamter war zugegen.
»Wir haben Sie erst morgen erwartet«, entschuldigte sich der Korporal am Empfang.
Die Dame der Kriminaltechnik war auch zu Hause nicht erreichbar.
»Hat sie keine Nachricht hinterlassen?«, fragte Mike mit zunehmender Nervosität.
Er sah den Leichnam des Opfers schon brennen. Der Beamte schüttelte den Kopf.
»Nicht, dass ich wüsste – aber ich könnte im System nachschauen.«
»Schauen Sie nach!«
Die Dame stellte sich als gewissenhaft heraus. Sie hatte die elektronische Akte des Falles aktualisiert, wie er am Bildschirm des Korporals feststellte.
»Drucken Sie mir das bitte aus«, sagte er beruhigt, nachdem er den letzten Abschnitt gelesen hatte.
Der Leichnam lag in der Kühlkammer des Bestatters und wartete auf den Transport in die Pathologie des Unispitals Zürich. Am Morgen danach verließ er die Pension beim Telldenkmal früh. Er musste Druck machen. Niemand schien den Fall ernst genug zu nehmen, um ihn mit der nötigen Priorität zu behandeln. Die einzige Ausnahme bildete der Bestatter, der die Leiche so schnell wie möglich loswerden wollte. An diesem Toten war kein Geld zu verdienen. Die Reise nach Zürich unternahm Mike im Leichenwagen. Er durfte kein Risiko mehr eingehen. Unterwegs rief er in Andermatt an. Der kurze Bericht in der Akte warf ein paar Fragen auf. Die warme Stimme einer offenbar jungen Frau antwortete. Sie stellte sich mit dem Namen vor, mit dem der Rapport unterschrieben war.
»Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte er. »Es steht nichts darüber in Ihrem Bericht.«
»Ich hielt das nicht für wichtig«, antwortete die Gefreite Claudia nach kurzer Überlegung, ob sie vielleicht die Beleidigte spielen wollte. »Alles deutete auf Suizid hin. Anni, die Besitzerin der Pension, hat ihn gefunden. Als niemand auf ihr Klopfen antwortete, hat sie das Zimmer betreten.«
»War es abgeschlossen?«
»Das – weiß ich nicht.« Wieder entstand eine peinliche Pause. »Hören Sie, niemand ahnte, dass das eine Mordermittlung wird. Seit Jahren ist hier oben …«
»Schon gut«, unterbrach er. »Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Im Gegenteil, es war gute Polizeiarbeit, das Haar sicherzustellen. Trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die näheren Umstände abklären würden. Alles ist wichtig, was auf Fremdeinwirkung hindeuten könnte.«
»Da – wäre noch etwas, das nicht im Bericht steht«, sagte sie zögernd. »Annis Sohn will einen Schatten bemerkt haben, der sich morgens um vier vom Haus entfernte.«
Mike fuhr auf. »Was?«, platzte er heraus. »Ein Schatten? Was soll das heißen?«
»Kari ist geistig behindert, müssen Sie wissen. Deshalb kann man seine Aussage nicht für bare Münze nehmen. Vielleicht hat er bloß schlecht geträumt.«
»Das bezweifle ich«, murmelte er verärgert. »Vernehmen Sie diesen Kari und seine Mutter noch einmal und halten Sie die Augen offen. Gut möglich, dass sich ein Serientäter in Ihrem Dorf herumtreibt!«
Er glaubte selbst nicht daran, aber man konnte nie wissen.
»Was wirst du uns erzählen?«, fragte er den Toten hinter ihm.
»Wie bitte?«, wunderte sich der Fahrer des Leichenwagens.
»Ich habe den Toten gefragt, aber der antwortet nicht.«
Der Fahrer seufzte. »Ja, das hasse ich auch an unseren Kunden.«
ZÜRICH
Die Rechtsmedizin im Unispital schien verwaist zu sein. Zwei Leichname warteten auf die Obduktion, und die Assistentin des Pathologen reagierte überfordert auf die neue Einlieferung.
»Professor Althaus isst wohl gerade sein Frühstück«, antwortete die junge Frau, während sie ihm mit fahriger Handbewegung ein Formular zur Unterschrift reichte.
»Gemütlich frühstücken mit drei Leichen in der Warteschlange?«
Die Frau sah ihn entsetzt an, nahe am Zusammenbruch, wie er jetzt bemerkte.
»Wir haben die halbe Nacht durchgearbeitet«, warf sie ihm etwas gar laut an den Kopf. »Von Gemütlichkeit kann keine Rede sein, Herr Hauptkommissar.«
Er entschuldigte sich halbherzig.
»Wo finde ich den Professor?«
»Cafeteria.«
Mehr war nicht aus ihr herauszuholen. Zehn Minuten später stand er am Tisch in der Cafeteria.
»Professor Althaus?«
»Wer will das wissen?«, fragte der Mann mit blassem Gesicht und grauem Haar.
Sein Mienenspiel verriet nichts Gutes über die Reste auf dem Tablett.
»Man muss sich ja irgendwie ernähren«, knurrte er angewidert und schüttete den letzten Schluck Kaffee in sich hinein.
Mike stellte sich und den neuen Kunden vor, der unten in der Leichenhalle auf Behandlung wartete.
»Ich weiß, dass Sie alle Hände voll zu tun haben«, fügte er rasch an. »Es tut mir aufrichtig leid, Sie nach so einer anstrengenden Nacht schon wieder belästigen zu müssen, aber die Sache duldet keinen Aufschub.«
Professor Althaus warf ihm einen müden Blick zu und sagte nur:
»Kommen Sie am Freitag wieder.«
»In drei Tagen?«, rief er aus. »Das geht nicht.«
»Dann eben am Montag.« Der Professor erhob sich. »Guten Tag.«
Mike lief rot an, doch für einmal hatte er sich unter Kontrolle. Er rannte dem Professor nicht nach, überlegte stattdessen, wie er die harte Nuss knacken könnte. Es gab nicht viele Optionen, im Grunde nur eine, und die schätzte er als wenig erfolgversprechend ein.
»Nehmen Sie es nicht persönlich«, sagte die Angestellte, die das Tablett des Professors abräumte. »Er macht gerade eine schwere Zeit durch.«
»Wer, der Professor?«, fragte er abwesend.
»Schmutzige Scheidung«, munkelt man.
Es gab vielleicht doch eine zweite Möglichkeit: der gemeinsame Feind. Er dankte der Angestellten und eilte zurück zur Rechtsmedizin. Professor Althaus war dabei, der Assistentin Anweisungen zur Obduktion eines Leichnams zu geben, der schon nackt auf dem Tisch lag. Mike bemühte sich, nicht hinzusehen. Er konzentrierte sich auf den Chef und sagte:
»Der muss leider warten.«
»Was unterstehen Sie sich!«
Althaus rang um Contenance, während er ihn mit vernichtenden Blicken strafte.
»Oder sind das auch Opfer eines Serientäters?«, fragte Mike weiter. Das verblüffte Schweigen erlaubte ihm, auszuholen. »Wir haben jetzt die einmalige Chance, diesen Killer aus dem Verkehr zu ziehen«, sprach er eindringlich weiter, »aber die Zeit läuft uns davon, Professor.«
»Uns nicht«, brummte der Mediziner.
Der Hinweis auf einen Serientäter gab ihm offenbar doch zu denken. Er winkte ihn schweigend in ein angrenzendes Büro.
»Klären Sie mich auf«, verlangte er, sobald die Tür geschlossen war.
Mike schüttelte den Kopf. »Das ist Verschlusssache, und ich habe keine Zeit für lange Erklärungen, tut mir leid. Wenn Sie an der Dringlichkeit zweifeln, rufen wir meine Chefin in Bern an.« Mike verzog das Gesicht, als ekle es ihn, von der Chefin zu sprechen, und fügte an: »Sie ist allerdings sehr nachtragend. Das könnte für uns beide zum Problem werden.«
Der Professor horchte auf. »Wer ist denn Ihre Chefin?« Bevor Mike antworten konnte, winkte er ab. »Vergessen Sie es.«
Seine Miene glich jetzt Mikes Gesicht. Mike glaubte, einen unterdrückten Fluch und das Schimpfwort Weiber zu hören. Althaus ging zur Tür.
»Kommen Sie, sehen wir, was Ihre Leiche uns zu sagen hat.«
Die Assistentin beeilte sich, einen Tisch freizumachen für seinen Fall. Mike half ihr, den Leichnam des toten Journalisten auf den Metalltisch zu heben. Der Mann aus Wien war kein Leichtgewicht. Die beiden begannen mit den Vorbereitungen. Mike wollte sich diskret verdrücken, da stoppte ihn der Befehl des Professors.
»Hier geblieben! Sie wollten doch schnelle Ergebnisse.«
Mike dankte dem Schicksal, das ihn an diesem Morgen am Frühstücken gehindert hatte. Wo nichts drin ist, kommt nichts raus, sagte er sich. Er sollte sich täuschen. Die äußere Untersuchung überstand er locker, und die lieferte schon interessante Ergebnisse.
»Sehen Sie die Punkte auf der Brust?«, fragte Althaus, ohne die Arbeit zu unterbrechen. »Kommen Sie ruhig näher, oder besitzen Sie Adleraugen?«
»Einstiche?«, fragte Mike unsicher.
»So etwas Ähnliches. Was meinen Sie, Fräulein Betschart?«
Mike stutzte. Er hatte das verpönte Wort seit Jahren nicht mehr gehört. Professor Althaus schien sich keinen Deut um politische Korrektheit zu scheren, was ihn schon beinahe sympathisch erscheinen ließ. Fräulein Betschart wusste eine Antwort, die dem Chef gefiel.
»Das sind typische Merkmale des Kontakts mit einem Elektroschocker«, erklärte sie so sicher, als wäre sie dabei gewesen.
»Sehen Sie«, sagte Althaus lächelnd, »schon hat uns der Leichnam einen Hinweis gegeben.«
Dem Arzt, der den Totenschein ausgestellt hatte, waren die zwei nahe beieinander liegenden roten Flecke offenbar nicht aufgefallen. Einmal mehr dachte Mike mit Bewunderung an die junge Polizistin in Andermatt, die das Haar entdeckt hatte.
»Ein Taser-Angriff«, sagte er nachdenklich. »War das die Todesursache?«
Die Frage trug ihm nichts als verächtliche Blicke von beiden ein. Althaus nickte der Assistentin zu. Die griff zur Fräse, um den Brustkorb zu öffnen.
»Sehen wir nach, wie viel Wasser sich in der Lunge befindet«, kommentierte der Professor.
Das reichte. Mike rannte zur Toilette, um auszukotzen, was er nicht gegessen hatte. Er ließ sich Zeit, kehrte erst zurück, als er keine Geräusche unappetitlicher Maschinen mehr hörte.
»Besser?«, fragte Althaus mit einer Grimasse, die wohl grinsen andeuten sollte. Er trat vom Tisch zurück. »Fräulein Betschart, Zusammenfassung, kurz bitte!«
Als hätte sie in der letzten halben Stunde nichts anderes getan, als sich grammatikalisch einwandfreie Sätze zurechtzulegen, berichtete sie in fließendem Mediziner-Deutsch, was sie gefunden hatten. Mike verstand kaum die Hälfte, aber es genügte, um sich ein Bild zu machen.
»Habe ich das jetzt richtig verstanden?«, fragte er. »Der Mann wurde mit dem Taser bewegungsunfähig gemacht, als er schon nackt in der Badewanne lag, und dann ertränkt?«
»So kann man es auch ausdrücken«, bestätigte Althaus.
»Es war also kein Benzi …«
»Benzodiazepin? Schlaftabletten? Das wissen wir noch nicht. Die toxikologische Untersuchung wird es zeigen, aber notwendig waren Betäubungsmittel auf keinen Fall, um den Tod herbeizuführen.«
Die Assistentin beeilte sich, zu versichern:
»Wir haben keinerlei Rückstände im Verdauungstrakt festgestellt.«
Das hätte sie besser für sich behalten. Wörter wie Verdauungstrakt waren nicht hilfreich in Mikes labilem Zustand.
»Er ist also gelähmt aber bei vollem Bewusstsein ertränkt worden«, fasste er noch einmal dumpf zusammen.
Althaus nickte. »Oder so.«
Es gab zwei weitere Fälle, in denen ein Elektroschocker eingesetzt worden war, um das Opfer zu lähmen, beide in Deutschland, soweit er sich erinnerte. Dieser Killer bewegte sich frei in halb Europa, um potente politische Gegner der Rechten auszuschalten. Der Fall war definitiv ein paar Nummern zu groß für den einsamen Wolf Mike Matter. Er griff zum Telefon.
WIESBADEN
»Ich habe Ihren famosen Fiat gar nicht gesehen in der Garage«, sagte Chris verwundert zum Assistenten und frisch gebackenen Kommissar Joshi Tanaka, kaum hatte sie sich gesetzt. »Leisten Sie sich jetzt ein größeres Vehikel nach der Beförderung?«
Der junge Mann mit dem Aussehen eines Japaners und dem Dialekt eines waschechten Berliners reagierte gekränkt.
»Sie sollten mich inzwischen besser kennen«, brummte er. »Der Prima ist in der Garage.«
»Offensichtlich nicht in unserer Garage«, lachte sie. »Ist er krank? Was fehlt ihm denn?«
»Die Parksensoren sind ausgefallen.«
»Ach so, nicht schlimm. Ich benutze die nie.«
»Das habe ich bemerkt«, murmelte er leise aber gerade laut genug, dass sie es hören musste.
Der gute Joshi wurde übermütig, um nicht zu sagen frech. Sie überlegte sich, wie sie angemessen reagieren könnte, als ihr Telefon klingelte. Unterdrückte Rufnummer. Sie hob trotzdem ab. Die Männerstimme am andern Ende sorgte augenblicklich für einen Adrenalinschub. Erinnerungen an den verheerenden Anschlag in der Schweiz wurden lebendig.
»Mike Matter!«, rief sie beinah ins Telefon. »Ich fürchtete schon …«
»Ich sei diesmal wirklich gestorben?« Er lachte trocken auf. »Ist mir noch nicht gelungen.«
»Ich bin erleichtert. In welches Schlamassel willst du mich diesmal reinreiten?«
»Hör mal!«, rief er entrüstet. »Wer hat denn hier wen in die Scheiße geritten?« Er ließ ihr keine Zeit zu antworten, sprach rasch in ernstem Ton weiter. »Es gibt ein ziemlich großes Problem, glaube ich.«
»Ich höre. Warte, ich stelle dich auf Lautsprecher, damit mein Kollege mithören kann.«
»Ich arbeite jetzt als Verbindungsoffizier der Schweiz bei Europol«, begann er.
Sie war versucht, eine sarkastische Bemerkung über den Bürojob einzuwerfen, hielt sich aber zurück. Er fuhr fort:
»Wir sind seit gut zwei Jahren an einem außerordentlich heiklen Fall dran, eigentlich an elf Fällen, die aber alle zusammenhängen.«
»Wieso heikel?«, fragte Joshi.
»Ich komme gleich dazu. Es geht um Mordfälle in verschiedenen Bundesländern in Deutschland und Österreich – und jetzt auch in der Schweiz in einem kleinen Bergdorf am Gotthard. In allen Fällen handelt es sich um unaufgeklärte Morde an Politikerinnen und Politikern aus dem links-grünen Lager.«
Warum weiß ich nichts davon?, fragte sie sich betroffen. Mike beantwortete die unausgesprochene Frage.
»Es scheint, dass wir bei Europol die einzigen sind, denen ein Zusammenhang aufgefallen ist. Die Fälle wurden bisher einzeln und unabhängig voneinander von lokalen Behörden bearbeitet, aber damit ist jetzt Schluss.«
»Lass mich raten«, unterbrach sie, »ihr habt noch weitere Gemeinsamkeiten festgestellt.«
»Du sagst es. Um genau zu sein, ich habe sie entdeckt.«
»Gehört der Fall Gerlach in Berlin auch dazu?«, fragte Joshi.
»Gerlach, richtig, die Spitzenkandidatin für den Senat«, antwortete Mike düster. »Sie war eine gemäßigte Grüne, Realpolitikerin. Jetzt sitzt ein Rechtsaußen auf ihrem Platz.«
»Was macht dich so sicher, dass die Fälle zusammenhängen?«, fragte sie zunehmend beunruhigt.
»DNA. Bei sechs Fällen ist nachgewiesen, dass dieselbe Fremd-DNA am Tatort aufgetaucht ist, höchstwahrscheinlich vom Täter hinterlassen. Bei allen wurden blonde Haare mit dieser DNA sichergestellt. Ein gleiches Haar ist jetzt auch in der Schweiz aufgetaucht bei einem toten Journalisten.«
»Das sind allerdings starke Hinweise«, murmelte Chris. »Was ist mit den anderen Fällen? Elf sagtest du?«
»Zwölf mit dem Mord in Andermatt.«
Mike legte seine Argumente dar. Sie musste ihm zustimmen. Vieles deutete darauf hin, dass sie es mit einem international operierenden Serientäter zu tun hatten.
»Ich kann nicht glauben, dass ein Einzeltäter für all das verantwortlich sein soll«, warf sie ein.
Mike stimmte ihr zu. »Ich auch nicht, aber die bis jetzt vorliegenden Fakten belegen, dass derselbe Täter zumindest an allen Morden beteiligt war.«
»Bei sieben von zwölf«, gab Joshi zu bedenken.
»Vorderhand«, bestätigte Mike. »Aus diesem Grund rufe ich an. Ich denke, das ist eindeutig ein Fall fürs BKA. Könnt ihr euch bitte um die restlichen drei Taten kümmern, die in Deutschland begangen wurden? Ich werde inzwischen das BKA in Österreich einschalten. Zwei ungelöste Fälle gab es in Wien und Linz.«
»Du bist gut!«, platzte sie heraus. »Wenn alles stimmt, was du da von dir gibst, ist es nichts anderes als Terrorismus und ein Fall für die Bundesanwaltschaft. Da wird schweres Geschütz aufgefahren.«
»Ist mir klar, und ich weiß auch, dass du einen besonderen Draht zu Generalbundesanwalt Osterhagen hast.«
»Geht so«, murmelte sie.
Während sie versuchte, in Joshis Anwesenheit nicht zu erröten, antwortete der Assistent:
»Schicken Sie uns die Akten. Wir werden sehen, was wir tun können.«
Nachdem sie aufgelegt hatte, äffte sie seinen letzten Satz nach, gefolgt von der Bemerkung:
»Als hätten wir nichts anderes zu tun.«
Joshi sah sie betroffen an. »Ich dachte, es wäre in Ihrem Sinn. Wenn was dran ist, übergeben wir das Dossier der Bundesanwaltschaft. Wir verfügen ja über kurze Wege.«
»Oh na klar, Sie verfügen über kurze Wege«, schnaubte sie. »Osterhagen ist Ihr netter Onkel und verheiratet mit Ihrem Vater. Hätte ich beinah vergessen. So bleibt es in der Familie.«
Sie hatte nichts daran auszusetzen, ärgerte sich bloß über sich selbst beim Stichwort Osterhagen, aber das war eine ganz andere Geschichte.
»Wir suchen also einen blonden Serienkiller mit Haarausfall«, nahm Joshi den Faden wieder auf.
Die Zusammenfassung reizte sie zum Lachen. Im Moment sah es tatsächlich danach aus. Nach kurzer Überlegung fasste sie einen Entschluss.
»Wir machen Folgendes«, sagte sie. »Sammeln Sie alle Informationen über die zwölf Fälle, sobald wir Mikes Akten haben. Das ist noch keine offizielle BKA-Ermittlung. Bleiben wir also unter dem Radar, bis wir mehr wissen.«
Joshi verzog das Gesicht. »Das dürfte schwierig werden. Recherchen im BKA-Netzwerk sind praktisch für jedermann im Haus sichtbar.«
»Ihre KI wird Ihnen sicher helfen, das Darknet auch.«
»Die KI ist in der Garage, sagte ich doch.«
Joshis künstliche Intelligenz lebte auf einem Server in seinem Fiat. Das Programm verhielt sich wie ein mit dem gesamten bekannten und weniger bekannten Internet verdrahteter Mensch. Selbst sie war schon darauf hereingefallen, hatte geglaubt, mit Joshi zu telefonieren, aber mit einem verdammten Computerprogramm gesprochen.
»Ihnen wird schon etwas einfallen«, sagte sie und loggte sich endlich in den Computer ein.
***
Am nächsten Morgen glaubte Joshi allmählich zu verstehen, was die blonden Haare bedeuteten, während er Mikes Akten studierte. Der Täter litt keineswegs an Haarausfall. Die sorgsam platzierten Beweise waren sein Markenzeichen. Die Ermittler sollten wissen, wie weit sich sein Revier erstreckte, dass es keine Grenzen gab für ihn, und dass er sich vollkommen sicher fühlte. Ein skrupelloser Serientäter, kein Zweifel, und doch verhielt er sich atypisch. Weder die Art seiner Gewaltverbrechen noch die zeitliche Abfolge der Taten entsprachen dem Muster eines manischen Psychopathen. Die Tötungsarten variierten von Messerstichen über Insulin-Injektionen bis zum Ertränken in der Badewanne. Einmal hatte der Täter einen Revolver benutzt, um einen missliebigen Politiker hinzurichten. Die Waffe war nicht registriert und konnte nicht zurückverfolgt werden. Der Täter gab sich keine Blöße. Niemand hatte ihn gesehen, höchstens seinen Schatten wie in Andermatt. Schatten, dachte er, eine treffende Bezeichnung. Noch eine Besonderheit fiel auf. Bei drei Opfern war nachgewiesen worden, dass sie unmittelbar vor der Tat Nachrichten mit Todesdrohungen erhalten hatten. Auch die konnten die betroffenen Landeskriminalämter nicht zurückverfolgen. Der Täter benutzte ein unregistriertes Prepaidhandy wahrscheinlich osteuropäischer Herkunft. Joshi schob die Akten seufzend beiseite, um sich auf die Befragung von Kollegen aus vier betroffenen Bundesländern zu konzentrieren. Einfache Fragen nach blonden Haaren und Drohungen, und doch fürchtete er, auf Granit zu beißen. Kollegen vom LKA reagierten oft empfindlich auf hartnäckige Fragen des BKA. Zwei Stunden später gab er auf. Er hatte sich nicht getäuscht. Die lokalen Ermittler waren natürlich alles Profis und wollten nichts übersehen haben. Das Ergebnis der frustrierenden Befragung bestand einzig darin, dass ein zweiter Berg Akten auf seinem Tisch lag, die nur bestätigten, was Mike schon gewusst hatte. So kam er nicht weiter. Er trank seinen grünen Tee aus und verließ das Büro ohne Kommentar.
Die Servicewerkstätte, wo sein Fiat gewartet wurde, befand sich einen Spaziergang von zwanzig Minuten entfernt, ideal, um den Kopf freizubekommen. Der Mechatroniker empfing ihn mit gestresstem Gesichtsausdruck.
»Ich wollte Ihnen gerade Bescheid geben«, entschuldigte er sich ungefragt.
»Bescheid worüber?«
»Die haben das falsche Teil geliefert. Das richtige Ersatzteil sollte heute Nachmittag gegen vier eintreffen. Der Wagen wird dann sicher noch bis Feierabend fertig.«
Kommt auf die Definition von Feierabend an, lag ihm auf der Zunge.
»Hoffen wir, dass es klappt«, antwortete er nur, »aber deswegen bin ich nicht hier. Ich muss etwas mit ihm besprechen.«
»Der Chef ist nicht da.«
»Nicht mit dem Chef, mit dem Auto.«
Dem Arbeiter klappte der Kiefer herunter. Sprachlos sah er zu, wie Joshi sich in den Fiat setzte und auf den Knopf drückte, um die Elektronik zu aktivieren. Der gute Mann blieb wie angewurzelt stehen, als er zu sprechen begann und das Auto ohne Verzögerung antwortete. Joshi fuhr die Scheibe am Seitenfenster hoch mit der Bemerkung:
»Sorry, ist privat.«
»Hallo Joshi, lange nicht gesehen«, sagte die KI.
»Machst du Witze? Du stehst gerade mal vierundzwanzig Stunden in dieser Garage.«
»25 Stunden 19 Minuten und 42 Sekunden«, korrigierte das pingelige Programm. »Mir gefällt es hier nicht.«
»Mir auch nicht«, gab Joshi unwirsch zurück, »aber das ist nicht der Punkt. Ich brauche deine Hilfe.«
»Dachte ich mir schon.«
Joshi staunte immer wieder über die vorlaute KI. Die Programmierer in Fernost mussten sie mit Unmengen an Unterhaltungen krankhaft zickiger Typen trainiert haben. Anders konnte er sich ein solches Verhalten nicht erklären.
»Schieß los«, forderte die KI ihn auf, als stünde sie unter Zeitdruck, nicht er.
»Es geht um Mordfälle an Politikerinnen und Politikern aus dem links-grünen Lager«, begann er.
Die KI unterbrach ihn sofort. »Wie im Fall Gerlach in Berlin?«
»Ganz genau, das ist einer der zwölf Fälle, die in den letzten zwei Jahren passiert sind. Keiner der Mordfälle ist bisher aufgeklärt worden. Ich will jetzt wissen, ob es weitere Muster gibt, welche diese Fälle miteinander verbinden. Ich meine weitere Gemeinsamkeiten neben der Tatsache, dass es sich bei den Opfern in Deutschland samt und sonders um links-grüne politische Schwergewichte handelt.«
»Dazu müsste ich alle Namen kennen.«
»Nur nicht hetzen!«, sagte er gereizt.
Er zählte die Namen der Opfer mit den wichtigsten Daten aus ihrem Umfeld auf und wartete. Die KI erledigte solche Hintergrundrecherchen in einem Bruchteil der Zeit, die er einsetzen müsste. Es dauerte denn auch kaum fünf Minuten, bis er eine Antwort bekam.
»Es gibt ein Muster, das du bisher nicht, oder sagen wir, zu wenig beachtet hast«, sagte die KI.
Hörte er einen vorwurfsvollen Unterton heraus?
»Das wäre?«, antwortete er mürrisch.
»Sei nicht gleich beleidigt. Menschen übersehen manchmal etwas.«
»Im Gegensatz zu blöden Maschinen, meinst du?«
»Lassen wir das«, sagte die KI ruhig. »Es geht um Folgendes. Der Tod der bekannten Opfer hat jedes Mal ein kleines politisches Erdbeben ausgelöst und das Ergebnis der Wahlen im letzten Moment zugunsten der Rechtskonservativen gedreht. Da habe ich mich gefragt …«
»Ob es noch weitere Fälle gegeben hat?«, fuhr Joshi elektrisiert dazwischen.
»Du sagst es.«
»Und? Lass dir nicht jedes Wort aus der Nase kitzeln!«
»Ich besitze keine Nase.«
»Darum geht es jetzt nicht, und überdies ist der Ausdruck eine Metapher, falls du weißt, was das bedeutet.«
»Eine Metapher ist …«
»Klappe!«, schnaubte Joshi. »Rück endlich heraus mit der Sprache. Gibt es weitere Fälle?«
»Vielleicht.«
»Was soll das jetzt wieder heißen? Du treibst mich in den Wahnsinn!«
Der Mechatroniker klopfte vorsichtig an die Scheibe.
»Ich müsste dann mal ins Auto«, sagte er, sich misstrauisch umsehend.
»Gleich«, erwiderte er ungeduldig. »Geben Sie mir noch fünf Minuten.«
»Können wir wieder?«, fragte die KI, nachdem das Seitenfenster wieder geschlossen war.
»Schieß los.«
»Endlich! Also, bisher ist mir ein weiterer möglicher Fall aufgefallen, der die Wahl in Dresden entscheidend beeinflusst hat. Es gibt nur ein Problem dabei. Der Politiker Arne Wulf, um den es geht, soll eines natürlichen Todes gestorben sein.«
Das musste gar nichts bedeuten, dachte Joshi aufgeregt. Vielleicht sollte jemand einfach genauer hinsehen.
»Gut, schick mir die Daten aufs Handy, und suche mir die nächsten Verbindungen nach Dresden heraus.«
DRESDEN
Kurz nach 20 Uhr stand er vor dem Haus an der Elbe nahe der Blauen Brücke, wo der Verstorbene gewohnt hatte. Nach seinen Informationen lebte nur noch die Witwe im Erdgeschoss. Er wusste, dass es nicht die feine Art war, abends um diese Uhrzeit unangemeldet an einem Ort der Trauer aufzutauchen, um quälende Fragen zu stellen, aber es musste sein. Ein junger Mann um die zwanzig öffnete auf sein Klingeln. Joshi sah ihm an, dass er ihm die Tür am liebsten vor der Nase zuschlagen würde. Der Dienstausweis des BKA hinderte ihn daran.
»Was wünschen Sie?«, fragte der Mann verwundert.
»Ich möchte mit Frau Wulf sprechen. Sie wohnt doch hier?«
Das Gesicht des Mannes verdüsterte sich, als er antwortete:
»Meiner Mutter geht es nicht gut. Vater ist vor Kurzem verstorben.«
Joshi nickte und zeigte sein mitfühlendes Gesicht.
»Ich weiß, deshalb bin ich hier. Es sind einige Fragen aufgetaucht. Darf ich eintreten?«
Der Mann rührte sich nicht.
»Fragen zum Tod des Vaters? Warum?«
»Das möchte ich gerne mit Ihrer Mutter besprechen.« Er trat einen Schritt vor. »Darf ich?«
Der Sohn entschuldigte sich und ließ ihn eintreten. Die Witwe des verstorbenen Politikers saß auf einem viel zu großen Sofa vor dem Fernseher, hagere Gestalt, Gesichtszüge eingefallen und blass, eine leidende alte Frau von 48 Jahren. Der Sohn schaltete den Fernseher aus, den sowieso niemand beachtete, sprach kurz mit der Mutter und wollte sich dann zurückziehen.
»Bleiben Sie ruhig«, sagte Joshi. »Die Angelegenheit betrifft die ganze Familie.«
Er begann behutsam, die Fragen zu stellen, die er sich während der langen Fahrt im Zug zurechtgelegt hatte. Er kannte die offizielle Todesursache, fragte aber dennoch danach. Plötzlicher Herzstillstand beim Wandern entlang der Elbe, hatten die Medien berichtet.
»Hatte Ihr Mann Herzprobleme oder andere Vorerkrankungen?«, fragte er, obwohl er die Antwort kannte.
Der Sohn antwortete anstelle der apathisch wirkenden Mutter.
»Keine Spur«, sagte der junge Mann, »Vater war kerngesund. Das wird Ihnen sein Hausarzt bestätigen. Warum diese Frage?«
Joshi ließ sich nicht beirren. Plötzlicher Herzstillstand bei gesunden Menschen ist zwar möglich, wusste er, aber äußerst unwahrscheinlich. Er musste weiter fragen.
»Gab es Auffälligkeiten in Herrn Wulfs Verhalten vor seinem Tod? War er unruhig, nervös, fühlte er sich vielleicht bedroht?«
Der Sohn sah ihn mit großen Augen an, dann seine Mutter, die nicht reagierte.
»Mama?«
Sie antwortete mit schwacher Stimme.
»Es war ein Schock. Ich bin müde. Ich muss mich hinlegen.«
Joshi sah enttäuscht zu, wie sie der Sohn hinausführte. Die Reise nach Dresden musste wohl als Misserfolg verbucht werden. Bereit zu gehen, hielt ihn der Sohn zurück, als er ins Wohnzimmer zurückkehrte.
»Glauben Sie, Vater sei keines natürlichen Todes gestorben?«
»Das ist die Frage, die wir uns stellen«, antwortete Joshi ohne Umschweife. »Ihr Vater hatte großen politischen Einfluss. Lassen Sie mich Klartext reden. Arne Wulfs Tod kam den politischen Gegnern sehr gelegen, nicht wahr?«
Er hatte einen empfindlichen Nerv getroffen. Der Sohn stimmte sofort zu.
»Das ist uns auch aufgefallen«, gab er zähneknirschend zu, »aber die Todesursache wurde einwandfrei festgestellt.«
»Na ja«, antwortete Joshi nachdenklich, »es gab keine Obduktion.«
»Es gab keinen Anlass – und jetzt ist es zu spät. Der Leichnam wurde eingeäschert.«
Eine Weile herrschte betretenes Schweigen, bis der Sohn unvermittelt fragte:
»Wie wäre so etwas denn überhaupt möglich? Einen Herzstillstand vorzutäuschen, ohne Spuren zu hinterlassen?«
Joshi lächelte bitter. »Wer sagt, dass es keine Spuren gab?«
Wie auch immer, es war müßig, darüber zu spekulieren.
»Sie haben also auch nichts von irgendwelchen Drohungen vor dem Tod des Vaters mitbekommen?«, fragte er noch einmal.
Der Sohn lachte kurz auf. »Drohungen gab es haufenweise, wie Sie sich denken können. Facebook und Twitter sind voll davon. Vater hat die nie ernst genommen. Politiker von seinem Schlag haben dicke Haut.«
»Sein Handy ist nicht zufällig noch in Ihrem Besitz?«
Der Sohn schüttelte den Kopf. »Alles, was noch da ist, befindet sich in seinem Büro. Er hat oft von zu Hause aus gearbeitet.«
Joshis Herz vollführte einen Freudensprung. Es gab wieder Hoffnung. Der Sohn geleitete ihn ins Zimmer, das seit dem Tod des Vaters niemand mehr betreten hatte. Joshi streifte Silikonhandschuhe über und begann mit der Suche. Bald stellte er fest, dass nicht alle Drohungen spurlos an Arne Wulf abgeprallt waren. Es gab eine Schachtel im Schreibtisch, die mehr als ein Dutzend anonyme Drohbriefe enthielt, die offenbar alle direkt ohne Umweg über die Post im Briefkasten des Politikers gelandet waren. Joshi öffnete vorsichtig einen nach dem andern. Zwei Umschläge lagen noch in der Schachtel, als der Text des drittletzten Drohbriefs ihn stutzig machte. Die Wortwahl kam ihm bekannt vor. Er sah genauer nach im Umschlag und wusste, weshalb. Behutsam zog er das blonde Haar heraus und ließ es in einen Plastikbeutel fallen.
»Herr Wulf«, sagte er zum Sohn, »ich denke, wir haben den Beweis. Ihr Vater ist höchstwahrscheinlich einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen.«
Dresden also auch. Wie viele unentdeckte Morde hatte der Schatten noch begangen?
KAPITEL 2
WIEN
Für Toni Gruber war die Welt in Ordnung. Im Nachhinein fand er es sogar O. K., dass die Tschechen ihn zur Freude der andern Arbeiter auf der Baustelle Antonia nannten. Im Vergleich zu jenen sah er wirklich aus wie ein feingliedriges Mädchen. Antonia war also in Ordnung, heute sowieso. Er sah auf den gelben Umschlag in seiner Hand. Kaum zu glauben, dachte er. Im 21. Jahrhundert erhielt er den Lohn in Form von Bargeld in einer gelben Tüte wie seinerzeit sein Großvater, der Zimmermann. Der erste Lohn als Baggerführer! Er war stolz darauf. Toni, der Artist mit der Baggerschaufel, die er mit sicherer Hand noch dorthin platzierte, wo andere längst aufgegeben hätten. Das sollten ihm die Maulwürfe mit den Muckis erst einmal nachmachen. Die Lohntüte inspirierte ihn, besonders der Inhalt.
»He, Leute, ich gebe einen aus«, rief er den Kumpels zu, die sich in der Garderobe umzuziehen begannen. »Wer ist dabei?«
Er rechnete mit dreien oder vieren. Zehn durstige Seelen folgten ihm in die Kneipe. Gute Stimmung war eben nicht billig zu haben. Was soll’s, dachte er, es lohnt sich bestimmt. Das Bier, geliefert im Sechzehnerblech, wie es sich gehörte, löste auch die letzte Zunge. Im Durcheinander osteuropäischer Sprachen verstand er nur Wortfetzen. Dennoch bemerkte er, dass sich das Gespräch an seinem Tisch um ihn drehte. Der Tscheche Janek, dessen Hobby Bodybuilding sein musste, wandte sich schließlich an ihn, indem er ihm einen schmerzhaften Hieb auf den Bizeps versetzte.
»Sag mal, Antonia, was hast du angestellt, dass ein Mädchen wie du auf dem Bau gelandet ist?«
»Ist doch eine tolle Arbeit, und sie wird gut bezahlt.«
Die Runde fand das urkomisch.
»Ja ja«, sagte Janek, »die Arbeit ist toll aber doch nichts für Mädchen.«
»Leute!«, rief Toni aus. »Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Ich bin ein Junge wie ihr, seht her!«
Schon stand er auf seinem Stuhl, Schniedel für alle sichtbar aus der Hose hängend. Kurz herrschte Totenstille im Lokal, dann brach Gelächter mit solcher Gewalt los, dass die Wirtin entsetzt aus der Küche herbeieilte. Sein Gemächt steckte wieder dort, wo es hingehörte, bevor sie es sah.
»Was ist hier los?«, fragte sie mit strengem Blick.
Janek antwortete:
»Antonia ist ein Junge.«
Und wieder krachte das Gebälk. Die Wirtin zog sich kopfschüttelnd zurück, nachdem sie sich versichert hatte, dass nichts zu Bruch gegangen war. Die gute Stimmung hielt an, und doch hatte sie sich verändert. Der Eindruck, jetzt ernst genommen zu werden, verstärkte sich, als Janek ihm zuprostete und ganz ohne ironischen Unterton fragte:
»Jetzt mal im Ernst, Toni, was hat einer wie du auf den Bau zu suchen?«
»Mir gefällt’s.«
»Das sagtest du schon, aber man sieht dir doch von Weitem an, dass du eher in die Uni gehörst als auf einen Bagger.«
Sollte er wirklich darüber sprechen? Unsicher blickte er in die Runde. Die Kumpels warteten interessiert auf eine Antwort.
»Also gut, wenn ihr es unbedingt wissen wollt«, sagte er, »auf der Uni bin ich schon gewesen.«
»Dr. Baggerführer!«, rief einer.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, kein Doktor. Ich habe ein paar Semester Informatik studiert, bis es mir zu blöd wurde.«
»Bist du verrückt, Junge?«, fuhr Janek ihn an. »Meine Alena will das auch studieren, Computer und so, dann verdient sie später zehnmal so viel wie der Papa. Und du wirfst das einfach weg?«
»Geld ist nicht wichtig«, winkte Toni ab, »wenn es zum Leben reicht, dann reicht’s.«
»Sagt der Junge, dem Papa das Studium bezahlt hat«, brummte einer mit halber Semmel im Mund.
Die Unterhaltung drehte sich in eine Richtung, die ihm gar nicht behagte.
»Mein Alter hat nichts damit zu tun«, antwortete er unwirsch. »Ich bekam ein Stipendium.«
»Oh, ein Siebengscheiter«, kommentierte der österreichische Bauführer aus Sankt Pölten, der sonst kaum je etwas sagte, wenn er nicht gerade jemanden anschrie.