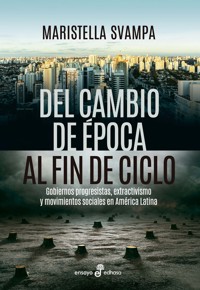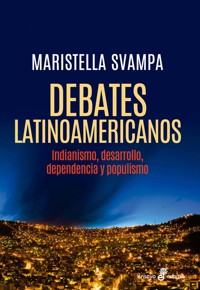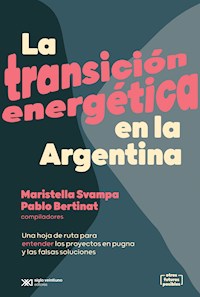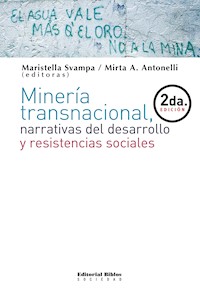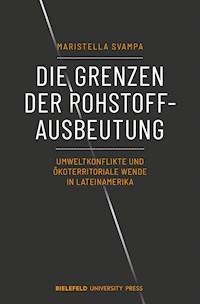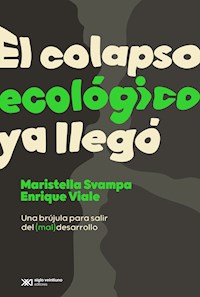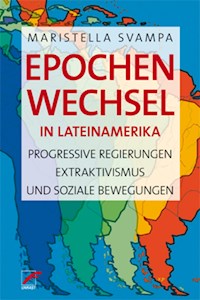
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Progressive Regierungen, Extraktivismus und soziale Bewegungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für Carlos J.
In Erinnerung an Andrés Carrasco und Javier Rodriguez Pardo
Maristella Svampa, Soziologin aus Argentinien, ist eine der bekanntesten Linksintellektuellen aus Lateinamerika, Autorin zahlreicher Bücher, unter anderem zu den Piqueter*-Bewegungen, zu neoliberaler Stadtentwicklung sowie den Auswirkungen des neo-extraktivistischen Modells in Argentinien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Sie ist aktuell Koordinatorin von GECIPE (Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética), einer Gruppe, die sich interdisziplinär mit den Möglichkeiten und Herausforderungen einer postfossilen Energiewende auseinandersetzt.
Maristella Svampa
Epochenwechsel in Lateinamerika
Progressive Regierungen, Extraktivismus und soziale Bewegungen
Herausgegeben und aus dem Spanischen übersetzt von María Cárdenas
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Maristella Svampa:
Epochenwechsel in Lateinamerika
1. Auflage, August 2020
eBook UNRAST Verlag, Januar 2022
ISBN 978-3-95405-082-6
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Copyright der Originalausgabe:
Maristella Svampa: Del cambio de época al fin de ciclo:
gobiernos progresistas, extractivismo, y movimientos sociales
en América Latina, Edhasa 2017
Herausgegeben und aus dem Spanischen übersetzt von María Cárdenas
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: kv, Berlin
Satz: Andreas Hollender, Köln
Inhalt
Vorwort der Herausgeberin zur deutschen Ausgabe: Vom Ende eines progressiven Zyklus, dem Aufstieg rechter Regierungen und Möglichkeiten solidarischen Widerstands ›von unten‹
Einleitung
Das post-progressive Szenario in Lateinamerika
Das Versagen der progressiven Regierungen und der Mythos ihrer linken Gesinnung
Das koloniale Erbe des Rohstoffkonsenses und der Mythos von ›El Dorado‹
Gewalt und Intersektionalität in Lateinamerika
Widerstand und kollektives Handeln
Fazit: Epochenwechsel – Lektionen für ein ›bewegte Gesellschaft‹
Einleitung. Ende eines Zyklus
Der Aufbau des Buchs
ERSTER TEILProgressivismus, neuer Zyklus kollektiven Handelns und die Expansion des Extraktivismus
Soziale Bewegungen, politische Traditionen und Dimensionen des kollektiven Handelns in Lateinamerika
Vom Protest zu den sozialen Bewegungen
Eine Annäherung an die politisch-ideologischen Matrices
Drei Dimensionen des kollektiven Handelns
Rohstoffkonsens und Entwicklung. Koordinaten für eine lateinamerikanische Debatte
Das lateinamerikanische Szenario
Der Rohstoffkonsens und die Wiederbelebung der populistischen Matrix
Die Idee von ›Entwicklung‹ infrage stellen
Natur und Entwicklung
Die Konsolidierung des (Fehl-)Entwicklungsmodells
Phasen des Rohstoffkonsenses und Konflikte
Sozio-ökologische Konflikte, öko-territoriale Wende und lateinamerikanische Alternativen
Die Ausweitung des sozio-ökologischen Konflikts
Die öko-territoriale Wende der sozialen Kämpfe
Gibt es eine Alternative?
Übergang und Öffentliche Politik
Feminismos Populares, Extraktivismus und Patriarchat im Rohstoffkonsens
Einleitung
Frauen in der Führungsrolle: Doppeldeutigkeit und Fortschritte
Feminismos Populares aus dem Globalen Süden
Das andere Gesicht des Patriarchats: Extraktivismus und Ketten der Gewalt
Die Neugestaltung des Nord-Süd-Gefälles – Ein Blick aus der Extraktionsgeografie
Der Aufstieg Chinas und der Globale Süden
China und Lateinamerika
Die Ausweitung der Extraktionsgeografie
ZWEITER TEILProgressivismus und das Ende eines Zyklus
Ende eines Zyklus und real existierende Progressivismen
Zwischen Armutsreduktion und Konsolidierung der Ungleichheiten
Die Kritik am Extraktivismus
Die politische Kritik: Varianten der passiven Revolution
Post-Progressivismus und emanzipatorische Horizonte in Lateinamerika
Der Durchbruch der sozialen Bewegungen und ihre Wendepunkte
Das Abdriften der real existierenden Realismen
Soziale Kämpfe und emanzipatorische Horizonte
DRITTER TEILArgentinien: Von der Parole »Weg mit ihnen!« hin zur Ära der Kirchners
Einleitung: 2001 bis 2015
Auf den Spuren vom Dezember 2001
Grundlegende Überlegungen
Drei mögliche Interpretationsformen
Die Spuren des Dezembers
Das Erwachsen einer neuen Generation des Aktivismus
Die Politik der Straße: Mobilisierungssprache und der öffentliche Raum im Argentinien der Gegenwart
Für eine neue Mobilisierungssprache (1989–2001)
Die Grammatik der Proteste und die Besetzung des öffentlichen Raums (2001)
Zwischen dem Spielerischen und dem Ereignis: Asambleas und kulturelle Kollektive
Grenzen, Rituale und die plebejische Dimension: die Piqueter*s
Konflikte und soziopolitische Umstrukturierungen während des Kirchner-Zyklus. Die Phasen des Kirchnerismus als Populismus
Soziale und ökonomische Struktur. Vom Wiedererlangen der Positionen und der Rückkehr zur ›Normalität‹
Die Transformation der Agrarstruktur
Die Dynamik der Konflikte: Von Zentren und Peripherien
Die Mittelschicht gegen die Mittelschicht. Die Verteidigung des ›Popularen‹ versus die Verteidigung der ›Republik‹
Ende des Zyklus und Bilder eines Untergangs
Nachwort
Über die Texte
Glossar
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort der Herausgeberin zur deutschen Ausgabe
Vom Ende eines progressiven Zyklus, dem Aufstieg rechter Regierungen und Möglichkeiten solidarischen Widerstands ›von unten‹.
Einleitung
Lateinamerika war in den letzten sechzig Jahren für viele Linke des Globalen Nordens die ›Wiege der Revolution‹. Die Hoffnung auf eine alternative Realität ging häufig auch mit einer gewissen Romantisierung der Kämpfe oder Unsichtbarmachung von jenen Teilen des linken Aktivismus einher, die sich außerhalb des Verständnishorizonts oder der Vorstellungskraft des Globalen Nordens befanden. Die progressiven Regierungen Lateinamerikas der letzten zwanzig Jahre bilden dabei keine Ausnahme. Angesichts der wachsenden Konflikte mit einem Großteil der sozialen Bewegungen wurde es für Linke in Europa immer schwieriger, sich zu positionieren und die Frage zu beantworten, ob progressive Regierungen nun Hoffnungsträgerinnen oder das Ende linker Regierungspolitik waren.
Das vorliegende Buch Epochenwechsel in Lateinamerika von Maristella Svampa hilft uns, Potenziale und Schwierigkeiten der sozialen emanzipatorischen Kämpfe zu identifizieren sowie die Hindernisse zu verstehen, die dazu führten, dass die Regierungen des real existierenden Progressismus ungeachtet ihrer anfänglichen Allianz mit den sozialen Bewegungen eher ein Mythos blieben, als dass sie eine linksalternative Politik machten, von der das Gros ihrer Gesellschaft profitieren konnte. Hierfür bietet Svampa eine beeindruckende und umfassende Analyse des lateinamerikanischen Kontinents und der ihm innewohnenden Verflechtungen zwischen Ökonomie, politischen Traditionen und den Möglichkeiten und Grenzen kollektiven emanzipatorischen Handelns an und bezieht sowohl makroökonomische Analysen, internationale Wirtschaftstrends und Handelsbeziehungen als auch die Grassroots-Ebene und lokale Fallbeispiele an. Zur Sprache kommen dabei ebenso lokale, ländliche Umweltbewegungen, die den Kampf gegen multinationale Erdöl-Konzerne aufnehmen, wie die politische Kraft vermeintlich ›braver‹ Bevölkerungsgruppen und das Mobilisierungspotenzial basisdemokratischer und kreativer Protestformen. Aber auch jene Dynamiken werden ins Licht gerückt, die die Umsetzung alternativer Politikformen auf nationaler und lokaler Ebene erschweren: die internationale Wirtschafts- und Finanzordnung, die postkolonialen Wirtschaftsstrukturen lateinamerikanischer Länder, autoritär-populistische Traditionen und das unnachgiebige Streben nach Machterhalt führender Politiker*innen.
Diese Sprünge zwischen lokaler und internationaler Ebene, zwischen Ländern, zwischen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Dynamiken einerseits und diskursiven, strukturellen, phänomenologischen Dynamiken andererseits können manchmal eine Herausforderung sein, sie machen aber gerade auch die Stärke ihres Buches aus. Sie erlauben es, die Interdependenzen dieser unterschiedlichen Ebenen sowie die Ursachen der aktuellen politischen Umbrüche in Lateinamerika – und auch anderswo – zu erfassen und hieraus Veränderungspotenzial abzuleiten.
Das folgende Vorwort soll dazu dienen, die zentralen Aussagen des Buchs von Maristella Svampa in das aktuelle Geschehen einzubetten und einzuordnen. Hierfür werde ich zunächst eine gesellschaftspolitische Einordnung des Buchs vornehmen und mit den aktuellen Trends auf dem lateinamerikanischen Kontinent verknüpfen, um dann vier von mir als zentral erachtete Thesen des vorliegenden Buches zu diskutieren. Zudem habe ich das spanische Original um ein Glossar am Ende des Buches ergänzt, um die Leser*innen beim Verständnis der bisweilen geografischen, zeitlichen, theoretischen und disziplinären Vielfalt zu unterstützen. Ebenso werden im Glossar einige Begriffe, die im Original beibehalten wurden, da eine deutsche Übersetzung m.E. unpassend oder nicht zielführend gewesen wäre, erläutert. Dies soll auch den Leser*innen, die im lateinamerikanischen Kontext (noch) weniger bewandert sind, die Lektüre zusätzlich erleichtern.
Das post-progressive Szenario in Lateinamerika[1]
Dass die progressiven Regierungen in Lateinamerika gescheitert sind, ist mittlerweile kaum noch abzustreiten.
So ist in Brasilien die soziale Gerechtigkeit wie auch die Umweltgerechtigkeit mit der 2018 begonnenen Amtszeit des rechten Hardliners Jair Bolsonaro nicht nur aufgrund von wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Maßnahmen auf dem Tiefstand, sondern auch aufgrund von Entscheidungen im kulturellen und sozialen Bereich, die neo-koloniale Realitäten schaffen.[2]
In Bolivien hatte sich Evo Morales nach der Genehmigung des Verfassungsgerichts und Entgegen der Ergebnisse eines Referendums 2019 zum vierten Mal als Präsidentschaftskandidat zur Wahl gestellt – und war wiedergewählt worden. Nach dem mittlerweile vielerorts scharf kritisierten Vorwurf der Organisation Amerikanischer Staaten zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl war Morales zunächst zurückgetreten und anschließend nach Mexiko geflohen. Die Installierung einer ›Interimsregierung‹ durch Streitkräfte und rechte Opposition und die Selbsternennung der ultrarechten Jeanine Áñez[3] als ›Interimspräsidentin‹ wurde international weitestgehend akzeptiert – auch von Deutschland. Bei den Demonstrationen gegen den Putsch kam es zu Hunderten von Verletzten und mindestens 21 Toten (Amerika21.de vom 11.03.2020). Die De-Facto-Regierung geht juristisch gegen Führungspersonen der Bewegung zum Sozialismus (Movimiento al Socialismo – MAS) vor, um sie von den für Mai anberaumten Wahlen auszuschließen und auch in diesem Land den progressiven Zyklus abzuschließen.
Mit Lenín Moreno hat zum ersten Mal nach siebzehn Jahren ein ecuadorianischer Präsident die USA besucht, um ein Handelsabkommen abzuschließen – und das unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Nach der Aufnahme weiterer Kredite des Internationalen Währungsfonds hat sich das Land zur neoliberalen und neo-extraktivistischen Politik verpflichtet, was sich unter anderem Ende Dezember 2019 im neuen Steuergesetz zur Entlastung von Unternehmen zeigte.
In Venezuela pfeift die international weitestgehend isolierte chavistische Regierung unter Maduro auch unabhängig von der parallelen ›Exilregierung‹ Juan Guaidós aus dem letzten Loch: Das Bruttoinlandsprodukt hat sich seit 2013 mehr als halbiert, die Erdölproduktion ist um mehr als ein Drittel gesunken. »Öffentliche Dienstleistungen wie Strom, Wasser, Gesundheit oder öffentlicher Nahverkehr stehen kurz vor dem Kollaps und die Hyperinflation hat sämtliche Ersparnisse und Löhne in der Landeswährung Bolívar entwertet« (Lambert, 24.01.2020).
Dass die übrig gebliebenen Bastionen des Progressivismus, Bolivien und Venezuela, vor dem Kollaps stehen und rechte Regierungen sich auf legitime und illegitime Weise konsolidieren, bedeutet wiederum nicht, dass emanzipatorisches Denken und Handeln in Lateinamerika versiegt wäre. Im Gegenteil waren wir im Jahr 2019 Zeug*innen eines Aufbegehrens der ›sociedad en movimiento‹ (Maristella Svampa in Dal Maso 2019), einer bewegten Gesellschaft, die sich die Straße zurücknimmt, um soziale und Umweltgerechtigkeit einzufordern: Seit Oktober protestieren in Chile zahlreiche Menschen jeden Freitag trotz massiver Staatsgewalt für eine verfassungsgebende Versammlung, Sozialreformen, ein Ende des Patriarchats und für die Verstaatlichung der natürlichen Ressourcen. Zahlreiche Asambleas[4] wurden zu diesem Zweck gegründet und zivilgesellschaftliche Bündnisse aufgebaut. Die Proteste in Chile schwappten unerwartet in andere Länder Lateinamerikas über, nach Ecuador, Argentinien und sogar nach Kolumbien – ein Land, in dem die zivilgesellschaftliche Linke seit Jahrzehnten verfolgt und diffamiert wird und breiter sozialer Widerstand historisch nur schwach ausgeprägt ist. Selbst hier sah sich die neoliberale Regierung unter dem ›Subpräsidenten‹ Iván Duque[5] mit einer ungeahnten Protestwelle konfrontiert.
Neu an diesen Protesten in Lateinamerika ist die breite gesellschaftliche und nun auch urbane Beteiligung und die Allianzen, die sich in diesem Rahmen gegründet haben: intergenerational, inter-ethnisch und klassenübergreifend. Die Cacerolazos in Chile schwappten nach Ecuador und Kolumbien und sogar nach Deutschland über. Seitdem haben sich zahlreiche Exilgruppen gegründet. Vielleicht ist auch deshalb in Argentinien der ›Progressivismus‹ wiedererwacht: Mauricio Macri wurde Ende 2019 von einer neuen Welle des Kirchnerismus abgelöst – diesmal unter dem Duo aus Alberto Fernández als Präsident und Christina Fernández de Kirchner als Vizepräsidentin.
Nicht zuletzt ist Lateinamerika der Kontinent mit den meisten Morden an Aktivist*innen: So fanden im Jahr 2019 177 von 304 Morden an Menschenrechtsverteidiger*innen in Lateinamerika statt – 40 % dieser Ermordeten engagierten sich für Landrechte, indigene Rechte und Umwelt (Front Line Defenders Global Analysis 2019: 4). Wir befinden uns also in einem Schlüsselmoment der Polarisierung, in dem einerseits neo-faschistische, neo-koloniale und rassistische Regierungen gewählt werden, die menschen- und naturfeindliche Diskurse und Gewalt gegen Gruppen nicht nur salonfähig machen, sondern auch in die Tat umsetzen. Andererseits sehen wir auch ein Erwachen der urbanen Unter- und Mittelschicht, die soziale und Umweltgerechtigkeit einfordert und geografische wie politische Grenzen zu überbrücken versucht. Angesichts der Kontrolle militärischer, natürlicher und finanzieller Ressourcen durch rechte und neoliberale Regierungen sind emanzipatorische Akteure national als auch international vor enorme Herausforderungen gestellt, um einen Wandel nicht nur einzufordern, sondern auch Lösungen aufzuzeigen, wie dieser erreicht werden kann.
Das vorliegende Buch kann in diesem Sinne wie ein Kompass verstanden werden, um die Längen- und Breitengrade zu definieren, die uns nachhaltige Auswege aus den gesellschaftlichen und ökologischen Missständen eröffnen. Entlang des hier vorliegenden Buchs lassen sich vier zentrale Argumentationslinien identifizieren, um aus der Vergangenheit heraus die Gegenwart und Zukunft nicht nur zu verstehen, sondern auch Handlungsempfehlungen zu formulieren: 1) das Versagen der progressiven Regierungen und der Mythos ihrer linken Gesinnung, 2) das koloniale Erbe des Rohstoffkonsenses und der Mythos von ›El Dorado‹, 3) Gewalt und Menschenrechte in Lateinamerika, sowie 4) der soziale Widerstand und kollektives Handeln. Diese sich gegenseitig bedingenden Dynamiken werden im Folgenden durch Beispiele aus der aktuellen Konjunktur ergänzt und mit Hilfe von Beispielen aus dem kolumbianischen Szenario – einem Land mit neoliberaler Regierung ohne progressive Vergangenheit – in einen größeren Rahmen gesetzt.
Das Versagen der progressiven Regierungen und der Mythos ihrer linken Gesinnung
Mit Beginn der Epoche der progressiven Regierungen um das Jahr 2003 etablierte sich der Progressivismus wie eine ›Lingua Franca‹. Svampa beschreibt ›Progressivismus‹ als ein Phänomen, das sich durch 1) die Infragestellung des Neoliberalismus, 2) den Aufbau einer heterodoxen Wirtschaft, 3) die Inklusion marginalisierter Bevölkerungsgruppen durch erhöhte Sozialleistungen, sowie 4) den Aufbau eines alternativen regionalen Raums auszeichnet, den der Mexikaner Jaime Preciado als ›herausfordernden autonomen Regionalismus‹ bezeichnet hatte (Svampa, S. 161; 282). Zwanzig Jahre später ist die Lage Svampa zufolge »sehr besorgniserregend, denn 1) hat das letzte Jahrzehnt die Ungleichheit eher konsolidiert, 2) gingen wir also nicht gegen den Strom an, sondern vielmehr in die gleiche Richtung wie der Rest der Welt. Dies zeigte sich 3) im verstärkten Landraub, der Ausweitung des Extraktivismus in den Sektoren des Agrobusiness, des Erdöls und des Bergbaus, die heute in den Händen der Großgrundbesitzer oder internationaler Konzerne sind und 4) ist Lateinamerika heute der Kontinent mit den meisten Morden an Umweltaktivist*innen« (Svampa in Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana vom 07.09.2018).
Wenngleich die progressiven Regierungen durch ihre Allianzen mit den sozialen Bewegungen, linken Intellektuellen und den Clases Populares zunächst einen Regierungswechsel und schließlich sogar einen Epochenwechsel herbeiführen konnten, blieben die spürbaren Veränderungen doch weit hinter den Erwartungen zurück. Unlösbare Spannungen wiesen früh darauf hin, dass diese Initiativen scheitern würden: Zum einen die Spannungen zwischen Autoritarismus und Basismobilisierung als zwei historische Seiten des lateinamerikanischen Populismus[6], zwischen dem Zentralismus der Regierungen und der Absicherung indigener Autonomien, sowie zum anderen zwischen einer heterodoxen Wirtschaftspolitik mit öko-territorialer Wende und einem ›herausfordernden autonomen Regionalismus‹ einerseits und der fortbestehenden wirtschaftlichen und finanziellen Abhängigkeit von nationalen Eliten und globalen Akteuren andererseits. Im Ergebnis setzten die Regierungen des real existierenden Progressivismus wohl oder übel in vielen Punkten vorherige Formen des Politik Machens fort. Sie versagten also nicht, weil sie links waren, sondern weil sie, Svampa zufolge, zum Ende hin immer weniger eine ›linke Politik‹ verfolgten, da sie weder eine Umverteilung des Reichtums erreicht noch die kapitalistische Produktionsmatrix grundsätzlich infrage gestellt haben.
Svampa betont sehr deutlich auch die positiven Entwicklungen, die die progressiven Regierungen zunächst initiiert hatten: Mit Verfassungsreformen in verschiedenen Ländern, die die indigenen Bevölkerungen stärkten und auch die Natur als Rechtssubjekte anerkannten, machten sie den lateinamerikanischen Kontinent zum weltweiten Vorreiter. Außerdem strebten sie zu Beginn durchaus eine politische Inklusion der Basis an und konnten dank der außergewöhnlichen Rendite während des Rohstoffbooms zunächst eine Verringerung der Armut erreichen. Sie bemühten sich, durch unterschiedliche Sozialprogramme für die arme Bevölkerung und die Mittelschicht, diese stärker am Konsum teilhaben zu lassen, was Svampa als ›Konsumpakt‹ bezeichnet (Svampa in Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana vom 07.09.2018). Zuletzt strebten sie in der Tat auch eine regionale Integration an.
Nicht zuletzt scheiterten die Regierungen an der Unnachgiebigkeit etablierter nationaler Eliten und internationaler Akteure – auf Kosten jener Gesellschaftsgruppen, von denen sie gewählt worden waren. Viele der Regierungen gingen Deals mit dem nationalen und internationalen Kapital ein, um die gestiegenen Sozialausgaben finanzieren zu können – sowohl eine Ursache als auch eine Folge davon, dass der Aufbau eines ›herausfordernden autonomen Regionalismus‹ gescheitert war. Dies hat es rechten Strömungen und der sogenannten Mitte erleichtert, emanzipatorischen Visionen ihre Umsetzbarkeit abzuerkennen, progressive Regierungen auf ihre autoritären Züge zu reduzieren und sie als undemokratisch abzustempeln – und hat neben der endgültigen Konsolidierung des Rohstoffkonsenses[7] auch zu einem Rechtstruck auf dem Kontinent beigetragen.
Das koloniale Erbe des Rohstoffkonsenses und der Mythos von ›El Dorado‹
Am Trugschluss des ›El Doradismo‹ zeigt sich, dass Agrobusiness ebenso wie der Megabergbau und das Fracking[8] auch bei progressiven Regierungen nichts anderes sind als die Fortschreibung der kolonialen Ausbeutung in Lateinamerikas Geschichte. Statt ihre Wirtschaftsformen zu diversifizieren, kurbelten die progressiven Regierungen angesichts der Abhängigkeit von internationalen Märkten und Institutionen (Internationaler Währungsfond und Weltbank) und dem Wiederanstieg von Armut und Arbeitslosigkeit durch den internationalen Preisverfall der Rohstoffe die neo-extraktivistischen Praktiken als einzige Überlebensstrategie ihres Landes an und gaben der Illusion des plötzlichen Geldsegens nach, die diese versprachen.
Im Zuge dessen wurde China zum wichtigsten Importeur lateinamerikanischer Rohstoffe, was zu neuen Abhängigkeiten und zum Bruch mit indigenen und ökologischen Bewegungen sowie ländlichen Gemeinden führte. So spaltete der Neo-Extraktivismus[9] bald das Lager der linksemanzipatorischen Allianzen in der gesamten Region: Der Rohstoffkonsens hinterließ eine »tiefe Wunde« (S. 121) im kritischen lateinamerikanischen Denken und teilte das Lager in diejenigen, die einen ›gebändigten Kapitalismus‹ vorschlugen, und solche, die den Extraktivismus als Ganzes infrage stellten und in der Konsequenz von den progressistischen Regierungen und ihren Verteidiger*innen marginalisiert wurden. Die Mythen des Progressivismus hatten einen längeren Schatten als die Wirklichkeit, sodass diese Kontinuitäten autoritärer Politik erst spät entlarvt wurden – und zum Teil noch immer in einigen Köpfen entlarvt werden müssen. Wie Svampa eindrücklich mit Verweis auf den Gewerkschaftler Julio Fuentes beschreibt: »Alle wollten wir in dem Land des Anderen leben« (S. 33).
Zur kritischen Revision des Progressivismus, die Svampa vornimmt, sollte vielleicht hinzugefügt werden, dass Paradoxien wie die gleichzeitige de jure Ausweitung von Rechten und die de facto Verletzung derselben in Lateinamerika keine Ausnahme progressiver Regierungen sind, sondern im Gegenteil eine Kontinuität in der lateinamerikanischen Geschichte darstellen. Der folgende Abschnitt skizziert dies am Beispiel Kolumbiens – einem Land ohne progressive Vergangenheit und mit jeher neoliberaler und rohstoffbasierter Wirtschaft. Kolumbien ist auch deshalb ein interessantes Beispiel, da das Land ein langjähriger wirtschaftlicher und politischer Partner der USA und der Europäischen Union ist, unter anderem als Energielieferant.
Soziale und ökologische (Un-)Gerechtigkeit in Kolumbien
Kolumbien hat 2016 nach über fünfzig Jahren bewaffnetem Konflikt ein historisches Friedensabkommen mit der ältesten Guerilla Lateinamerikas unterzeichnet, der FARC-EP. Zwar ist seitdem die Zahl der Opfer von bewaffneten Auseinandersetzungen stark zurückgegangen, allerdings ist seitdem die spezifische Gewalt gegen Menschenrechts- und Umweltaktivist*innen sowie auch gegen ehemalige FARC-Kämpfer*innen enorm angestiegen: Laut dem kolumbianischen Forschungsinstitut für Entwicklung und Frieden (Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ) wurden vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2019 633 Menschenrechtsaktivist*innen ermordet, 250 davon im Jahr 2019. Im laufenden Jahr 2020 sind bereits 57 Aktivist*innen und 10 demobilisierte FARC-Kämpfer*innen ermordet worden (Stand: 16. März 2020, indepaz.org). Rund 40 % der Ermordeten sind ethnische Aktivist*innen, obwohl sie nur ca. 15 bis 25 % der Bevölkerung ausmachen. Besonders überproportional sind davon indigene Frauen betroffen (Cumbre Agraria et al. 2019). Gemein ist diesen Aktivist*innen, dass sie sich für eine alternative politökonomische und ökologische Ordnung einsetzten oder diese bereits lebten, sich für die Verteidigung von menschlichem und nicht-menschlichem Leben einsetzten und sich gemäß ihrer Rechte gegen illegale Rodung, kommerziellen Koka-Anbau und Bergbau wehrten. Kolumbien steht damit vor einem erneuten ›Politicidio‹[10] – der gezielten Auslöschung von Personengruppen aufgrund ihrer politischen Gesinnung. Der Anstieg dieser spezifischen Gewalt kann mit der Soziologin Alke Jenss (2017, 2018) darauf zurückgeführt werden, dass durch die Demobilisierung der Guerilla aus ihren bis dato kontrollierten Gebieten ein großer Reichtum an natürlichen Ressourcen frei wurde, um den heute viele unterschiedliche Akteure kämpfen. Die politökonomisch bzw. extraktivistisch motivierte Gewalt wird sich vermutlich in Zukunft noch verstärken: Da die herkömmlichen Ölvorkommen des Landes bis 2024 erschöpft sein sollen, wurden nun Pilotprojekte für das Testen des Frackings erlaubt (Valbuena Leguízamo, J.A. vom 06.03.2020).
Trotz der de facto Menschenrechtslage ist Kolumbien auch eines der Länder mit den weitreichendsten Rechten für die LGBTQI*-Community weltweit[11] und, aufbauend auf der ILO-Konvention von 1989 wurden spezifische Rechte für Indigene, Afrokolumbianer*innen und Roma anerkannt; u.a. auf die vorausgehende Konsultation bei Großprojekten.[12] Rund ein Drittel der kolumbianischen Fläche ist kollektives ethnisches Land, wobei sich ein Großteil hiervon mit Naturschutzgebieten überschneidet (Instituto Humboldt 2015).
Zuletzt sollte unbedingt noch auf die Anerkennung der Rechte der Natur hingewiesen werden: 2019 wurde der Fluss Cauca, einer der wichtigsten Flüsse Kolumbiens, als Rechtssubjekt anerkannt. Der Fluss wurde durch zahlreiche extraktivistische Projekte wie durch den Hidroituango-Staudamm ausgebeutet, wodurch die ansässige Bevölkerung ihre Lebensgrundlagen verloren hatte. Die neue Rechtslage sollte nun den Fluss und seine Verteidiger*innen schützen, allerdings wird die Organisation Rios Vivos auch weiterhin bedroht.[13]
Inwiefern hilft uns die Berücksichtigung des kolumbianischen Falls für die Betrachtung progressiver Regierungen in Lateinamerika? Zum einen können wir feststellen, dass koloniale Kontinuitäten zwischen Norden und Süden – wie der Rohstoffexport nach Europa – die Umsetzung eines gesetzlich bereits anerkannten Rechtekanons auf dem lateinamerikanischen Kontinent verhindern, der in puncto sozialer und ökologischer Gerechtigkeit dem Globalen Norden weit voraus ist. Ebenso ermöglicht uns der Fall Kolumbiens zu erkennen, dass progressive Regierungen nicht grundsätzlich einen stärkeren Rechtekanon vorsehen als nicht-progressive Länder (wenngleich erstere zweifellos zur Ausweitung derselben beigetragen haben). Diese Fragen hängen eher von der Kraft sozialer Bewegungen und ihren Fähigkeiten ab, ihre Belange im Kontext von ratifizierten, internationalen Abkommen zu interpretieren, und von einer Judikative, die ratifizierte Abkommen quasi legalistisch umsetzt und sich der de jure Ausweitung von Rechten verpflichtet sieht (z.B. der Anerkennung von Intersex-Rechten als Menschenrechte).
Das Beispiel Kolumbien zeigt auf, dass die de jure Ausweitung von Rechten nicht mit einer de facto Ausweitung von Rechten einhergeht – unabhängig vom jeweiligen politischen Regime. Vielmehr hängt Letztere von den Interessen und Handlungsmöglichkeiten der Exekutive ab, die in Lateinamerika durch den Rohstoffkonsens bestimmt ist.
Gewalt und Intersektionalität in Lateinamerika
Der von Svampa angeprangerte Rohstoffkonsens ist also die herausforderndste Bedrohung für Natur und Menschen, da er Bestrebungen der de facto Umsetzung und Ausweitung von Rechten boykottiert. Die eingangs genannten Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise um den Staudamm Hidroituango, stehen also in direktem Zusammenhang mit dem Konflikt um die Einforderung verfassungsmäßig verankerter Rechte und der Verletzung derselben zur Durchsetzung ökonomischer Interessen. Angesichts der zahlreichen Umweltkatastrophen scheint es zwar einen Konsens über die Tragweite der globalen sozio-ökologischen Krise zu geben – ein »Leviathan für den Umweltschutz« (Svampa 2019) ist jedoch bislang nicht vorstellbar. Der Extraktivismus befindet sich auf einem ungeahnten Höhenflug.
Angesichts dieser »globalen Dystopie« erlangen lokale Utopien – alternative Entwürfe zu Energie, Konsum und Umweltschutz – erneute Attraktivität (Svampa 2019). In diesen sozialen Kämpfen spielen Frauen* und ethnische Aktivist*innen eine besondere Rolle und sind daher auch besonders von Gewalt betroffen. Es gibt also einen direkten Zusammenhang zu Neo-Extraktivismus und Gewalt gegen lokale Aktivist*innen. Die extreme Ausbeutung der Natur geht unvermeidlich im Gleichschritt mit Menschenrechtsverletzungen und einer Absage an die Demokratie, weshalb Svampa warnt: »Je mehr Extraktivismus, desto weniger Demokratie« (Dal Maso 2019) – unabhängig vom politischen Regime. Durch die wachsende Knappheit der natürlichen und zum Großteil nicht erneuerbaren Ressourcen potenziert sich dieser Effekt, und staatliche und parastaatliche Gewalt gegen Aktivist*innen in den von diesem Wirtschaftsbereich abhängigen Staaten vervielfacht sich und breitet sich räumlich entlang der Extraktionsgeografie[14] aus (ebd.).
Für die Praxis bedeutet das zunächst einmal, anzuerkennen, dass Gewalt und Unterdrückung innerhalb intersektionaler[15] Machtverhältnisse wirken und somit unterschiedliche Effekte auf Individuen und Gruppen haben, also Ökologie, Basismobilisation und Feminismus nicht voneinander getrennt werden können. Um dieser Feststellung Geltung zu verleihen, zeigt Svampa zunächst das Paradox auf, dass sich die politische Partizipation von Frauen verbessert hat und gleichzeitig verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen* – wie beispielsweise Femizide[16] – zugenommen haben und es einen sexistischen Backlash gibt. Dies spiegelt sich in den Anti-Abtreibungsinitiativen ebenso wider wie in der Akzeptanz und Befürwortung von machistischem Gebaren führender Politiker*innen.
In Lateinamerika zeigt sich zudem eine Verzahnung des Patriarchats mit dem kapitalistischen Extraktivismus und der Umweltzerstörung. Die Exportenklaven zerstören entlang der Zyklen des Rohstoffabbaus das soziale Geflecht der Gemeinschaften und bringen eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung hervor, die Männer entlang physisch schwerer Arbeit und Frauen* entlang von Sexarbeit und Carework ausbeutet. Die Zerstörung der sozialen Strukturen trifft Frauen* und Männer unterschiedlich: Während Männer in diesem System häufig zur Wanderarbeit gezwungen werden, erleben Frauen die sozialen und ökologischen Veränderungen unmittelbarer und vor Ort. Ökofeminismus ist hier also keine Option, sondern vielmehr Reaktion. Es ist ein Kampf von Frauen* für die Wertschätzung des Lebensraums und aller ihm innewohnenden Lebewesen und Gemeinschaften – ausgehend von ihrem spezifischen Erfahrungshorizont darüber, wie Gewalt über sie hereinbricht.
Die Phänomene der Gewalt durch Extraktivismus – vor allem auf weibliche Körper und Kinder – weisen dabei postkoloniale Kontinuitäten auf: Es handelt sich vor allem um Phänomene des Globalen Südens und des Ländlichen, von denen urbane und weiße Frauen wie auch Frauen aus dem Globalen Norden bislang kaum betroffen sind. Im Gegenteil profitieren privilegierte Frauen als (Energie-)Konsumentinnen bislang von dieser Gewalt. Dies kann sich jedoch ändern, sobald sich die Extraktionsgeografie im Gleichschritt mit der Suche nach Erdöl ausbreitet und sich das sogenannte Fracking den Weg nach Europa bahnt.
Soziale Kämpfe können also nicht erfolgreich sein, solange die ökologische Gerechtigkeit und Feminismos Populares[17] Randnotizen bleiben oder ihre Relevanz auf die Lebenswelten der aktuell Betroffenen reduziert wird. Im Gegenteil bergen feministische Kämpfe die Gefahr, ohne eine dekoloniale und ökologische Perspektive postkoloniale Herrschaftsverhältnisse auf Kosten nichtweißer Frauen und Gesellschaften zu reproduzieren (vgl. Lugones 2010). Die Anerkennung dieser Feminismos Populares ermöglicht es, konservativen Progressivismus von linkem, emanzipatorischem Denken abzugrenzen und zu enttarnen. Hiermit wenden wir uns der vierten Argumentationslinie des vorliegenden Buchs zu – der Frage, vor welchen Herausforderungen die weltweiten sozialen Kämpfe stehen und welches Potenzial ihnen innewohnt.
Widerstand und kollektives Handeln
Die Formen kollektiven Handelns und die sozialen Kämpfe in Lateinamerika ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch und erhalten im fünften und letzten Teil, der eine Chronologie der sozialen Kämpfe seit der Jahrtausendwende Argentiniens aufzeigt, eine beinahe fassbare Plastizität. Im Folgenden werde ich die Ereignisse seit der spanischen Erstveröffentlichung diskutieren. Dies, so hoffe ich, gibt uns eine Grundlage, um basierend auf den von Svampa aufgezeigten Lektionen soziale Kämpfe zu vereinen und das Potenzial punktueller sozialer Mobilisierung für sozialen Wandel zu nutzen.
Aktuell wohnen wir einer noch nie da gewesenen Protestwelle in Lateinamerika bei, die länderübergreifend voneinander lernt und zusammenarbeitet. So übernahmen im Herbst 2019, nach den bereits erwähnten Ereignissen in Chile, zum ersten Mal auch zahlreiche Protestierende in Ecuador, Bolivien und Kolumbien die von Svampa in diesem Buch beschriebene Protestform der Cacerolazos. Ungeachtet der politischen Repressionen in diesen Ländern, sei es durch legitime oder illegitime Regierungen, schufen die Protestierenden Bündnisse für den Schutz der Umwelt- und Menschenrechte sowie gegen Polizeigewalt. In Kolumbien, einem Land, das seit über fünfzig Jahren unter einem bewaffneten Konflikt und gesellschaftlicher Polarisierung leidet, gelang es den Protestierenden erstmals, einen landesweiten Streik über Monate hinweg zu halten (Defendamos La Paz 2019). Die Protestform – die Cacerolazos – war von enormer Bedeutung. Denn diese machten die Kriminalisierung der Proteste beinahe unmöglich und erschwerten die ansonsten übliche gewaltsame Zerschlagung der Proteste und ermutigten zahlreiche Personen, sich erstmalig einem Protest anzuschließen. Dies zeigt sich daran, dass die landesweiten Proteste auch von Exilkolumbianer*innen in 72 Städten der Welt begleitet wurden.
Svampas Buch vermittelt uns auf eindrucksvolle Weise am Beispiel Argentiniens die Kreativität, die diesen Formen von Protesten innewohnt, und das Potenzial von basisdemokratischen und integrierenden Formen des sozialen Protests und des zivilen Ungehorsams. Dies haben wir im letzten Jahr auch und insbesondere mit Blick auf den Kampf gegen genderbasierte Gewalt und Femizide beobachten können. Mit der #metoo-Bewegung kam 2019 nicht nur bei uns das Bewusstsein für die nie versiegte Gewalt gegen Frauen zurück auf die Tagesordnung. In Lateinamerika wird seit 2015 kontinuierlich unter dem hashtag #niunamenos (Nicht eine weniger) demonstriert.[18] Der Flashmob #unvioladorentucamino (ein Vergewaltiger auf deinem Weg) des feministischen Kollektivs LasTesis aus Chile hat auf provokante Weise die Alltäglichkeit sexistischer und sexueller Gewalt sichtbar gemacht und die Gewöhnungseffekte der Gewalt durchbrochen und erreichte im Dezember 2019 schließlich auch Deutschland!
Die Demonstrationen und Proteste sind seitdem nicht verklungen. Am Frauen(kampf)tag 2020 protestierten Millionen von Menschen in Lateinamerika nicht nur für die Rechte der Frau*, sondern auch gegen die rechtsnationalistische und antifeministische Politik ihrer Regierungen. Allein in Santiago de Chile protestierten zwei Millionen Menschen. In Mexiko, wo zehn Frauen pro Tag ermordet werden, besprühten Aktivist*innen Denkmäler und öffentliche Plätze, um die gesellschaftliche und juristische Gleichgültigkeit anzuklagen (Marcos González Díaz: o.S.).
Lateinamerika zeigt sich also jenseits aller Romantik in den letzten Jahren wieder als Wiege des sozialen Protests: Als Ort eines vielseitigen Widerstands, der intergenerational, liebevoll, kreativ, bunt, kraftvoll und inklusiv sein kann und der uns gleichzeitig aufzeigt, dass soziale Gerechtigkeit sowie die Würde des Lebens (im weitesten Sinne) nur in Einklang mit global verstandener Umweltgerechtigkeit und einer Absage an alle Formen der Diskriminierung zu erreichen ist.
Soziale emanzipatorische Kämpfe müssen also eigene Privilegien ebenso reflektieren wie die spezifische Gewaltbetroffenheit bestimmter Gruppen. Das schließt (öko-)feministische, antirassistische, antikapitalistische und dekoloniale Perspektiven ein bzw. macht sie zu notwendigen Pfeilern alternativer und emanzipatorischer Praxis. Offensichtlich stehen hiermit die sozialen Kämpfe vor einer großen Herausforderung. Der konservative Backlash bzw. der Rechtsruck, der heute die Welt durchzieht, zwingt uns, »neue Dialoge mit unseren Kolleg*innen und Aktivist*innen zu führen […] Falls dieser Dialog möglich ist [dann geht es darum], eine postprogressistische Linke zu denken, die soziale und antipatriarchale Gerechtigkeit mit ökologischer Gerechtigkeit vereint« (Svampa in Rossi: 2017 o.S.).
Urbane Feministinnen sollten das mit ihrer aktuellen Sichtbarkeit zusammenhängende Potenzial daher nutzen, um über ihren Tellerrand hinaus auch die Belange der Feminismos Populares mit einzubeziehen und strukturelle Veränderungen einzufordern. Die sozialen Medien können hier eine große Hilfe sein, um über räumliche und politische Grenzen hinweg Brücken für gemeinsames basisdemokratisches Handeln aufzubauen. Ein Beispiel hierfür ist das kolumbianische Social-Media-Netzwerk Defendamos La Paz (DLP). Im Kontext der friedensfeindlichen Regierungspolitik ab 2018, die die juristische Aufarbeitung des bewaffneten Konflikts blockierte, organisierten sich ab Februar 2019 aus der Not heraus Verteidiger*innen des Abkommens über eine kleine WhatsApp-Gruppe entlang eines Minimalkonsenses, der aus vier Zielen besteht: 1) die Umsetzung des Friedensabkommens mit der FARC-EP, 2) der Schutz der verschiedenen Transitional Justice-Institutionen, 3) ein Ende der Gewalt gegen soziale Aktivist*innen und 4) ein allumfassender Frieden. Schnell wuchs die WhatsApp-Gruppe und einte Verteidiger*innen des Friedensabkommens aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern und Parteien und mit unterschiedlichem persönlichem Background. Die Gründung einer internationalen Sektion Defendamos La Paz-Internacional (DLP-I) ermöglichte es schließlich, bis dato wenig organisierte Exilkolumbianer*innen zu vereinen sowie Multiplikationseffekte und Synergien zu schaffen. Dies spiegelt sich in der gesteigerten Mobilisierungs- und Protestfähigkeit wider, sei es gegen die Ermordung der Aktivist*innen am 21. Juli 2019 oder im weiter oben genannten landesweiten Streik. In DLP und DLP-I treffen sich Katholik*innen und Evangelikale, Kommunist*innen und Grüne, Ex-Kombattant*innen und Opfer des bewaffneten Konflikts, Priester und LGBTQI*, Studierende, Großstädter*innen und ethnische Aktivist*innen, Kleinbäuer*innen und Kongressabgeordnete. Mit Svampas Augen können diese 34 regionalen, zwei internationalen und sechs Themen-Chats (Jugend, Umwelt, Kirchen, Hochschule, Kleinbauerntum, Gleichberechtigung) mit knapp 4.000 Mitgliedern (Stand: Dezember 2019) als virtuelle Asambleas verstanden werden: Jede*r hat das Recht, Personen zu diesen Chats hinzuzufügen, jeder* darf sich an Prozessen beteiligen, Ideen oder Projekte vorstellen und umsetzen sowie Informationen teilen. Diese hier gelebte prozessuale Demokratie ist in der polarisierten, fragmentierten und von Gewalt betroffenen Gesellschaft Kolumbiens neu für die Menschen und bereits ein Erfolg für sich. Neben dem Mobilisierungs- und Aktivierungspotenzial geht es um die kontinuierliche Aushandlung von Differenzen, ausgehend von gegenseitiger Anerkennung und Solidarität. So María Cepeda, Koordinatorin von Defendamos La Paz Internacional:
»Es ist eine neue Erfahrung auf dem Gebiet des virtuellen Arbeitens, die uns geholfen hat, ein globales Netzwerk […] aufzubauen [und] hat es uns erlaubt, uns Personen und Gruppen zu nähern, die ganz unterschiedlicher Herkunft und politischer Überzeugung sind. Es ist eine heilsame Übung, Demokratie zu leben.«[19]
Die Effekte von DLP und DLP-I – der Aufbau intersektorialer Allianzen und die Überbrückung des Stadt-Land- sowie des Nord-Süd-Gefälles, die Mobilisierung und Aktivierung zahlreicher Menschen, vor allem aber die gelebte Demokratie, die Anerkennung und Solidarität mit unserem Gegenüber – zeigen das Potenzial auf, das anti-hegemoniale Kämpfe haben können, wenn sie die von Svampa immer wieder aufgezeigten Gräben überwinden und sich im Kontext extrem ungleicher Machtverhältnisse und Ressourcenverteilung organisieren.
Fazit: Epochenwechsel – Lektionen für ein ›bewegte Gesellschaft‹
Die Dynamiken, die Svampa bereits 2017 in ihren Anfängen beschrieb, haben sich in Lateinamerika verfestigt und manifestieren sich heute auf internationaler Ebene. Wir befinden uns in einem Kontext der gesellschaftlichen Polarität, in dem autoritäre, ausgrenzende, utilitaristische und lebensfeindliche Positionen wortwörtlich Landgrabbing betreiben. Wir sehen aber auch den Aufbau von dem, was Svampa als ›lokale Utopien‹ bezeichnet hat: Comunidades de Vida, kollektive Lebensgemeinschaften, die von der Basis aus alternative Formen des Zusammenlebens praktizieren und alternative, kreative und liebevolle Wege finden, anti-hegemonial und basisdemokratisch miteinander umzugehen und zu leben – sei es als Nachbar*innen, in der Asamblea, beim Cacerolazo oder virtuell. Für beide Dynamiken bietet das vorliegende Buch am Beispiel der lateinamerikanischen Ereignisse zahlreiche Lektionen, die auch für den internationalen Kontext bedeutsam und für Deutschland zentral sind.
Was Svampa schreibt, mag zu Beginn eine schwierige Auseinandersetzung für diejenigen sein, die sich mit den progressiven Regierungen solidarisiert haben. Es ist aber eine notwendige und auch spannende Auseinandersetzung, die es uns ermöglicht, auf Entdeckungsreise im weitläufigen Feld der linksemanzipatorischen Initiativen in Lateinamerika zu gehen und uns von neuen Sichtweisen überraschen zu lassen. Das Werk von Svampa erlaubt es uns schließlich auch, inspiriert von den Erfolgen der bewegten, emanzipatorischen Gesellschaft, neue Brücken der Solidarität auf Augenhöhe zu bauen und hiervon ausgehend konkrete politische Entscheidungen einzufordern, die sich an der ›super-starken Nachhaltigkeit‹[20] orientieren. Denn die Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Umweltgerechtigkeit gehen uns alle an.
Was jetzt gebraucht wird, ist eine ›sociedad en movimiento‹, die sich global und über soziale Medien vernetzt und instituierendes Handeln voranbringt, um Alternativen zum rechtspopulistischen Vormarsch anzubieten. Regierungskritik zu üben, ohne linke Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen oder zu fördern, ist ein verantwortungsloses Privileg angesichts der zahlreichen Morde an Menschenrechtsaktivist*innen, der weltweiten Einschränkung demokratischer Rechte, der völligen Ignoranz von Menschenrechten an unseren geografischen und sozialen Rändern und nicht zuletzt dem Anstieg rassistischer Terrorakte im Globalen Norden (wie z.B. am 19.02.2020 in Hanau). In diesem ungleichen Machtverhältnis müssen also über emanzipatorische Diskurse hinaus strukturelle Veränderungen im Wirtschafts-, Politik-, Sozial-, Kultur- und Umweltbereich auf nationaler und internationaler Ebene herbeigeführt werden, die die soziale Gerechtigkeit wie auch die Umweltgerechtigkeit voranbringen. Diese Mammutaufgabe zu lösen, verlangt nicht nur, ›realistisch zu sein und das Unmögliche zu versuchen‹, sondern in erster Linie, aus der Vergangenheit zu lernen.
»América Mestiza ist als Tochter sehr tiefgründiger und komplexer Zivilisationen geboren und dazu verpflichtet, das Beste aller dieser anzunehmen. Angesichts des Rufes nach Produktivität, einem Ruf, der weder Raum für das Leben noch für die Vorstellungskraft übrig lässt, und angesichts des schrecklichen Rufes der Macht, die die Menschen in Untertanen einer sie erschöpfenden Disziplin verwandelt sehen will, sehen sich unsere Gesellschaften zwei fundamentalen Imperativen gegenüber: einerseits dem des Überlebens, so wie es die ursprünglichsten Gesetze der Natur verlangen. Hierfür ist es notwendig auch das Universum der Natur zu retten, von der wir abhängen. Andererseits dem Imperativ, das Glück zu suchen, die Schönheit der Dinge und die Harmonie.«
William Ospina, America Mestiza. Das Land der Zukunft, 2004.
»Die Umweltkrise ergibt sich aus dem Umstand, dass die Natur ganz grundsätzlich vergessen wurde. Die Risse in der Geosphäre, der Schrei der Erde, die Stimme der Pachamama. Die Umweltkonflikte und die Rechte der Pueblos haben das Fundament der Wissenschaft erschüttert, indem sie die Gewissheit ihrer objektiven Wahrheiten infrage gestellt haben. Stattdessen stellen sie den Sozialwissenschaften neue Fragen, wie die nach möglichen kollektiven Lebensformen und der Nachhaltigkeit des Lebens.«
Enrique Leff, Der Einsatz des Lebens, 2014.
»Die Erfahrung dieser Welt zeigt, dass es unzählige nichtkapitalistische Realitäten gibt, die von Gegenseitigkeit und Kooperativismus geleitet werden und nur darauf warten, von dieser Gegenwart als Zukunft anerkannt zu werden.«
Boaventura Sousa Santos, Briefe an die Linken.Erster Brief, 2011
Einleitung. Ende eines Zyklus
Seit dem Jahr 2000 befindet sich Lateinamerika in einem Epochenwechsel[21]. Der neu eingeläutete politische und wirtschaftliche Zyklus hat ein bislang unbekanntes Umbruchszenario hervorgebracht, das sich durch die wachsende Bedeutung der sozialen Bewegungen, die Krisen der traditionellen politischen Parteien und ihrer Repräsentationsformen und letztendlich durch die Infragestellung des Neoliberalismus sowie die Re-Legitimierung radikaler politischer Diskurse auszeichnet. Dieser Epochenwechsel nahm einen neuen Kurs auf, als verschiedene Regierungen an die Macht kamen, die sich auf vom Mainstream abweichende politökonomische Politiken stützten und versprachen, die Forderungen der Basis zu vertreten, während sie gleichzeitig begannen, den lateinamerikanischen Raum als Region zu stärken. Angesichts dieses Szenarios weckten nicht wenige Autor*innen die Hoffnung auf einen Wandel und schrieben optimistisch über den ›Linksruck‹, die ›neue lateinamerikanische Linke‹, den ›Post-Neoliberalismus‹ etc.
Um diese neuen Regierungen zu bezeichnen, wurde als Gemeinplatz der generische Begriff Progressivismus[22] verwendet. Eine Bezeichnung, die zwar eine sehr weite Kategorie darstellt, dadurch jedoch in der Lage ist, eine Vielfalt von ideologischen Strömungen und regierungspolitischen Erfahrungen zu umfassen, die von sehr institutionellen bis hin zu radikalen, verfassungsgebenden Prozessen reichen. Mehr noch: In einem Lateinamerika, das bis heute über Jahrzehnte hinweg durch Neoliberalismus und Steuerreformen ausgeplündert worden war und sich danach sehnte, Brücken zu bauen und Integrationsräume zu schaffen, erwuchs der Progressivismus als eine Art Lingua Franca, die sich wie ein Bogen über die vielfältigen Erfahrungen und Erwartungshorizonte spannte. Dieser Bogen spannte sich über das Chile von Patricia Lagos und Michelle Bachelet, das Brasilien der Partei der Arbeiter (Partido dos Trabalhadores – PT) mit Lula Da Silva und Dilma Rousseff, das Uruguay des Frente Amplio, das Argentinien von Néstor und Cristina Kirchner, das Ecuador von Rafael Correa, das Bolivien von Evo Morales, das Venezuela von Chávez-Maduro, bis hin zur gescheiterten Regierung von Fernando Lugo in Paraguay und dem Sandinisten Daniel Ortega in Nicaragua.
Dieser neue Horizont zeigte sich auf paradigmatische Weise durch die neuen Regierungen von Bolivien und Ecuador. Beides sind Länder, in denen sich die Änderungsbestrebungen zwischen der politischen Dynamik einerseits und der Intensität der sozialen Mobilisierung andererseits bewegen. Diese Bestrebungen zur Veränderung spiegeln sich auch in neuen Verfassungen wider, die mit großer Beteiligung der Bevölkerung verabschiedet wurden und in deren Mittelpunkt stets der Ausbau der Rechte stand: Kategorien wie ›Plurinationaler Staat‹, ›Indigene Autonomien‹, ›Buen Vivir‹[23], ›Gemeingüter‹ und ›Rechte der Natur‹[24] wurden durch den Druck verschiedener sozialer Bewegungen und indigener Organisationen Bestandteil der lateinamerikanischen politischen Grammatik und von den neuen Regierungen übernommen. Nichtsdestotrotz konnte dies viele Analytiker*innen von Anbeginn nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Koexistenz verschiedener politischer Matrices[25] und dekolonialer Narrative ein Spannungsfeld zwischen zwei Denkrichtungen bedeutete: Zum einen gab es die populistische Perspektive und den Desarrollismo[26], die sich durch eine regulierende und zentralistische Dimension auszeichneten und auf die Rückkehr bzw. den Wiederaufbau eines Nationalstaates setzten. Zum anderen stand dem die Indianista-Bewegung[27] (und immer häufiger auch Menschen und Gruppen mit ökologischen Sichtweisen) gegenüber, die einen plurinationalen Staat anstrebte und indigene Autonomieregierungen sowie den Respekt und Schutz der Umwelt einforderte. Im Laufe des Jahrzehnts konsolidierten sich die progressiven Bewegungen, was jedoch Hand in Hand ging mit einem populistisch-desarrollistischen Narrativ und der Personalisierung der Macht, während alternative Narrative wie etwa dekolonisierende, indigene, umweltorientierte und/oder basisdemokratische Narrative verdrängt wurden.
Auf gleiche Weise war die Hegemonie des populistisch-desarrollistischen Progressivismus verknüpft mit dem neuen Boom der an Börsen gehandelten Rohstoffe. Ab 2003, kurz nach Beginn des Epochenwechsels, erreichte der Extraktivismus[28] im Globalen Süden neue Ausmaße, die mit den hohen internationalen Preisen für Rohstoffe zusammenhingen (Soja, Metalle und Mineralien, Erdöl und weitere). Während dieser Zeit der außergewöhnlichen Rentabilität begann in Lateinamerika ein wirtschaftliches Wachstum ohnegleichen. In allen Ländern – unabhängig von der politischen Couleur ihrer Regierungsparteien – erlaubten der Boom der an Börsen gehandelten Rohstoffe sowie gewisse Wettbewerbsvorteile die Ausweitung der Sozialausgaben – beispielsweise über den Ausbau von Sozialpolitiken. Dies erlaubte eine nicht unwesentliche Reduktion der Armut im Vergleich zur neoliberalen Ära. In allen Ländern zeichnete sich dieser Prozess durch eine Rückkehr zur Rohstoffwirtschaft aus, das heißt durch die Ausrichtung aller wirtschaftlichen Aktivitäten auf den Rohstoff-Extraktivismus und die Maquilas[29], in denen kaum Wertsteigerungen stattfinden. In all diesen Ländern führte dies, unabhängig von den politisch-ideologischen Diskursen, die ich den Rohstoffkonsens genannt habe (Svampa 2013), zu einer Explosion von sozialen und ökologischen Konflikten und zum Beginn eines neuen Zyklus von Menschenrechtsverletzungen.
Zweifellos schuf die extraktive Politik in den Ländern, die durch progressive Regierungen geführt waren, eine große Kluft zwischen den sozialen Bewegungen und der intellektuellen Linken. Das Ausmaß des Konflikts, der durch den neuen Eintritt in die Kapitalakkumulation entstand, brachte eine interne Spaltung hervor und führte zu Dilemmata und Brüchen. Im weiten Feld des Progressivismus bestand Uneinigkeit bezüglich den Fragen nach Entwicklungsstrategien, emanzipatorischer Sprache, produktiver Praktiken und hegemonialer Vorstellungswelten. Einfach gesagt: Die Vorherrschaft des Progressivismus als Lingua Franca wurde mehr und mehr von und durch die indigenen und linksökologischen Bewegungen infrage gestellt, sodass mit den Jahren ein immer tieferer Konflikt im lateinamerikanischen kritischen Denken entstand.
Nichtsdestotrotz schien die Kritik am Export-Extraktivismus (im Folgenden Extraktivismus/Neo-Extraktivismus) angesichts des Booms der Commodities[30] bzw. des Rohstoffbooms, dem Wirtschaftswachstum, der politischen Inklusion und des Konsumanstiegs kaum an der Popularität der progressiven Regierungen zu kratzen. Bis auf einige Ausnahmen wurden über ein Jahrzehnt die Regierungen durch eindeutige Wahlerfolge bestätigt, und ihre Parteien und politischen Strömungen (die Partei Movimiento al Socialismo MAS[31] in Bolivien, der Kirchnerismus in Argentinien, der Chavismus in Venezuela, die Alianza País in Ecuador) entwickelten sich zu den stärksten politischen Kräften des Landes. So gelang es ihnen, den Progressivismus, der sich in dieser ersten Periode mit der Linken identifizierte, für sich zu vereinnahmen und radikalere politische Stimmen zu neutralisieren. Im Kontext dieses hegemonialen Progressivismus führten die Regierungen über verschiedene Dispositive, unter anderem der Verstaatlichung, eine Re-Subalternisierung von sozialen Bewegungen herbei. Es ist kein Zufall, dass der doppelte Prozess (der Institutionalisierung und Verstaatlichung) in Ländern wie Bolivien auch als eine ›Enteignung‹ durch Evo Morales verstanden wird; als eine Enteignung der akkumulierten sozialen und kollektiven Energie, die den Epochenwechsel durch Mobilisierungen wie den Kampf ums Wasser (2000) und den Kampf ums Gas (2003) überhaupt erst ermöglicht hatte.
Im Lauf der Zeit wurden die real existierenden Progressivismen nicht nur aufgrund ihrer extraktiven Politik des Neo-Desarrollismo und der fortschreitenden Kriminalisierung der sozialen und Umweltbewegungen infrage gestellt, sondern auch aufgrund der wachsenden Kluft zwischen dem linken Narrativ und den Maßnahmen der staatlichen Politik. Letztere zeigte sich auf verschiedenen Ebenen: beispielsweise durch das Ausbleiben einer Transformation der Produktionsstrukturen, die Persistenz der Ungleichheit, oder die Grenzen der lateinamerikanischen Integration. In den Worten des argentinischen Gewerkschafters Julio Fuentes[32]: »Zwischen der Fiktion und der Realität gab es große Unterschiede: Alle wollten wir in dem Land des Anderen leben: denn was wir vom jeweils anderen sahen, war die Fiktion.«
Der quasi humoristische Ton des Satzes »Alle wollten wir in dem Land des anderen wohnen« täuscht nicht über das Unbehagen hinweg, welches die real existierenden Progressivismen im Inneren der Linken hervorriefen, die tiefen Gräben, die sie schlugen, und die harten Debatten über die Bedeutung, was als links zu verstehen sei. Es war kein Zufall, dass die Entkopplung von Progressivismus und linken Bewegungen mit den Jahren (bis zum Ende des Jahrhunderts) zu einer Wiedereinführung von Kategorien wie Populismus und Transformismus führte, die wiederum einen wichtigen Teil der zeitgenössischen kritischen Analyse prägen sollten.
Zur Mitte des zweiten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts hat sich die politische Landschaft schließlich verändert. Die Region erlebt seither ein Zeitalter, in dem Wahlen einen politischen Wandel herbeiführen, der einen dramatischen Schlussstrich unter das Ende des letzten Jahrhunderts zieht und Regierungen an die Macht bringt, die offen konservativ sind. Mit Ausnahme der Fälle Uruguay und Chile (vermutlich wegen der stärkeren institutionellen Rahmung) wird das Ende des Zyklus bzw. der politische Wandel dramatischerweise durch den Gang zur Urne erlebt: So geschah es in Argentinien, als der Kirchnerismus unerwartet 2015 abgewählt wurde, und so verlor Nicolás Maduro in Venezuela die parlamentarische Mehrheit.
Neben dem unbestreitbaren politischen Gegenwind bzw. der effektiven Infragestellung durch die Rechte und die Linke ist eines der großen Probleme der Progressivismen der unvermeidbare Führungswechsel aufgrund der verfassungsrechtlichen Begrenzung der Amtszeit der Präsident*innen. Zweifelsohne verhinderten die Machtkonzentration und die Personalisierung der Politik in den Jahren, in denen die Regierungen konsolidiert wurden, den Aufbau anderer Führungspersonen innerhalb des progressiven Flügels und somit auch eine gewisse politische Erneuerung. Stattdessen stärkten die Regierungen Entscheidungsfindungsprozesse, die durch Disziplinierung bzw. Bestrafung und Belohnungen geprägt waren und jegliche Artikulation von politischem Pluralismus in der Öffentlichkeit verstummen ließen – seien es soziale Bewegungen und Organisationen mit eigener politischer Agenda oder Intellektuelle, Wissenschaftler*innen und Journalist*innen als Verteidiger*innen des Rechts auf Dissidenz und kritisches Denken. Dabei handelt es sich nicht um eine Kleinigkeit, sondern wir sehen uns mit einem in der lateinamerikanischen Geschichte immer wiederkehrenden Thema konfrontiert, welches das Ende des progressiven Zyklus mit ganzer Wucht trifft: dem autoritären und ausufernden Führungsstil und der Tendenz der Regierenden, an der Macht zu bleiben oder zumindest zu versuchen, sich so lang wie möglich an der Macht zu halten.
So wissen wir, dass die Frage der ›Wieder-Wiederwahlen‹ zu sozialer Spaltung geführt hat. 2013 versuchte die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner während ihres zweiten Mandats, die Möglichkeit einer Verfassungsreform auszuloten, um eine dritte Amtszeit zu ermöglichen, fand sich aber mit dem Widerstand der Bevölkerung konfrontiert, die ihre Ambitionen zuerst auf der Straße und anschließend an den Urnen verhinderten. Evo Morales erlebte am eigenen Leib den Tiefschlag, den die bolivianische Gesellschaft ihm mit einem Nein zu einer ›Wieder-Wiederwahl‹ beim Referendum im Februar 2016 versetzte und die ihm versagte, 2019 wiedergewählt zu werden. Ungeachtet dessen gibt Morales nicht auf, auch ein viertes Mal zu kandidieren, und alles weist darauf hin, dass er über Tricks versuchen wird, den geltenden konstitutionellen Rahmen zu umgehen.[33] 2015 schaffte es Rafael Correa, nachdem seine Regierungspartei mit zahlreichen Konflikten sowohl mit der klassischen Rechten als auch mit linken Organisationen konfrontiert war, dass eine verfassungsrechtliche Versammlung die unbegrenzte Wiederwahl des Präsidenten erlaubte, wenn auch nicht für die Präsidentschaftswahlen 2017.[34] 2009 schaffte es Hugo Chavez im zweiten Versuch, über ein Referendum die unbegrenzte Wiederwahl für alle Posten einzuführen, während 2013 Daniel Ortega – jedes Mal weiter vom kämpferischen Widerhall der sandinistischen Revolution entfernt und jedes Mal näher an der traditionellen Figur der Familiendiktatur[35] – die gesetzgebende Versammlung davon überzeugen konnte, für die verfassungsgebenden Reformen zu stimmen, die dasselbe erlauben würden.
Auf der anderen Seite haben die Progressivismen im Kontext des Rohstoffbooms auch eine starke Tendenz zu Machtmissbrauch und Korruption gezeigt und verwischten so die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem. Dies hat ihnen ein Stück weit die ›Aura der Erlösung‹ genommen und das Ursprungsnarrativ von der Beziehung zwischen Transparenz, sozialer Gerechtigkeit und Inklusion relativiert. Ungeachtet dessen wäre es falsch, die real existierenden Progressivismen darauf zu reduzieren, eine einzige Korruptionsmaschine zu sein – so, wie es uns viele ihrer Kritiker aus der rechten Ecke interessengeleiteterweise weiszumachen versuchen.
Nun gut. Die Sache ist, dass die real existierenden Progressivismen in eine Phase der Erschöpfung und der Krise eingetaucht sind. Das zeigt sich am konservativen Backlash oder Rechtsruck, den es in zwei der wichtigsten Länder der Region gegeben hat: Argentinien und Brasilien. Es ist wichtig zu sagen, dass diese Erschöpfung nicht einzig auf externen Faktoren beruht (wie dem Ende des Rohstoffbooms oder der Verschlechterung der ökonomischen Indizes), sondern dass auch interne Faktoren eine Rolle spielen (wie die zunehmende ideologische Polarisierung, die Konzentration der politischen Macht und der Anstieg der Korruption). Dem muss hinzugefügt werden, dass die Vorwürfe der Konspiration (wenn sie auch übertrieben waren) nicht gänzlich falsch sind. Nichtsdestotrotz hängt der Rechtsruck im Wesentlichen mit der Beschränktheit, den Mutationen und der Unverhältnismäßigkeit der progressiven Regierungen zusammen: In Lateinamerika erleichterten die Prozesse der politischen Polarisierung den parlamentarischen Putsch, der zum Rauswurf von Zelaya in Honduras (2009), zur Absetzung von Fernando Lugo in Paraguay (2012) und, am bekanntesten, zum skandalösen Amtsenthebungsverfahren der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff (2016) führte und die Rückkehr zur offen konservativen Herrschaft in diesen Ländern einläutete.
Auf der anderen Seite fügen sich das Ende des Zyklus und der mögliche politische Wandel in ein verstörendes Weltszenario ein, das durch den Vormarsch der fremdenfeindlichen und nationalistischen Rechten in Europa und durch den unerwarteten Triumph des Magnaten Donald Trump in den USA geprägt ist. All dies ermöglicht wichtige geopolitische Veränderungen, die nicht nur das ideologische Klima auf dem internationalen Parkett verschlimmern, sondern in denen die antisystemischen Forderungen der prekärsten Bevölkerungsgruppen sich in rassistischen und protektionistischen Diskursen widerspiegeln. Auf diese Weise wirken sich die geopolitischen Veränderungen – zumal im Kontext der global anwachsenden Ungleichheit – auch negativ auf die lateinamerikanische Region aus.
Aus einer politischen Perspektive ist die Krise der Regierungsprogressivismen ein schwerer Schlag gegen die Linke als Ganzes. Denn ungeachtet der Debatte, was unter ›links‹ zu verstehen ist, haben es die progressiven Regierungen im Spiel der binären Gegensätzlichkeit geschafft, den Raum der Mittelinks-/linken Politik für sich zu vereinnahmen. Je nach Fall beseitigten sie alternative Narrative von Wandel oder verhinderten das Entstehen von radikaleren politischen Positionen, sodass ihre Krise bzw. Schwächung diese Räume auch mitgeschwächt hat.
Zuletzt muss auch noch darauf hingewiesen werden, dass, auch wenn das Ende des Zyklus sich als ein Erschlaffen der real existierenden Progressivismen liest, das Auftreten einer neuen Rechten noch immer die Ausnahme und nicht die Regel ist.[36] Zudem handelt es sich bei den Regierungen in Argentinien und Brasilien um nicht konsolidierte Regierungen, denn sie stehen im Kontext der Wirtschaftskrisen und des sozialen Protests. Es sind schwache Regierungen, die zur konstanten Verhandlung gezwungen sind. Die Umrisse einer neuen politischen Stabilität, die gezwungenermaßen auch ein neues Modell der Re-Subalternisierung beinhalten muss, um sowohl die Mittelschichten (die unter dem sinkenden Konsum leiden) als auch die Arbeiterklassen (die unter der steigenden Armut und der weitreichenden Exklusion leiden) zu befrieden, sind noch nicht sichtbar. Und nicht zuletzt gibt es eindeutige Unterschiede zwischen den beiden genannten Regierungen, denn während Michel Temer nicht nur eine unpopuläre, sondern auch eine illegitime Regierung führt, ist die von Mauricio Macri eine Regierung mit legitimem Fundament, das auf den Stimmen der einfachen Bevölkerung beruht. Ungeachtet dessen gibt es eine nicht zu leugnende Ähnlichkeit zwischen beiden: Ohne, dass sie sich in linearer Weise auf den Neoliberalismus rückbesinnen, bauen beide auf zentralen Prämissen desselben auf, beispielsweise indem sie Politiken einführen, die ganz unverhohlen bereits stark konzentrierte Wirtschaftszweige fördern oder repressive Mechanismen verstärken.
Insgesamt müssen wir also das Abklingen des progressiven Zyklus konstatieren, zumindest in seinem Charakter als Lingua Franca, als gemeinsamer politischer Sprache, die bis vor Kurzem von großen Teilen der lateinamerikanischen Gesellschaften akzeptiert und geteilt worden ist – ungeachtet der Widersprüche zwischen Progressivismen und linken Strömungen und ungeachtet des Unbehagens, das Aktivist*innen, soziale Bewegungen und Intellektuelle in ihren eigenen Ländern hatten, oder ihres Wunsches, im Land der Anderen zu leben … Alles scheint darauf hinzuweisen, dass wir dem Beginn einer neuen Epoche in der Region beiwohnen, die – in einem globalen Kontext, der bereits durch zentrale geopolitische Veränderungen und wachsende Ungleichheiten markiert ist – auch rechtlich eine größere Unsicherheit und weniger Pluralität beinhalten wird.
Der Aufbau des Buchs
Dieses Buch verfolgt das Ziel, die real existierenden Progressivismen aus einer Perspektive zu analysieren, die die Akkumulationsmodelle und Entwicklungsstile sowie die ideologischen Traditionen und Dynamiken der verschiedenen sozialen Bewegungen miteinbezieht. Vor diesem Hintergrund nehme ich folgende Dreiteilung vor:
Im ersten Teil mit dem Titel »Progressivismus, neuer Zyklus kollektiven Handelns und die Expansion des Extraktivismus« stehen Konflikte, Spannungen und Brüche im Vordergrund, die mit der Ausweitung der extraktiven Modelle zusammenhängen und die, in diesem Kontext, den Anfang eines Stigmatisierungsprozesses und die Unterdrückung von gesellschaftlichen und ökologischen Protesten einläuten. Sie stellen die dunkelste Seite der Progressivismen dar. Hierfür wird zunächst der Text »Soziale Bewegungen, politische Traditionen und Dimension des kollektiven Handelns in Lateinamerika« vorgestellt, in dem die grundsätzlichen Interpretationslinien in Bezug auf die sozialen Bewegungen in der Region sowie die politischen Traditionen vorgestellt werden. Sie sollen beim Verständnis des progressiven Zyklus helfen.
Das nächste Kapitel mit dem Titel »Rohstoffkonsens und Entwicklung. Koordinaten für eine lateinamerikanische Debatte« zeigt die grundsätzlichen Eigenschaften des politischen Zyklus (2000–2016) auf, die ich unter dem Begriff des Rohstoffkonsenses zusammenfasse. Der Rohstoffkonsens ist nicht nur ökonomisch zu verstehen, sondern hat auch einen politischen und ideologischen Charakter. Meiner Ansicht nach ist es die (explizite oder unausgesprochene) Akzeptanz dieses Konsenses, die die ersten Grenzen des Progressivismus definiert hat. Diese wurden von den sozialen Bewegungen aufgezeigt, wenngleich sie selbst zunächst das Modell von Extraktivismus und Export als Leitkonzept für Entwicklung akzeptiert hatten. Darüber hinaus werden in diesem Teil die dominierenden Vorstellungen über Entwicklung eingeführt und Phasen des Rohstoffkonsenses aufgezeigt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Ausdehnung der Konfliktivität in der Region, sowohl in Bezug auf soziale als auch ökologische Fragen, als auch mit Blick auf die Merkmale, die den neuen Kurs des öko-territorialen[37] Widerstands auszeichnen. Dieser Abschnitt befasst sich mit der politischen Sprache und den Erwartungshorizonten, die diese öko-territorialen Kämpfe eröffnen (und den Rahmen ihres kollektiven Handelns vorgeben), während gleichzeitig versucht wird, ihre Grenzen und Schwierigkeiten aufzuzeigen. Abschließend wird eine Diskussion um Transition und mögliche Alternativen zum Extraktivismus geführt.
Ein viertes Kapitel befasst sich mit den Feminismos Populares bzw. den Feminismen des Südens. Im Speziellen widme ich mich hier den Fragen, die sich mit öffentlichen Politiken beschäftigen, die sich an die Frauen in der Region richten, sowie mit der Rolle der Feminisierung der sozialen Kämpfe. Ebenso ist die Beziehung zwischen ökologischen Kämpfen und der bedeutenden Rolle der Frauen – insbesondere im Kontext des Ökofeminismus – zu betrachten. Der Text schlägt hier vor, die verdeckten Zusammenhänge zwischen Extraktivismus, Patriarchat und Gewaltspiralen zu durchleuchten.
Dieser erste Abschnitt schließt mit einem Kapitel, das betrachtet, wie Prozesse der geopolitischen Neuordnung, das Aufkommen neuer globaler Mächte und technologische Weiterentwicklungen das Nord-Süd-Gefälle prägen. Um dies aufzuzeigen, betone ich aus einer Perspektive der Extraktionsgeografie[38] die ununterbrochene Abhängigkeit der Länder Lateinamerikas und des Globalen Südens, vor allem seit China sich als globale Großmacht etabliert hat. Neben der Analyse der Expansion der Extraktionsgeografie bietet es sich auch an, jene Nuancen zu betrachten, die zu einem besseren Verständnis des Nord-Süd-Gefälles beitragen.
Der zweite Teil des Buches mit dem Titel »Progressivismen und das Ende eines Zyklus« besteht aus zwei Kapiteln, die auf spezifischere Weise eine Bilanz der Grenzen, Mutationen und Schwierigkeiten der real existierenden Progressivismen ziehen und die beginnende post-progressive Phase beschreiben. So systematisiert der erste Text die Kritik, die sich mit den Grenzen des progressiven Zyklus befassen, und unterteilt sie in drei Kategorien: die öko-territoriale, die sozio-ökonomische und die politisch-institutionelle Kritik. Im zweiten Text, den ich zusammen mit Massimo Modonesi, einem italienisch-mexikanischen Kollegen und Wissenschaftler verfasst habe, schlagen wir vor, die Akkumulationslinien der sozialen Kämpfe vor dem Horizont des Post-Progressivismus neu zu betrachten.
Der dritte Teil des Buches befasst sich ausschließlich mit Argentinien und dabei insbesondere mit zwei Extremen des progressiven Zyklus: dem Widerhall der Rebellion von 2001 und dem Kirchnerismus als politischem Phänomen. Vor diesem Hintergrund befassen sich die ersten Texte mit dem Beginn eines neuen politischen Zyklus, der sich durch die Ausweitung des Aktionsrepertoires sowie Formen kollektiven Handelns wie das Besetzen öffentlicher Plätze und die Infragestellung der traditionellen politischen Repräsentationspolitik auszeichnet. Während im ersten Schritt die verschiedenen Interpretationen der Geschehnisse des 19. und 20. Dezember 2001 diskutiert werden, beschäftigt sich der zweite Teil mit den Charakteristika, die sich in der Sprache der Mobilisierungen ab 2001 ausgeprägt haben.
Dieser letzte Teil endet mit einem langen Text über den Kirchnerischen Zyklus, den ich in vier verschiedenen Schritten nachvollziehe. In einem ersten Schritt werden die Veränderungen der argentinischen Sozialstruktur zwischen 2003 und 2015 aufgezeigt, während ich im zweiten Schritt die großen, durch die Expansion und Konsolidierung eines neuen Agrarmodells (Agrobusiness,[39] insbesondere in Bezug auf transgenetisches Soja) hervorgerufenen Transformationen auf dem Land skizziere. Diese brachten die Entstehung von neuen ländlichen, globalisierten Akteuren mit sich, die trotz allem nicht von der alten Agraroligarchie getrennt gedacht werden dürfen. In einem dritten Schritt beziehe ich mich auf die sozialen Proteste und die Entstehung von neuen sozialen Bewegungen – sowohl jene, die vom Zentrum, als auch jene, die von der Peripherie der Macht ausgehen. Und in einem vierten Schritt zeige ich – im Vergleich mit anderen historischen Momenten (dem Menemismus) – die soziale Transformation auf, die unter Kirchner stattgefunden hat, und skizziere das aktuelle politische Szenario und die sozialen Kämpfe im post-kirchnerischen Argentinien. Zum Schluss des Kapitels problematisiere ich erneut die Beziehung zwischen Progressivismen und linken Strömungen, um diese Reflexion in den neuen geopolitischen Kontext zu überführen.
Bevor ich diesen Weg einschlage, möchte ich jedoch zunächst eine Klarstellung bezüglich der von mir vorgeschlagenen theoretischen und politischen Perspektive vornehmen, die nicht nur an das kritische Denken appelliert, sondern auch den demokratischen und antihegemonialen sozialen Kämpfen in Lateinamerika verpflichtet ist. Diese Verpflichtung, die anfangs eher national verankert war (zunächst gegenüber den Beschäftigungslosenbewegungen und ab 2006 gegenüber Umwelt- und Sozial-Asambleas und Pueblos Indígenas[40]), weitete sich zunehmend und im Rhythmus des progressiven Zyklus auf andere Regionen aus, insbesondere auf Bolivien und Ecuador – zwei Länder, die beispielhaft für diese Zeit sind. Bei der Beschäftigung mit diesen Themen bzw. Ländern hatte ich das Privileg, in den Dialog mit zahlreichen Kolleg*innen (sowohl Aktivist*innen als auch Intellektuelle) aus der lateinamerikanischen und europäischen Linken zu treten, von denen viele zunächst die unterschiedlichen Erfahrungen im progressiven Zyklus unterstützten und begleiteten, sich aber zunehmend kritisch von diesen Prozessen distanzierten.
Natürlich müssen wir berücksichtigen, dass der Rohstoffkonsens einen Graben, wenn nicht sogar eine Wunde im kritischen lateinamerikanischen Denken hinterlassen hat, welches als ideologische Triebkraft noch in den 90er-Jahren und im Kontext des monopolisierenden Charakters des Neoliberalismus deutlich vereinter war. Im Unterschied hierzu war der Progressivismus durch gegensätzliche Tendenzen geprägt, bei denen zwischen folgenden Positionierungen unterschieden werden muss: Auf der einen Seite standen jene, die einen ›weisen und sinnvollen‹ Kapitalismus forderten, der den räuberischen Extraktivismus bändigen sollte, sodass dieser mit Progressivismus und sozialer Inklusion harmoniere. Auf der anderen standen diejenigen, die sich kritisch positionierten, die vor allem aus der Linken kamen und den Extraktivismus als Ganzes infrage stellten, die die sozialen und institutionellen Grenzen der real existierenden Progressivismen aufzeigten und die Notwendigkeit eines alternativen politischen und zivilisatorischen Paradigmas einforderten.
Von jenen Menschen, die diesen letzteren Weg gingen – einen Weg, der meist der ungemütlichere war und zum Teil zur politischen Marginalisierung führte –, möchte ich hier insbesondere danken: zum einen den Freund*innen der Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (Ständige Arbeitsgruppe für Alternativen zu Entwicklung),[41] gegründet in Quito 2010, sowie meinen Kolleg*innen von Plataforma (Plattform), einem Kollektiv, das wir 2012 in Argentinien gründeten.
Im Beisammensein und im Austausch mit ihnen – im Rahmen von Foren, Treffen, Gesprächen, dem gemeinsamen Erleben unterschiedlicher sozialer Erfahrungen – wurde mir die Bedeutung bewusst, die Kollektive für den Aufbau kritischen Denkens haben, wie auch die überragende Relevanz öffentlicher Intervention und die Begleitung gesellschaftlicher Kämpfe durch Soli-Aktionen und andere Praktiken der Solidarität. Und nicht zuletzt muss auch die regenerierende Kraft jenes Wissens anerkannt werden, das außerhalb der Wissenschaft produziert wird.
Letztendlich wissen wir nicht, in wie weit der konservative Backlash bzw. der Rechtsruck, der heute Lateinamerika durchzieht, es uns ermöglicht, neue Dialoge mit den Kolleg*innen und Aktivist*innen zu führen, die bis vor Kurzem noch die real existierenden Progressivismen unterstützt haben und meinten, dass diese ›die einzig mögliche Linke‹ darstellten. Falls dieser Dialog möglich ist, dann ist die vor uns liegende Aufgabe außerordentlich komplex und schwierig, denn es geht dann darum, zusammen eine post-progressive Linke zu denken, die soziale und antipatriarchale Gerechtigkeit mit ökologischer Gerechtigkeit vereint. Und es steht zu befürchten, dass es ohne die Verflechtung dieser drei Achsen in ein und demselben Strang nur wenige Möglichkeiten geben kann, die linken Strömungen auf eine Weise zu reorganisieren, die wirklich demokratisch, plural und emanzipatorisch ist.
Maristella Svampa, Buenos Aires, 10.01.2017
ERSTER TEILProgressivismus, neuer Zyklus kollektiven Handelns und die Expansion des Extraktivismus
Soziale Bewegungen, politische Traditionen und Dimensionen des kollektiven Handelns in Lateinamerika
Die politischen Parteien haben in den letzten Jahrzehnten das Monopol auf politische Repräsentation verloren. Im Gegenzug haben sich die sozialen Bewegungen vervielfacht und auf bedeutende Weise ihre diskursive und repräsentative Plattform vergrößert: territoriale und urbane Bewegungen, sozio-ökologische Bewegungen, indigene Bewegungen, Bäuer*innenbewegungen, LGBT*(Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*-)Bewegungen und -Kollektive, Feminismos Populares und Ökofeminismen, neue Syndikate, kulturelle Formate, auch im Bildungsbereich, u.v.m. Sie alle machen verschiedene Identifizierungen und Positionierungen sichtbar. Sie zeigen, dass es in den unterschiedlichsten sozialen Sektoren eine Vielzahl an Erfahrungen im Bereich der Selbstorganisation gibt. Diese Erfahrungen dürfen keinesfalls übersehen oder gar aus der aktuellen sozialen Landschaft weggedacht werden.