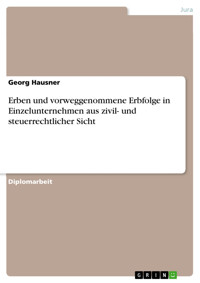
Erben und vorweggenommene Erbfolge in Einzelunternehmen aus zivil- und steuerrechtlicher Sicht E-Book
Georg Hausner
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Jura - Steuerrecht, Note: 1,3, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Gestaltung der Unternehmensnachfolge ist ein brisantes und allzeit aktuelles Thema. Die Brisanz liegt nicht zuletzt in der Problematik, dass der scheidende Unternehmer und zukünftige Erblasser sein „Lebenswerk“ Unternehmen loslassen muss. Die Nachfolgeplanung gehört zu den Entscheidungsproblemen, die ein hohes Maß an Komplexität aufweisen, weil ganz verschiedenen Zielvorstellungen Rechnung getragen werden muss. Es liegt regelmäßig im Interesse des Seniors, dass das Unternehmen in seinem Sinne fortgeführt und nicht etwa, nach seinem Tode, durch rivalisierende Ansprüche der Erben zerschlagen wird1oder in erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten gerät, wenn der Staat seinen Anspruch auf Erbschaft- oder Schenkungsteuer geltend macht. Oft wird eine lebzeitige Übertragung des Unternehmens angestrebt. Diese ist nicht nur erbschaftsteuerlich vorteilhaft, sondern dient in vielen Fällen auch der Altersversorgung der übertragenden Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 4
Abkürzungsverzeichnis
a.A anderer Ansicht
a.F. alte Fassung Abb. Abbildung Abs. Absatz Abschn. Abschnitt AfA Absetzung für Abnutzung Anm. Anmerkung AO Abgabenordnung Art. Artikel
BBBetriebsberater (Zeitschrift) BewG Bewertungsgesetz BFH Bundesfinanzhof BGB Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. Bundesgesetzblatt BGH Bundesgerichtshof BMF Bundesministerium der Finanzen bspw. beispielsweise BStBl. Bundessteuerblatt BV Betriebsvermögen BVerfG Bundesverfassungsgericht BWNotZ Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg
ca.circa
ddes/ der DB Der Betrieb (Zeitschrift) Diss. Dissertation DNotZ Deutsche Notarzeitschrift DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) DSWR Datenverarbeitung Steuer Wirtschaft Recht (Zeitschrift)
EGBGBEinführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch EinzelU Einzelunternehmen
Page 5
ErbBstg Erbfolgebesteuerung (Zeitschrift) ErbSt Erbschaft- und Schenkungsteuer ErbStB Der Erbschaft-Steuerberater (Zeitschrift) ErbStG Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz ErbStH Erbschaft- und Schenkungsteuer-Hinweise vom 17.3.2003, BStBl. I 2003. ErbStR Erbschaft- und Schenkungsteuer-Richtlinien vom 17.3.2003, BStBl. I 2003. ESt Einkommensteuer EStB Der Ertrag-Steuerberater (Zeitschrift) EStG Einkommensteuergesetz EStR Einkommensteuer-Richtlinien vom 15.12.2003, BStBl. Sonder-Nr. 2/2003, S. 3. et al. et alii
f.folgende FamRB Der Familien-Rechtsberater (Zeitschrift) ff. fortfolgende FG Finanzgericht FinVerw. Finanzverwaltung FR Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
GbRGesellschaft bürgerlichen Rechts GewSt Gewerbesteuer GewStG Gewerbesteuergesetz gem. gemäß GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ggf. gegebenenfalls GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbHR GmbH-Rundschau (Zeitschrift) grds. grundsätzlich GrEStG Grunderwerbsteuergesetz GrS Großer Senat
h.M.herrschende Meinung HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung
Page 6
HGB Handelsgesetzbuch HöfeO Höfeordnung
i.d.F.in der Fassung i.d.R. in der Regel i.H.d. in Höhe des/der i.S.d. im Sinne des/der i.S.v. im Sinne von i.V.m. in Verbindung mit IfM Institut für Mittelstandsforschung, Bonn INF Information über Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift) insbes. insbesondere
JStGJahressteuergesetz
KGaAKommanditgesellschaft auf Aktien KÖSDI Kölner Steuerdialog (Zeitschrift)
LPartGGesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
m.E.meiner Einschätzung nach Mio. Million(en) MittBayNotZ Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern (Zeitschrift)
n.F.neue Fassung n.h.M. nach herrschender Meinung NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) Nr. Nummer NV nicht amtlich veröffentlicht NWB Neue Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)
o.g.oben genannt o.V. ohne Verfasser OHG Oberhandelsgesellschaft
Page 7
PflichtteilsEPflichtteilsergänzungsanspruch PV Privatvermögen
RGBl.Reichsgesetzblatt Rn. Randnummer Rz. Randziffer
S.Seite(n); im sachlogischen Zusammenhang auch Satz s.o. siehe oben so gen. so genannt Stbg Die Steuerberatung (Zeitschrift) SteuStud Steuer und Studium (Zeitschrift) StuW Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
Tz.Textziffer
u.a.unter anderem UmwStG Umwandlungsteuergesetz UStG Umsatzsteuergesetz
Verf.Verfasser vgl. vergleiche
WGWirtschaftsgut, Wirtschaftsgüter(n)
ZEVZeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge ZPO Zivilprozessordnung
Page 8
Abbildungsverzeichnis (Text)
Abb. 1: Steuerwert der Bereicherung bei einer gemischt-freigebigen
Zuwendung ................................................................................................... 20 Abb. 2: Begünstigungen von Betriebsvermögen nach dem ErbStG .................. 23 Abb. 3: Klassifizierung der Vermögensübergabe hinsichtlich der Entgeltlichkeit
....................................................................................................................... 55 Abb. 4: Abgrenzung zwischen dauernder Last und Leibrente ........................... 61
Abbildungen und Beispiele im Anhang
Abb. 1 (zu Abschnitt 1.1.): Übergabereife Unternehmen 2005 ....................... VIII Abb. 1 a) (zu Abschnitt 1.1.): Verkauf an Dritte auf dem Vormarsch ............ VIII Abb. 2 (zu Abschnitt 2.2.): Ordnungssystem (Parentelsystem) des deutschen
Erbrechts....................................................................................................... IX Beispiel I (zu Abschnitt 2.5.1.) ............................................................................. IX Abb. 3 (zu Abschnitt 3.1.): Steuerpflichtige Vorgänge gem. § 1 ErbStG..........XII Abb. 4 (zu Abschnitt 3.2.): Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs nach § 10
Abs. 1 ErbStG ............................................................................................ XIII Beispiel II (zu Abschnitt 3.2.): Steuerpflichtiger Erwerb bei gemischt-
freigebigen Zuwendungen und Schenkungen unter Leistungsauflage .. XIV Abb. 5 (zu Abschnitt 3.3.): Steuerklassen, Tarife, Freibeträge ......................... XV Abb. 6 (zu Abschnitt 3.4.): Ausnahmen von der Maßgeblichkeit der
Steuerbilanzwerte ........................................................................................ XV Abb. 7 (zu Abschnitt 3.4.): Bewertung von Grundstücken .............................. XVI Beispiel III (zu Abschnitt 3.4.): Bewertung von Grundstücken...................... XVI Beispiel IV (zu Abschnitt 3.4.): Begünstigung von Betriebsvermögen ..........XVII Abb. 8: Vorteilhaftigkeitsvergleich Übertragungsalternativen ......................XVII Beispiele V - VII (zu den Abschnitten 4.2. und 6.5.): Buchwertfortführung vs.
Aufdeckung stiller Reserven ....................................................................XVII Beispiel VIII (zu Abschnitt 4.2.): Realteilung der Erbengemeinschaft mit
Ausgleichszahlungen ..............................................................................XXIV Beispiel IX (zu Abschnitt 6.1.): Nutzung der Freibeträge .............................. XXV Beispiel X (zu Abschnitt 6.2.): Übernahme der ErbSt durch den Schenker.XXVI Abb. 9 (zu Abschnitt 6.5.2.2.): Ertragbringendes Vermögen nach dem 3.
Rentenerlass .......................................................................................... XXVII Abb. 10 (zu Kapitel 7.): Mögliche Zielhierarchie einer Nachfolgeplanung
...............................................................................................................XXVIII Abb. 11 (zu Kapitel 7.): „Checkliste“ Nachfolge in Einzelunternehmen .....XXIX
Page 1
1. Einleitung
1.1. Bestandsaufnahme
Die Gestaltung der Unternehmensnachfolge ist ein brisantes und allzeit aktuelles Thema. Die Brisanz liegt nicht zuletzt in der Problematik, dass der scheidende Unternehmer und zukünftige Erblasser sein „Lebenswerk“ Unternehmen loslassen muss. Die Nachfolgeplanung gehört zu den Entscheidungsproblemen, die ein hohes Maß an Komplexität aufweisen, weil ganz verschiedenen Zielvorstellungen Rechnung getragen werden muss. Es liegt regelmäßig im Interesse des Seniors, dass das Unternehmen in seinem Sinne fortgeführt und nicht etwa, nach seinem Tode, durch rivalisierende Ansprüche der Erben zerschlagen wird1oder in erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten gerät, wenn der Staat seinen Anspruch auf Erbschaft- oder Schenkungsteuer geltend macht. Oft wird eine lebzeitige Übertragung des Unternehmens angestrebt. Diese ist nicht nur erbschaftsteuerlich vorteilhaft, sondern dient in vielen Fällen auch der Altersversorgung der übertragenden Generation.2
Die praktische Relevanz des Themas Unternehmensnachfolge wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass zwischen 1999 und 2004 etwa 380.000 Unternehmensübertragungen bei Familienunternehmen stattfanden. In den Jahren 2005 bis 2010 werden nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung aller Voraussicht nach ca. 354.000 Unternehmen innerhalb der Familie weitergegeben oder an Dritte verkauft.3Alleine im Jahr 2005 waren es 70.900 Unternehmen mit rund 678.000 Beschäftigten.4Das bedeutet gleichzeitig, dass neben den Eigentümern, Hunderttausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pro Jahr ein originäres Interesse daran haben, dass die vielen individuellen Nachfolgeregelungen zum Erhalt der jeweiligen Unternehmungen - StichwortUnternehmenskontinuität -über die Generationen hinweg beitragen. Mangelnde oder mangelhafte Nachfolgeregelungen gelten schließlich als Ursache für 10% aller Insolvenzfälle und jedes Jahr müssen etwa 5.000 Betriebe stillgelegt werden, weil kein geeigneter Nachfolger gefunden wird.5Lediglich 5 % der Familienunternehmen bleiben bis in die dritte Generation hinein bestehen.6Obwohl die Familiennachfolge noch den größ-
1Vgl.Brüggemann,ErbBstg2005, S. 304.
2Vgl.Sommer/ Godron,DSWR 2005, S. 222.
3Vgl.Neufang,BB 2005, S. 688;Schäfer/ Scherer/ Tank/ Landsittel,BB-Special 5/2004, S. 1.
4Vgl. Abb. 1 im Anhang, S. VIII.
5Vgl.Nitz,BWNotZ 2004, S. 153.
6Vgl.Spiegelberger,Stbg 2002, S. 245.
Page 2
ten prozentualen Anteil an Nachfolgeregelungen ausmacht, sind Verkäufe an Dritte auf dem Vormarsch.7
Die „soziale Gebundenheit“ der Unternehmen, als Garanten von Produktivität und Arbeitsplätzen, erklärt das Interesse des Staates an einer erfolgreichen Nachfolgeplanung, welchem unter anderem dadurch Rechnung getragen wird, dass der Übergang von Betriebsvermögen durch Erbfall oder Schenkung gegenüber Privatvermögen mehrfach begünstigt wird.8Der Gesetzgeber wird aller Voraussicht nach in naher Zukunft das Erbschaftsteuerrecht reformieren, und in diesem Rahmen unter anderem das begünstigte Vermögen auf so genanntes „Produktivvermögen“ begrenzen, um die missbräuchliche Generierung von Betriebsvermögen allein zu Steuersparzwecken - Stichwortgewerblich geprägte Personengesellschaft- zu unterbinden.9
Nicht zu vergessen ist auch der Einfluss einer geregelten Nachfolge auf die Konditionen der Kreditvergabe von Banken. Eine nicht vorhandene oder unzureichende Nachfolgeregelung wirkt sich über das bankeninterne Rating - StichwortBasel II- negativ auf die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens aus. Eine dokumentierte und nachvollziehbare Nachfolgeplanung wird fortan als „soft fact“ bei der Kreditwürdigkeitsprüfung einen wichtigen Platz einnehmen.10
Zahlreiche Veröffentlichungen widmen sich der Nachfolge in Personen- und Kapitalgesellschaften. Da rund zwei Drittel aller gewerblichen Unternehmen in Deutschland jedoch als Einzelunternehmen geführt werden (69.9 % im Jahre 2002),11ist dies m.E. Rechtfertigung genug, diese Arbeit ganz der Nachfolge in Einzelunternehmen zu widmen.
Spiegelbergernennt für eine Nachfolgeplanung 3strategische Regelungsziele,die helfen sollen, das Risiko ihres Scheiterns zu minimieren:12
1.Sicherung derUnternehmenskontinuität(bei Vermögenserhaltung)
7Vgl. Abb. 1a im Anhang, S. VIII ; vlg. auchLingscheid,DSWR 2005, S. 229.
8Auf die in diesem Zusammenhang bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken wird in Ab-
schnitt 3.4, S. 21 ff. näher eingegangen.
9Vgl.Crezelius,FR 2005, S. 1223;Spiegelberger,Stbg 2005, S. 549 f. Die anstehende Reform
des Erbschaftsteuerrechts im Hinblick auf die Begünstigungen des Betriebsvermögens wird in
dieser Arbeit nicht behandelt. Der interessierte Leser findet einen sehr guten Überblick in der
einschlägigen Fachliteratur, so z. B.Spiegelberger,Stbg 2005, S. 551 ff.Schimpfky/ Schneider,
DSWR 2005, S. 218 ff; Kritisch zu den geplanten Änderungen hinsichtlich der gewerblich ge-
prägten Personengesellschaften äußert sichCarlé,KÖSDI 2005, S. 14746.
10Vgl.Carlé,KÖSDI 2005, S. 14746; Vgl. auchSchäfer/ Scherer/ Tank/ Landsittel,BB-Special
5/2004, S. 1.
11Vgl.Günterberg/ Kayser,SMEs in Germany, Facts and Figures 2004, Figure 2, S. 12.
12Vgl.Spiegelberger,Stbg 2002, S. 250 ff.
Page 3
2.RechtssicherheitundSicherung des Familienfriedens
3.Sicherung derAltersversorgungdes Übergebers und seines
Ehepartners
Aus steuerlicher Sicht liegt die Herausforderung einer Nachfolgeplanung und Nachfolgeberatung darin, diese Ziele so zu gestalten, dass sie mit einer möglichst geringen Steuerbelastung einhergehen.13Hierauf liegt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit, obgleich die steuerrechtliche Analyse einer Unternehmensnachfolge im Gesamtkontext neben nicht minder wichtigen gesellschafts- und familienrechtlichen sowie psychologischen Aspekten steht.14Nicht umsonst wird in der Literatur häufig vom so gen.magischen Quadrat15der Nachfolgeplanung gesprochen.
Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch, den gesamten facettenreichen Prozess der Nachfolgeplanung zu beschreiben. Dieser könnte im begrenzten Rahmen einer Diplomarbeit ohnehin nur grob skizziert werden. Der interessierte Leser findet auch zu den hier bewusst vernachlässigten Gebieten (Familienrecht, Psychologie) genügend Fachliteratur.16
1.2. Zielsetzung der Arbeit
Die folgenden Ausführungen sollen dem Leser nach einem kurzen Überblick über das Erbrecht vermitteln, welche Auswirkungen unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Nachfolgeplanung von Einzelunternehmen auf die Erbschaft - und ggf. Einkommensteuerbelastung der beteiligten Parteien haben, und welche Gestaltungen unter steuerlichen Gesichtspunkten dergestalt vorteilhaft sind, dass sie mit einer möglichst geringen Steuerbelastung einhergehen.
Das Vermögen kann sowohl durch denErbfallim Wege der gesetzlichen oder gewillkürten Erbfolge, als auch schon zu Lebzeiten im Rahmen einervorweggenommenen Erbfolgean den oder die Erben übergehen. Diese zwei Möglichkeiten und noch eine dritte, falls es zu derAuseinandersetzungeiner Erbengemeinschaft kommt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten und die jeweils damit verbundenen Steuerlasten divergieren. Auch die betroffenen Steuerarten divergieren je nach Übertragungsform und Zeitpunkt:
13Vgl.Sommer/ Godron,DSWR 2005, S. 224.
14Vgl.Sommer/ Godron,DSWR 2005, S. 223.
15In Anlehnung anFlick,DStR 1993, S. 930. Die Ecken des „magischen Quadrats“ sind Zivil-
recht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und Psychologie.
16Einen interessanten Überblick über die Gesamtproblematik der Nachfolge in Familienunterneh-
men aus rechtlicher und psychologischer Sicht bietenHuber/ Sterr-Kölln,Nachfolge in
Familienunternehmen, 2006.
Page 4
Während der Erbfall Erbschaftsteuer auslöst, spielt bei der Erbauseinandersetzung die Einkommensteuer eine Rolle, und bei der Übertragung durch teilweise Schenkung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge spielen beide Steuerarten eine entscheidende Rolle.17Neben der Erörterung verschiedener Gestaltungen letztwilliger Verfügungen (Teilungsanordnung, Vorausvermächtnis,
Alleinerbensetzung) wird ein Hauptaugenmerk auf der lebzeitigen Übertragung des Unternehmens gegen wiederkehrende Leistungen liegen, da hier, je nach Interessenlage sehr flexibel gestaltet werden kann, aber auch die größten steuerlichen Probleme auftreten. Es gelten die folgenden Prämissen:
•Übertragen wird ein Einzelunternehmen durch eine natürliche Person.
•Der Übertragungsvorgang soll möglichst ertragsteuerneutral nach § 6 Abs.
3 EStG geschehen. Auf Gefahren der Realisierung stiller Reserven wird an geeigneten Stellen eingegangen.
•Es gibt einen geeigneten Nachfolger unter den Abkömmlingen des
Übergebers, der entweder als Alleinerbe, oder durch Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft, oder im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge, die Nachfolge in das Einzelunternehmen antritt und dieses als solches fortführt.18
•Der finalen Übernahme des Einzelunternehmens durch den Nachfolger
kann im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge die Begründung einer Mitunternehmerschaft mit dem ursprünglichen Einzelunternehmer vorgeschaltet sein.
•Privatvermögen spielt nur bei der Abfindung weichender Erben eine Rolle.
Ansonsten wird ausschließlich die Übertragung von inländischem Betriebsvermögen i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG i. V. m. § 121 BewG be-handelt.
•Die relevanten Steuerarten sind die Erbschaftsteuer und die Grunderwerbsteuern19Einkommensteuer. Gewerbesteuern, und
Umsatzsteuern20spielen bei Erbfällen und Schenkungen eine nachrangige Rolle und werden auch so behandelt.
17Vgl.Hörger/ Stephan/ Pohl,Unternehmens- und Vermögensnachfolge, Rz. 32 ff.
18Der Verkauf an Dritte, die Errichtung einer Familienstiftung, oder die Beteiligung der
Geschwister des Nachfolgers durch eine Unterbeteiligung in Form der typisch- oder atypisch
stillen Gesellschaft werden in dieser Arbeit nicht behandelt.
19Grunderwerbsteuer und Erbschaftsteuer schließen sich grundsätzlich gegenseitig aus (§ 3 Nr. 2
GrEStG). Ausnahmen gibt es bei teilentgeltlichen Erwerben (§ 3 Nr. 2 S. 2 GrEStG). Vgl.
Ramb,SteuStud 2003, S. 541;Sackin Boruttau, GrEStG, § 3, Rz. 243 ff.
20Erbschaften und Schenkungen sind grundsätzlich nicht umsatzsteuerbar, da es an einem Leis-
tungsaustausch fehlt. Durch Fiktion eines Leistungsaustauschs können Schenkungen in
Page 5
Die Arbeit schließt mit einer aus den vorangegangenen zivil- und steuerrechtlichen Überlegungen abgeleiteten allgemeinen „Checkliste“ für die erfolgreiche Übertragung eines Einzelunternehmens.
2. Vererbung eines Einzelunternehmens
Nach § 22 Abs. 1 HGB ist ein Einzelunternehmen grundsätzlich vererbbar.21Aktiva und Passiva des Einzelunternehmens fallen zum Zeitpunkt des Erbfalles als Sachgesamtheit in den Nachlass und werden Teil der Gesamtrechtsnachfolge („Universalsukzession“, § 1922 BGB).22Der Erbe oder die Erben kann/ können die bisherige Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführen.23Fällt das Unternehmen jedoch an eine Erbengemeinschaft und führt diese das Unternehmen fort, muss sie den Rechtsformzusatz „in Miterbengemeinschaft“ oder dergleichen in die Firma aufnehmen.24Die folgenden Abschnitte zeigen, nach einer kurzen Einführung in das allgemeine Erbrecht, wie ein Einzelunternehmen im Erbgang übertragen wird und welche rechtlichen Konsequenzen sich für den Erben oder die Erbengemeinschaft ergeben.
2.1. Grundlagen des Erbrechts
Erbfähig sind nach deutschem Erbrecht natürliche und juristische Personen, noch nicht rechtsfähige Stiftungen (§ 84 BGB) sowie der gezeugte, aber noch nicht geborene Mensch (§ 1923 Abs. 2 BGB).25Unter dem Erbfall versteht man den Tod einer natürlichen Person (§ 1922 Abs. 1 BGB).26Das negative oder positive Vermögen des Erblassers geht mit dem Zeitpunkt seines Todes perGesamtrechtsnachfolgeauf den oder die Erben über. Bei dieser handelt es sich nicht etwa um ein Rechtsgeschäft, sondern um einen Erwerb kraft Gesetzes (§ 1942 BGB).27Daher kommt es auch nicht auf die Rechtsfähigkeit oder ein Mindestalter der Erben an.28Der Erbfall vollzieht sich automatisch mit dem Versterben des
bestimmten Fällen (§ 3 Abs. 1b UStG) umsatzsteuerpflichtig sein. Vgl.Ramb,SteuStud 2003,
S. 541 f.
21Vgl.Edenhoferin Palandt, BGB, § 1922, Rz. 14;Hoptin Baumbach/ Hopt, HGB, § 22, Rz. 2.
22Vgl.Edenhoferin Palandt, BGB, § 1922, Rz. 7;Olzen,Erbrecht, Rz. 87 ff;Ramb,SteuStud
2003, S. 568.
23Vgl. § 22 Abs. 1 HGB;Canaris,Handelsrecht, § 10, Rz. 24.
24Vgl.Canaris,Handelsrecht, § 9, Rz. 13.
25Vgl.Leipold,Erbrecht, Rz. 22.
26Vgl.Edenhoferin Palandt, BGB, § 1922, Rz. 2.
27Vgl.Edenhoferin Palandt. BGB, § 1942, Rz. 1;Ramb,SteuStud 2003, S. 568.
28Vgl.Olzen,Erbrecht, Rz. 79.





























