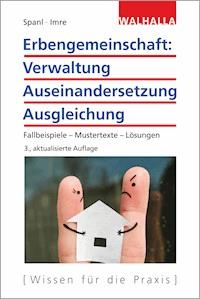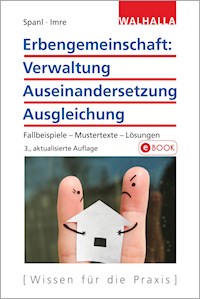
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Allen gehört alles gemeinsam...
...so lautet die einfache gesetzliche Regelung nach dem Tod des Erblassers. Aber welche Lösungen bieten sich an, wenn keine Einigkeit unter den Erben besteht oder die Gemeinschaft aufgelöst werden soll?
Der Fachratgeber Erbengemeinschaft: Verwaltung - Auseinandersetzung - Ausgleichung erörtert alle wichtigen Fragen:
- Verwaltung in der Gemeinschaft
- Haftung für Nachlassverbindlichkeiten
- Aufhebung der Gemeinschaft
- Ausgleichung von Vorempfängen
- Berücksichtigung von Pflegeleistungen
- Erbrechtliche Nachfolge bei Unternehmen und in der Landwirtschaft
Die schwierige Aufhebung der Gemeinschaft berücksichtigt die wertentsprechende Zuordnung von Gegenständen und Forderungen, die Übertragung von Miterbenanteilen, das gerichtliche Vermittlungsverfahren, die Erbteilungsklage, die Grundstücksversteigerung und Teilung des Erlöses.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
3. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Allen gehört alles gemeinsam...
...so lautet die einfache gesetzliche Regelung nach dem Tod des Erblassers. Aber welche Lösungen bieten sich an, wenn keine Einigkeit unter den Erben besteht oder die Gemeinschaft aufgelöst werden soll?
Der Fachratgeber Erbengemeinschaft: Verwaltung - Auseinandersetzung - Ausgleichung erörtert alle wichtigen Fragen:
Verwaltung in der GemeinschaftHaftung für NachlassverbindlichkeitenAufhebung der GemeinschaftAusgleichung von VorempfängenBerücksichtigung von PflegeleistungenErbrechtliche Nachfolge bei Unternehmen und in der LandwirtschaftDie schwierige Aufhebung der Gemeinschaft berücksichtigt die wertentsprechende Zuordnung von Gegenständen und Forderungen, die Übertragung von Miterbenanteilen, das gerichtliche Vermittlungsverfahren, die Erbteilungsklage, die Grundstücksversteigerung und Teilung des Erlöses.
Autor
Reinhold Spanl ist Hochschullehrer a.D. Er schult bundesweit ehrenamtlich und beruflich tätige Betreuer, auch in erbrechtlichen Fragen. Erfolgreicher Fachautor.
Andrea Imre, Dipl-Rechtspflegerin, Lehrbeauftragte an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Rechtsbereich Rechtspflege in Starnberg.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Miterbengemeinschaft
2. Anteil der Miterben am Nachlass
3. Verwaltung des Nachlasses in der Gemeinschaft
4. Haftung der Miterben für Nachlassverbindlichkeiten
5. Auseinandersetzung der Miterbengemeinschaft
6. Besonderheiten im Gesellschaftsrecht
7. Erbrecht in der Landwirtschaft
8. Gesetzliche Grundlagen
9. Literaturverzeichnis
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Von der schönen Einigkeit zur Erbteilungsklage
Abkürzungen
Von der schönen Einigkeit zur Erbteilungsklage
Nach dem Tod eines Menschen geht sein Vermögen auf den Erben über; mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft. Solange die Gemeinschaft besteht, kann der einzelne Miterbe nicht auf Nachlassgegenstände zugreifen und die Miterben haben bei der Verwaltung des Nachlasses bestimmte Regeln zu beachten.
Eine Veräußerung des Miterbenanteils durch die einzelnen Miterben ist möglich, allerdings ist das notariell zu beurkunden. Die übrigen Miterben können den Eintritt von gemeinschaftsfremden Personen durch die Ausübung eines Vorkaufsrechts verhindern.
Ein großes Problem der Erbengemeinschaft kann die Auseinandersetzung unter den Miterben darstellen, insbesondere wenn über wertbildende Faktoren unterschiedliche Ansichten herrschen und/oder die Zuteilung bestimmter Gegenstände zu Streit führt. Dann ist eine Teilungsklage vor dem Prozessgericht der letzte Ausweg.
Der Gesetzgeber wollte eine gleichmäßige Verteilung des Vermögens des Erblassers unter seinen Abkömmlingen in der gesetzlichen Erbfolge erzielen. Somit sind Zuwendungen zu Lebzeiten sowie erbrachte Pflegeleistungen auszugleichen.
Im Mittelpunkt dieses praxisorientierten Leitfadens stehen:
die Verfügung des Miterben über seine Beteiligung an der Gemeinschaft sowie die Ausübung des Vorkaufsrechts der anderen Miterben
die Verwaltungstätigkeit in der Gemeinschaft und die Vertretung durch die Miterben
die Haftung der Erben für Nachlassverbindlichkeiten und die Ergreifung haftungsbegrenzender Maßnahmen
die Auseinandersetzung der Gemeinschaft unter Einbeziehung der gesetzlichen Regeln, des Teilungsvertrags, der gerichtlichen Vermittlung und der Teilungsklage
die Ausgleichungspflicht unter den Miterben
die Besonderheiten im Gesellschaftsrecht und bei der Erbfolge in der Landwirtschaft
Reinhold SpanlAndrea ImreAbkürzungen
Abs.AbsatzAktGAktiengesetzAnfGAnfechtungsgesetzAz.AktenzeichenBayObLGBayerisches Oberstes LandgerichtBeckOK/BearbeiterBeck'scher Online-Kommentar/BearbeiterBGBBürgerliches GesetzbuchBGHBundesgerichtshofBGHZEntscheidungen des Bundesgerichtshofs in ZivilsachenBNotOBundesnotarordnungBVerfGBundesverfassungsgerichtDNotZDeutsche Notar-ZeitschriftEGBGBEinführungsgesetz zum Bürgerlichen GesetzbuchFamFGGesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen GerichtsbarkeitFamRZZeitschrift für das gesamte FamilienrechtFGGFreiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (aufgehoben)GBOGrundbuchordnungGmbHGGmbH-GesetzGrdstVGGrundstücksverkehrsgesetzGVGGerichtsverfassungsgesetzHGBHandelsgesetzbuchHöfeOHöfeordnungHöfeVfOVerfahrensordnung für HöfesachsenHRRHöchstrichterliche RechtsprechungHSHalbsatzInsOInsolvenzordnungi. V. m.in Verbindung mitKGKammergerichtLGLandgerichtLPartGGesetz über die Eingetragene LebenspartnerschaftMDRMonatszeitschrift für Deutsches RechtMot.Motive zum Bürgerlichen GesetzbuchMüKo/BearbeiterMünchener Kommentar zum BGB/BearbeiterNdsFGGNiedersächsisches Gesetz über die freiwillige GerichtsbarkeitNJWNeue Juristische WochenschriftNJW-RRNJW-Rechtsprechungs-Report ZivilrechtOHGOffene HandelsgesellschaftOLGOberlandesgerichtOLGROLG Report (Zeitschrift)Palandt/BearbeiterPalandt, Bürgerliches Gesetzbuch (Kommentar)/BearbeiterRdLRecht der Landwirtschaft (Zeitschrift)RG RechtDas Recht – Rundschau für den deutschen Juristenstand (Zeitschrift)RGZEntscheidungen des Reichsgerichts in ZivilsachenRnRandnummerRpflegerDer Deutsche Rechtspfleger (Zeitschrift)RsprRechtsprechungS. SeiteWMZeitschrift für Wirtschafts- und BankrechtZErbZeitschrift für die Steuer- und ErbrechtspraxisZEVZeitschrift für Erbrecht und VermögensnachfolgeZPOZivilprozessordnung1. Miterbengemeinschaft
Wie kommt eine Erbengemeinschaft zustande?
Was ist eine Gesamthandsgemeinschaft?
Wie kommt eine Erbengemeinschaft zustande?
Der Übergang der Erbschaft als Ganzes (§ 1922 Abs. 1 BGB) auf eine Mehrheit von Erben führt zu einer Erbengemeinschaft (Gesamthandsgemeinschaft), § 2032 Abs. 1 BGB. Der Nachlass wird zum gemeinschaftlichen Vermögen der Erben. Träger der Nachlassrechte und Schuldner der Nachlassverbindlichkeiten sind die Erben in ihrer Gesamtheit (in Gemeinschaft).
Der einzelne Miterbe ist nicht Miteigentümer nach Bruchteilen (an den einzelnen Nachlassgegenständen), sondern zusammen mit den anderen Beteiligten Eigentümer des gesamten Vermögens.
Der Nachlass stellt beim Übergang auf die Erbengemeinschaft ein Sondervermögen dar, das vom Eigenvermögen der einzelnen Miterben grundsätzlich getrennt zu betrachten ist.
Nachlassgegenstände gehen als Ganzes auf die Erbengemeinschaft über, nicht auf die Miterben entsprechend ihrer Erbquoten. So wird zum Beispiel bei einem Nachlassgrundstück als Eigentümerin die Erbengemeinschaft in das Grundbuch eingetragen, wobei die Angabe der Quoten unterbleibt.
Die Verfügung über einzelne Nachlassgegenstände durch einzelne Miterben ist ausgeschlossen, § 2033 Abs. 2 BGB (ein Anteil an einzelnen Gegenständen existiert überhaupt nicht, da nur der Nachlass als Ganzes vorhanden ist); die Gemeinschaft (alle Miterben gemeinschaftlich) kann über Nachlassgegenstände verfügen, § 2040 Abs. 1 BGB.
Einer von drei Miterben kann somit zum Beispiel nicht über einen 1/3-Anteil am Nachlasskonto verfügen (§ 2033 Abs. 2 BGB), wohl aber kann dies die Gemeinschaft (alle Miterben gemeinschaftlich), § 2040 Abs. 1 BGB.
Grundsätzlich haften die Miterben als Gesamtschuldner (mit ihrem gesamten Vermögen), § 2058 BGB. Verlangen Nachlassgläubiger vor Auseinandersetzung der Gemeinschaft Befriedigung von einem Miterben, kann dieser den Zugriff in sein Eigenvermögen verhindern, § 2059 Abs. 1 Satz 1 BGB.
Erst nach Auflösung der Erbengemeinschaft (Auseinandersetzung) können Nachlassgläubiger auf das Vermögen der einzelnen Miterben zugreifen; es bleibt grundsätzlich bei der gesamtschuldnerischen Haftung der Miterben (§ 2058 BGB).
Was ist eine Gesamthandsgemeinschaft?
Die Gesamthandsgemeinschaft ist keine juristische Person und hat somit keine Rechtsfähigkeit. Seit der BGH-Entscheidung zur BGB-Gesellschaft1 wird zwar wieder verstärkt diskutiert, ob auch der Erbengemeinschaft eine (beschränkte) Rechtsfähigkeit zukommen soll,2 der BGH bleibt aber auch in neueren Entscheidungen dabei, dass die Rechtsstellung der Erbengemeinschaft nicht mit der BGB-Gesellschaft vergleichbar ist. In beiden Fällen ist zwar ein gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen vorhanden. Die Erbengemeinschaft ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass sie – anders als die BGB-Gesellschaft – nicht rechtsgeschäftlich, sondern gesetzlich begründet wird. Sie ist zudem keine werbende Gemeinschaft, da sie – im Gegensatz zur BGB-Gesellschaft – nicht auf Dauer angelegt, sondern auf Auseinandersetzung gerichtet ist.3
Es wurde durch eine Erbengemeinschaft als Vermieterin ein Mietvertrag geschlossen, wobei folgende Bezeichnung aufgenommen wurde: „die Erbengemeinschaft S vertreten durch K“. Dies genügte dem BGH nicht als bestimmbare Bezeichnung der Vertragspartei: die Miterben hätten namentlich genannt werden müssen.
Mit Entscheidung vom 17.10.2006 hat der 8. Zivilsenat des BGH4 nochmals bekräftigt, dass die Erbengemeinschaft weder rechtsfähig noch parteifähig ist. Die Grundsätze zur Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts5 und zur Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer6 sind nicht auf die Erbengemeinschaft zu übertragen.
Rechtsbeziehungen, die zwischen dem Erblasser und einzelnen Miterben existierten, bestehen nun zwischen der Miterbengemeinschaft und den Miterben. Das Sondervermögen des Nachlasses und das Eigenvermögen des einzelnen Miterben sind Vermögen verschiedener Rechtsträger.7
Was aufgrund eines zum Nachlass gehörenden Rechts oder als Ersatz für zerstörte, beschädigte bzw. entzogene Nachlassgegenstände oder rechtsgeschäftlich für den Nachlass erworben wird, gehört zum Nachlass (§ 2041 BGB). Die Vorschrift will zugunsten der Erbengemeinschaft und der Nachlassgläubiger den Bestand des Nachlasses vor Wertminderungen durch Außenstehende und durch Miterben schützen.8
Die Gesamthandsbindung des Nachlasses bewirkt auch einen Schutz der Nachlassgläubiger, zu deren Befriedigung der Nachlass dienen soll. Nur die Nachlassgläubiger können sich gemäß § 2059 Abs. 2 BGB aus dem ungeteilten Nachlass befriedigen. Eine Zwangsvollstreckung in Nachlassgegenstände setzt einen Titel gegen alle Miterben voraus, § 747 ZPO. Mit einem Vollstreckungstitel gegen den einzelnen Miterben kann nur nach § 859 ZPO durch Pfändung auf seinen Anteil am Nachlass zugegriffen, nicht aber in Gegenstände des ungeteilten Nachlasses vollstreckt werden. Die Eigengläubiger können sich nur an das halten, was ihr Schuldner als Miterbe bei der Auseinandersetzung bekommt.
Näheres zur Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Nachlass und gegen einzelne Miterben siehe Kapitel 4.
Im Zusammenhang mit einer Erbengemeinschaft ergeben sich überwiegend zwei Problembereiche:
Was kann der (spätere) Erblasser bereits vor dem Erbfall unternehmen, um die Verwaltung und Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft nach seinen Vorstellungen zu gestalten?
Wie kann ein Miterbe nach Eintritt des Erbfalls seine Rechte bei der Verwaltung und Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft durchsetzen?
Erblasseranordnungen
Der (spätere) Erblasser kann in einer Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) Anordnungen treffen, welche sich auf die Zuordnung seiner Vermögensgegenstände nach dem Tod auswirken. Dabei ergeben sich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten:
Verhinderung einer Erbengemeinschaft
Besteht die Befürchtung, dass es zwischen mehreren Miterben (z. B. Abkömmlingen) zum Streit über die gemeinschaftliche Nachlassverwaltung und die Auseinandersetzung kommen wird, kann der Erblasser in einem Testament eine Person als Erben bestimmen und den übrigen Vermächtnisse zukommen lassen, welche wertmäßig den Erbteilen entsprechen.
Anordnung einer Testamentsvollstreckung
Streitverhindernd wirkt sich die Testamentsvollstreckung aus. Bestimmt der Erblasser einen Testamentsvollstrecker in seiner letztwilligen Verfügung, hat dieser gemäß § 2204 BGB die Auseinandersetzung zu bewirken. Dabei ist er an gesetzliche Regeln und die Anordnungen des Erblassers gebunden. Auch ist nach den §§ 2205, 2216 BGB gewährleistet, dass die Verwaltung des Nachlasses bis zur Auseinandersetzung den Anordnungen des Erblassers entspricht. Interessant dabei ist, dass auch ein Miterbe Testamentsvollstrecker sein kann.
Teilungsanordnung
Für die spätere Auseinandersetzung unter den Miterben kann der Erblasser durch Verfügung von Todes wegen nach § 2048 BGB bestimmte Anordnungen dazu treffen, wie die einzelnen Nachlassgegenstände zu verteilen sind. Diese Teilungsanordnung hat keinen Einfluss auf die Erbquoten. Der Wert der zugeordneten Gegenstände wird auf den Erbanteil angerechnet. Die Anordnung hat nur schuldrechtliche Wirkung. Somit kann zwar jeder Miterbe den Vollzug einfordern, jedoch können sich alle Miterben einstimmig durch Vereinbarung darüber hinwegsetzen. Nur ein Testamentsvollstrecker ist gemäß §§ 2204, 2048 BGB gebunden.
Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen Teilen ein. Darüber hinaus bestimme ich, dass bei der Auseinandersetzung A das Hausgrundstück in Regensburg, B die Eigentumswohnung in München und C das gesamte Konten- und Wertpapiervermögen erhalten sollen.
Vorausvermächtnis
Durch die Bestimmung eines Vorausvermächtnisses gemäß § 2150 BGB in seiner Verfügung von Todes wegen kann der Erblasser einem Miterben zusätzlich zu seinem Erbteil einen bestimmten Vermögensvorteil zuwenden, der nicht auf den Erbteil angerechnet wird.
Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen Teilen ein. Darüber hinaus bestimme ich, dass A vorweg und zusätzlich das Hausgrundstück in Regensburg erhalten soll.
Teilungsverbot
Der Erblasser kann nach § 2044 BGB durch letztwillige Verfügung die Auseinandersetzung in Ansehung des Nachlasses oder einzelner Nachlassgegenstände ausschließen oder von der Einhaltung einer Kündigungsfrist abhängig machen. Damit kann er erreichen, dass der Nachlass zunächst als Einheit bestehen bleibt, bis bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Auch diese Anordnung hat nur schuldrechtliche Wirkung, so dass sich die Miterben durch einstimmige Vereinbarung darüber hinwegsetzen können. Nur ein Testamentsvollstrecker ist nach den §§ 2204, 2044 BGB gebunden.
Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen Teilen ein. Darüber hinaus bestimme ich in Bezug auf mein Einzelunternehmen, dass insoweit die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft erst erfolgen darf, wenn auch C das 30. Lebensjahr vollendet hat. Erst dann darf entschieden werden, wer das Geschäft fortführt oder ob es veräußert bzw. aufgelöst werden soll.
Der BFH9 hat dargelegt, dass für die Abgrenzung zwischen Teilungsanordnung und Vorausvermächtnis entscheidend ist, ob die zu beurteilende Regelung zu einer Wertverschiebung bei den Erbquoten führt. Hat der Erblasser einem Miterben Gegenstände zugewiesen, deren Wert objektiv höher ist als diesem seiner Quote nach bei der Auseinandersetzung zukäme, so kommt es darauf an, ob der Erblasser subjektiv dem durch die Anordnung begünstigten Miterben zusätzlich zu seinem Erbteil auch noch den Mehrwert zuwenden wollte (dann liegt ein Vorausvermächtnis vor) oder ob nach seinem Willen eine Wertverschiebung dadurch ausgeschlossen sein soll, so dass der Bedachte hinsichtlich des Mehrwerts den übrigen Miterben Wertausgleich aus seinem eigenen Vermögen zahlen muss (dann handelt es sich um eine Teilungsanordnung).
Schiedsklausel
Durch eine in einer letztwilligen Verfügung eingebrachte Schiedsklausel gemäß §§ 1066, 1029 ZPO kann der Erblasser anordnen, dass erbrechtliche Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollen. Bei dieser Bestimmung dürfte es sich um eine Auflage handeln, welche die Miterben verpflichtet, Auseinandersetzungsstreitigkeiten nicht durch ein (staatliches) Gericht, sondern durch einen Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 1066 ZPO ist es unbedenklich, durch letztwillige Verfügung einen Dritten als Schiedsrichter einzusetzen. Testamentsvollstrecker oder ein Miterbe können nicht Schiedsrichter sein.
Ich setze meine drei Kinder A, B und C als Erben zu gleichen Teilen ein.
Streitigkeiten der Erben untereinander soll ein Schiedsrichter unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges entscheiden, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Zum Schiedsrichter bestimme ich Rechtsanwalt R. Kann oder will dieser das Amt nicht übernehmen, so soll der Präsident des Landgerichts L einen Schiedsrichter ernennen.
Der Schiedsrichter hat den Streit nach Maßgabe der bestehenden Gesetze und den anerkannten Auslegungsregeln unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Billigkeit zu entscheiden. Tatsachen kann der Schiedsrichter auf Kosten des Nachlasses durch einen Schiedsgutachter feststellen lassen. Der Schiedsrichter erhält als Honorar die Gebühren eines Rechtsanwalts in der Berufungsinstanz, wobei die Termingebühr doppelt anfällt. Auslagen darf der Schiedsrichter zusätzlich abrechnen.
Vorweggenommene Erbfolge
Unter vorweggenommener Erbfolge versteht man die Übertragung des Vermögens oder eines wesentlichen Teils davon durch den (künftigen) Erblasser auf einen oder mehrere als (künftige) Erben in Aussicht genommene Empfänger.10 Es handelt sich um Rechtsgeschäfte unter Lebenden.11
Eine typische Gestaltung ist der sogenannte Übergabe- oder Überlassungsvertrag. Er kann dann sinnvoll die Entstehung und Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft verhindern, wenn die Übertragung der Vermögensgegenstände auf einen oder mehrere (künftige) Erben erfolgt und diesen oder diese zu Abfindungszahlungen (auch Gleichstellungsgelder genannt) an weichende (künftige) Miterben verpflichtet. Zusätzlich kann der Überlassungsempfänger durch (notarielle) Vereinbarung mit dem (künftigen) Erblasser durch einen Erbverzicht (§ 2346 ff. BGB) aus der späteren Erbengemeinschaft ausscheiden.
Für den (künftigen) Erblasser ist es von erheblicher Bedeutung, dass im Vertrag Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung seiner lebzeitigen Versorgung enthalten sind, zum Beispiel Nießbrauchsrechte, Rentenreallasten, Wohnungsrecht, persönliche Versorgungsleistungen (im Rahmen eines Altenteils, Leibgedings).
Nicht vergessen werden sollten Überlegungen darüber, wer die Kosten eines Pflegeheims zu tragen hat, wenn ein eingeräumtes Wohnungsrecht nicht mehr ausgeübt werden kann; in diesem Zusammenhang ist auch vorab zu klären, inwieweit das nichtausgeübte Recht bestehen bleibt oder erlöschen soll.
Auch die Möglichkeit einer Rückübertragungsverpflichtung sollte in Erwägung gezogen werden für den Fall, dass der Übernehmer Vorgaben des (künftigen) Erblassers nicht einhält oder ohne Abkömmlinge vor dem (künftigen) Erblasser verstirbt. Nicht unerheblich kann sich auch eine Steuerreduzierung auswirken, wenn unter Beachtung der Zehn-Jahres-Frist (§ 14 ErbStG) übertragen wird.
Durchsetzung der Miterbenrechte in der Erbengemeinschaft
Wie der einzelne Miterbe seine Rechte in der bestehenden Erbengemeinschaft durchsetzen kann, wird in den folgenden Kapiteln näher beschrieben. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:
Mitwirkung des Miterben bei Verwaltungshandlungen
Nach § 2038 BGB ist jeder Miterbe verpflichtet, an ordnungsgemäßen Verwaltungsmaßnahmen mitzuwirken. Als streitig kann sich erweisen, ob eine ordnungsgemäße oder nicht ordnungsgemäße Maßnahme vorliegt, §§ 2038 Abs. 2, 745 BGB.
Veräußerung des Anteils eines Miterben
Jeder Miterbe kann seinen Anteil an der Erbengemeinschaft verkaufen (§§ 433, 2371, 1922 Abs. 2 BGB) und übertragen (§§ 2033 Abs. 1, 398, 413 BGB).
Ausübung des Vorkaufsrechts
Verkauft ein Miterbe seinen Erbanteil an einen Gemeinschaftsfremden, haben die übrigen Miterben (gemeinschaftlich) ein Vorkaufsrecht nach den § 2034 ff. BGB. Dabei ist zu beachten, dass dies auch ein Miterbe allein ausüben kann, wenn die übrigen die Ausübung unterlassen, § 472 Satz 2 BGB.
Aufgebot, Inventar, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenz
Jeder Miterbe kann die Nachlassgläubiger öffentlich auffordern, ihre Forderungen anzumelden (Aufgebot), §§ 2061, 1970 BGB. Auch kann jeder Miterbe ein Inventar errichten, §§ 2063, 1993 BGB. Der Antrag auf Nachlassinsolvenz kann nach § 317 InsO ebenfalls von einem Miterben gestellt werden. Der Antrag auf Nachlassverwaltung allerdings nur von allen Miterben gemeinschaftlich, § 2062 BGB.
Auseinandersetzungsvereinbarung
Durch Vereinbarung (aller) Miterben kann die Gemeinschaft vollständig (sog. Totalauseinandersetzung) oder teilweise (sog. Teilerbauseinandersetzung) beendet werden, die Vereinbarung einzelner kann im Wege der Erbanteilsübertragung oder Abschichtung die Zahl der Miterben verringern.
Vermittlung der Auseinandersetzung durch Nachlassgericht
Jeder Miterbe kann gemäß der § 363 ff. FamGG die Vermittlung der Erbauseinandersetzung durch das Nachlassgericht beantragen.
Erbauseinandersetzungsprozess
Jeder Miterbe kann auf Zustimmung der anderen Miterben zu einem konsensfähigen Teilungsplan klagen. Das gerichtliche Urteil ersetzt die Zustimmung der anderen Miterben, § 894 ZPO. Für eine erfolgreiche Klage ist ein genauer Teilungsplan erforderlich, alle Nachlassverbindlichkeiten, Anrechnungs- und Ausgleichposten müssen erfasst, die einzelnen Gegenstände bewertet sein.
BGH NJW 2001, 1056
2Erberl/Borges ZEV 2002, 126
3BGH NJW 2002, 3389
4BGH NJW 2006, 3715
5BGH NJW 2001, 1056
6BGH NJW 2005, 2061
7Brox, Erbrecht § 28 Rn 470
8Brox, Erbrecht § 28 Rn 471
9Vom 30.03.2009, Az. II R 12/07
10Siehe auch BGH FamRZ 1991, 689
11BGH NJW 1991, 1345
2. Anteil der Miterben am Nachlass
Verfügung über den Miterbenanteil
Der Erbschaftskauf
Verfügung über den Miterbenanteil
Jeder Miterbe hat einen (quotenmäßigen) Anteil am Gesamtvermögen, das heißt an der Erbengemeinschaft. Dieser Anteil wird nach § 1922 Abs. 2 BGB wie eine Erbschaft behandelt.
Beim Tod eines Miterben geht sein Anteil auf seinen Erben über. Dieser tritt allerdings wieder in die bestehende Erbengemeinschaft ein. Mehrere Erben eines Miterben bilden eine Erbengemeinschaft innerhalb der bestehenden Erbengemeinschaft.
Der einzelne Miterbe kann gemäß § 2033 Abs. 1 BGB über seinen Erbteil (Anteil an der Erbengemeinschaft) verfügen und ihn durch Rechtsgeschäft auf einen anderen übertragen. Der Erwerber wird Mitglied der Erbengemeinschaft.
Die nach E eingetretene Erbengemeinschaft besteht aus den drei Söhnen A, B und C (je 1/3). B ist mit seinen Brüdern völlig zerstritten und möchte gegen Entgelt aus der Gemeinschaft ausscheiden. Eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft und Zuweisung der Gegenstände, Kontenforderungen und des Grundstücks erscheint derzeit aussichtslos. Der Nachlass beträgt nach Berichtigung vorhandener Verbindlichkeiten ca. 900.000 EUR. Der mit B befreundete K bietet ihm für die Übertragung des Erbanteils 275.000 EUR.
Gegenstand der Verfügung ist der gesamte Miterbenanteil, die ideelle Quotenberechtigung am Gesamthandsvermögen (am Sondervermögen) der Gemeinschaft, welches vom Erbfall bis zur Auseinandersetzung vorhanden ist. Dadurch kann der einzelne Miterbe vor der Auseinandersetzung des Nachlasses sein Erbrecht bereits wirtschaftlich nutzen.
Soweit Eltern im Namen minderjähriger Kinder über den Miterbenanteil verfügen, benötigen sie eine familiengerichtliche Genehmigung nach §§ 1643 Abs. 1, 1822 Nr. 1 (letzte Alt.) BGB. Verfügungen durch einen Vormund, Pfleger oder Betreuer unterliegen der gerichtlichen Genehmigung nach § 1822 Nr. 1 BGB (§§ 1915 Abs. 1, 1908i Abs. 1 BGB).
Gegenstand der Verfügung
Der Miterbenanteil ist die Summe der Rechte, die dem einzelnen Miterben im Hinblick auf den Nachlass vor der Auseinandersetzung aufgrund seiner Stellung zustehen. Gegenstand der Verfügung nach § 2033 Abs. 1 Satz 1 BGB ist demnach die vermögensrechtliche Stellung des Miterben in der Erbengemeinschaft zum Zeitpunkt der Verfügung.
Verfügt werden kann gemäß § 2033 Abs. 2 BGB nur über den Anteil als solchen, nicht über einzelne Gegenstände, die zum Nachlass gehören.
Der Erwerber tritt durch Rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Veräußerung an die Stelle des verfügenden Miterben in dessen vermögensrechtliche Stellung am Nachlass, somit in die Gesamthandsgemeinschaft ein. Seine gesamthänderische Berechtigung an den einzelnen Nachlassgegenständen wächst ihm durch Gesamtrechtsnachfolge zu.12 Überträgt ein Miterbe seinen Erbteil an die übrigen Mitglieder der Erbengemeinschaft, wächst nach den §§ 1935, 2094 BGB der übertragene Erbteil in der Regel den in Gesamthandsgemeinschaft stehenden Erwerbern ebenfalls zur gesamten Hand ihren Erbteilen entsprechend an. Bei Übertragung eines Erbteils an einzelne Mitglieder der Erbengemeinschaft wächst (nur) diesen der Anteil an, ebenso bei Übertragung nur eines Teils eines Miterbenanteils auf einen oder mehrere Miterben.
Arten und Wirkung der Verfügung
Übertragung des Miterbenanteils
Durch die Übertragung des Anteils wird der Erwerber nicht Erbe, da die Erbenstellung des Verfügenden nicht durch Rechtsgeschäft auf einen anderen übertragen werden kann. Sie wird nur durch gewillkürte oder gesetzliche Erbfolge begründet. Der Verfügende bleibt auch nach der Übertragung Erbe, da die Erbenposition mit der Person des Erben untrennbar verknüpft ist. Er wird bei der Berechnung der Pflichtteile mitgezählt, im Erbschein genannt (nicht der Erwerber) und kann noch für erbunwürdig erklärt werden (mit Wirkung gegen den Erwerber).13
Wird ein Erbschein erteilt, so ist darin auch nach der Übertragung allein der Verfügende als Miterbe zu bezeichnen. Der Erwerber kann zwar die Erteilung des Erbscheins beantragen, aber nur auf den Namen des Veräußerers.14 Erbrechtliche Gestaltungserklärungen bleiben regelmäßig dem Miterben vorbehalten. So kann beispielsweise die Erbunwürdigkeit auch nach Übertragung vom Veräußerer gegenüber einem anderen Miterben oder gegen den Veräußerer geltend gemacht werden.
Der Erwerber tritt in die vermögensrechtliche Stellung des verfügenden Miterben am Nachlass ein. Er kann die Auseinandersetzung der Gemeinschaft betreiben und über den erworbenen Anteil weiterverfügen. Zudem haftet er für Nachlassverbindlichkeiten, außerdem gehen Vermächtnisse und Auflagen auf ihn über, ebenso alle Rechte, Pflichten und Belastungen.
Nießbrauch und Pfandrecht
Die wirtschaftliche Verwertung des Anteils durch den Miterben vor der Auseinandersetzung kann auch darin bestehen, dass er einem Dritten einen Nießbrauch oder ein Pfandrecht bestellt.
Gegenstand der Bestellung beider Rechte ist nicht die Summe der einzelnen Nachlassgegenstände, sondern das durch die Erbenstellung begründete Mitgliedschaftsrecht in der Erbengemeinschaft. Es gilt daher nur die Formvorschrift des § 2033 Abs. 1 Satz 2 BGB, nicht auch § 1069 BGB oder § 1274 Abs. 1 Satz 1 BGB. Die einzelnen Nachlassgegenstände werden von der Bestellung eines Pfandrechts am Anteil nicht berührt. So wird beispielsweise ein Grundstück selbst dann nicht belastet, wenn es den einzigen Nachlassgegenstand bildet. Mit der Nießbrauchsbestellung oder Verpfändung wird lediglich die Verfügungsbefugnis des Miterben über seinen Anteil eingeschränkt. Er kann nur noch mit Zustimmung des Nießbrauchers oder Pfandgläubigers über seinen Anteil verfügen, § 1071 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB, 1276 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB.15 Diese Verfügungsbeschränkung kann nach Voreintragung des Miterben als Mitglied der ungeteilten Erbengemeinschaft (§§ 39, 40 GBO) in das Grundbuch eingetragen werden.16
Wichtig kann die Eintragung im Grundbuch vor allem dann sein, wenn alle Miterben gemeinsam über ein Nachlassgrundstück verfügen; in diesem Fall könnte ohne Eintragung § 892 Abs. 1 Satz 2 BGB Anwendung finden.
Form der Verfügung
Die Verfügung über den Miterbenanteil muss gemäß § 2033 Abs. 1 Satz 2 BGB notariell beurkundet werden, unabhängig davon, ob es sich um eine Übertragung, Nießbrauchbestellung oder Verpfändung handelt. Für die Übertragung des Anteils ist § 2033 Abs. 1 Satz 2 BGB die einzige maßgebende Formvorschrift. Der Erwerber wird Gesamthänder hinsichtlich des gesamten Nachlasses, somit auch aller einzelnen Nachlassgegenstände. Auch soweit die Übertragung dieser einzelnen Gegenstände sonst an spezielle Voraussetzungen und Formen gebunden ist (z. B. für Grundstücke §§ 873, 925 BGB), gilt nur § 2033 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Pfändung des Erbanteils
Ein Gläubiger (Nachlass- oder Eigengläubiger) hat nach § 859 Abs. 2 ZPO das Recht zur Pfändung des Anteils. Eigengläubiger (des Miterben) können schon vor Annahme der Erbschaft pfänden; für Nachlassgläubiger (§ 2059 BGB) gilt aber die Sperre der §§ 1958 BGB, 778 Abs. 1 ZPO (keine gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen vor Annahme).
Eine Pfändung des Anteils erfolgt nach §§ 857, 829 ZPO, auch wenn Grundstücke zum Nachlass gehören.17 Der Beschluss muss den Anteil bezeichnen. Drittschuldner sind die übrigen Miterben, die namentlich bezeichnet sein müssen. Ist ein Testamentsvollstrecker oder ein Nachlassverwalter bestellt, ist nur er Drittschuldner. Bei Nachlasspflegschaft sollte dem Pfleger und den Miterben der Vollstreckungstitel zugestellt werden. Bei mehreren Drittschuldnern entscheidet nach § 829 Abs. 3 ZPO die letzte Zustellung.
Der Gläubiger kann aufgrund der Pfändung (§ 804 Abs. 2 ZPO, §§ 1273 Abs. 2, 1258 BGB) außer den höchstpersönlichen alle Rechte des Schuldners ausüben, wie etwa:
Verwaltungs- und Verfügungsrechte (§ 2038 ff. BGB)
Rechte auf Auskunft und Rechnungslegung (§ 2027 ff. BGB)
Mitwirkung bei der Auseinandersetzung (§ 2042 ff. BGB)
Ohne Zustimmung des Gläubigers können die Miterben weder den Nachlass auseinandersetzen (§ 2042 BGB), noch gemeinschaftlich über einzelne Nachlassgegenstände verfügen (§ 2040 Abs. 1 BGB). Die Verfügungsbeschränkung kann auf Antrag des Gläubigers im Hinblick auf § 892 Abs. 1 Satz 2 BGB berichtigend (§§ 13 Abs. 1 Satz 2, 22 GBO) im Grundbuch eingetragen werden.18
Die Verwertung kann sowohl gemäß §§ 857 Abs. 1, 835 ZPO durch Überweisung zur Einziehung als auch gemäß §§ 857 Abs. 5, 844 ZPO durch Anordnung der Veräußerung erfolgen.
Der Gläubiger kann nach Überweisung anstelle des Schuldners die Auseinandersetzung des Nachlasses betreiben; bei Grundstücken hat er ein eigenes Recht, Teilungsversteigerung zu beantragen (§ 181 ZVG).19 Der Pfandgläubiger kann das notarielle Auseinandersetzungsverfahren nach § 363 ff. FamFG beantragen und auf Auseinandersetzung klagen.
BayObLG NJW-RR 1987, 398
13Palandt/Weidlich, § 2033 Rn 7
14KG OLG Rspr 44, 106
15KG HRR 1934 Nr. 265
16RGZ 90, 232; KGJ 37 A, 273
17BGH NJW 1969, 1347; OLG Frankfurt Rpfleger 1979, 205
18OLG Frankfurt Rpfleger 1979, 205
19BGH NJW-RR 1999, 504
Der Erbschaftskauf
Die § 2371 ff. BGB geben dem Erben die Möglichkeit, die Erbschaft oder einen Miterbenanteil (§ 1922 Abs. 2 BGB) insgesamt zu verkaufen. Der Erbschaftskauf ist ein schuldrechtlicher Vertrag, auf den alle für den Kaufvertrag geltenden Vorschriften (§ 433 ff. BGB) Anwendung finden, soweit nicht die §§ 2371 bis 2385 abweichende Regelungen treffen.
Die Vorschriften über den Erbschaftskauf finden nach § 2385 Abs. 1 BGB auf den Weiterverkauf einer Erbschaft oder eines Miterbenanteils und andere Verträge, die auf die Veräußerung einer Erbschaft gerichtet sind (z. B. Schenkung, Tausch), entsprechende Anwendung.
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand beim Alleinerben ist die gesamte Erbschaft und beim Miterben der Miterbenanteil (§ 1922 Abs. 2 BGB). Verkauft wird damit nur die Erbschaft als Summe der zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte (z. B. Grundstücke, Gegenstände, Forderungen) oder der Erbteil als Vermögensgegenstand.
Sofern nicht anders vereinbart, wird die Erbschaft in dem Zustand verkauft, in dem sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befindet. Der spätere Wegfall von Vermächtnissen, Auflagen und Ausgleichungspflichten kommt nach § 2372 BGB dem Käufer zugute.
Andererseits verbleibt ein Erbteil, der dem Verkäufer nach Abschluss des Vertrags durch Eintritt der Nacherbfolge oder durch Wegfall eines Miterben anfällt, im Zweifel beim Verkäufer, § 2373 BGB.
Ein dem Verkäufer zugewendetes Vorausvermächtnis sowie Familienpapiere (z. B. Briefe, Tagebücher, Urkunden) und Familienbilder werden nach § 2373 BGB – wenn nicht anders bestimmt – vom Kaufvertrag nicht umfasst.
Der Alleinerbe wird verpflichtet, die einzelnen Erbschaftsgegenstände an den Käufer zu übereignen, einschließlich der in § 2374 BGB genannten Ersatzgegenstände. Er hat nach § 2375 Abs. 1 BGB Ersatz für vor dem Verkauf verbrauchte, verschenkte oder unentgeltlich belastete Erbschaftsgegenstände zu leisten, soweit der Käufer davon keine Kenntnis hat, § 2375 Abs. 1 Satz 2 BGB. Der Miterbe ist gemäß § 2033 Abs. 1 BGB zur Übertragung seines Erbanteils verpflichtet.
Soweit Eltern im Namen minderjähriger Kinder durch den Erbschaftsverkauf eine Verpflichtung zur Verfügung über den Miterbenanteil eingehen, benötigen sie eine familiengerichtliche Genehmigung nach §§ 1643 Abs. 1, 1822 Nr. 1 (2. Alt.) BGB.
Verpflichtungsgeschäfte durch einen Vormund, Pfleger oder Betreuer unterliegen der gerichtlichen Genehmigung nach § 1822 Nr. 1 BGB, für den Pfleger durch Verweisung nach § 1915 Abs. 1 sowie für den Betreuer nach § 1908i Abs. 1 BGB.
Form
Der Erbschaftskauf bedarf der notariellen Beurkundung, § 2371 BGB. Für ähnliche Verträge, wie etwa Tausch und Schenkung, findet § 2371 BGB über § 2385 Abs. 1 BGB Anwendung. Wird die Form nicht eingehalten, ist der Vertrag gemäß § 125 Satz 1 BGB nichtig.
Die Frage, ob ein formnichtiger Erbschaftskauf durch Erfüllung geheilt werden kann, ist umstritten. Es gilt aber generell im BGB die Grundregel, dass formnichtige Rechtsgeschäfte nicht durch Erfüllung geheilt werden.20
Gefahrübergang und Mängelhaftung
Abweichungen von den allgemeinen Kaufvorschriften ergeben sich aus den Regelungen über den Gefahrübergang und die Gewährleistung nach den §§ 2376, 2380 BGB.
Der Käufer trägt nach § 2380 Satz 1 BGB ab dem Abschluss des Erbschaftskaufvertrags die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung von Erbschaftsgegenständen.
Es besteht keine Haftung für Sachmängel der zur Erbschaft gehörenden Gegenstände, § 2376 Abs. 2 BGB.
Bei Rechtsmängeln haftet der Verkäufer gemäß § 2376 Abs. 1 BGB ausschließlich dafür, dass
ihm das Erbrecht zusteht,
keine Nacherbschaft oder Testamentsvollstreckung angeordnet ist,
keine Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilslasten, Ausgleichspflichten oder Teilungsanordnungen bestehen,
keine unbeschränkte Haftung gegenüber den Nachlassgläubigern eingetreten ist.
Eine mit dem Erbfall eingetretene Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit (Konfusion) gilt im Verhältnis des Käufers zum Verkäufer als nicht erfolgt, § 2377 Satz 1 BGB. Da eine erloschene Verbindlichkeit nicht von selbst auflebt, hat der Verkäufer den Käufer so zu stellen, als wäre sie nicht erloschen, § 2377 Satz 2 BGB.
Die Nachlassverbindlichkeiten hat der Käufer im Verhältnis zum Verkäufer zu tragen, soweit dieser nicht für ihr Nichtbestehen haftet, § 2378 Abs. 1 BGB. Hat der Verkäufer eine Nachlassverbindlichkeit erfüllt, kann er vom Käufer Ersatz verlangen. Gleiches gilt auch für die Erfüllung vor Vertragsschluss, § 2378 Abs. 2 BGB.
Vor dem Kauf gemachte notwendige Verwendungen des Verkäufers auf die Erbschaft hat der Käufer nach § 2381 Abs. 1 BGB immer zu ersetzen, andere als notwendige Verwendungen jedoch nur dann, wenn eine durch sie herbeigeführte Wertsteigerung der Erbschaft beim Abschluss des Erbschaftskaufvertrags noch vorhanden ist, § 2381 Abs. 2 BGB.
Vor Abschluss des Kaufvertrags erhält der Verkäufer und nachher der Käufer die Nutzungen und hat die Lasten zu tragen, § 2379 Satz 1, 2 BGB, § 2380 Satz 2 BGB. Nur bestimmte außerordentliche Lasten, die schon vor Vertragsschluss bestanden haben, treffen den Käufer, § 2379 Satz 3 BGB.
Haftung gegenüber Nachlassgläubigern
Der Käufer der Erbschaft haftet gemäß § 2382 Abs. 1 BGB den Nachlassgläubigern21 vom Abschluss des Kaufvertrags an für Nachlassverbindlichkeiten, und zwar auch insoweit, als der Käufer sie dem Verkäufer gegenüber nach den §§ 2378, 2379 BGB nicht zu erfüllen braucht. Daneben besteht die Haftung des Verkäufers fort, § 2382 Abs. 1 BGB.
Käufer und Verkäufer können keine Haftungsbeschränkungen des Käufers mit Wirkung gegen die Nachlassgläubiger vereinbaren, § 2382 Abs. 2 BGB.
Der Käufer kann seine Haftung nach den Vorschriften über die Beschränkung der Erbenhaftung begrenzen, § 2383 Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. § 1975 ff. BGB, jedoch muss er eine bereits beim Verkäufer eingetretene unbeschränkte Haftung hinnehmen, § 2383 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Der Verkäufer ist den Nachlassgläubigern gegenüber verpflichtet, dem Nachlassgericht den Verkauf und den Namen des Erwerbers anzuzeigen, § 2384 Abs. 1 Satz 1 BGB. Die entsprechende Anzeige des Käufers ersetzt die Anzeige des Verkäufers, § 2384 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Vorkaufsrecht der Miterben
Das Eindringen eines Dritten in die Gemeinschaft der Erben (zumeist Verwandte oder Ehegatten des Erblassers) kann bei der Verwaltung und Auseinandersetzung Schwierigkeiten bereiten. Deshalb hat der Gesetzgeber den Miterben ein Vorkaufsrecht eingeräumt, § 2034 Abs. 1 BGB.
Der Schutz der Miterben gegen unliebsame Anteilserwerber wird dadurch verstärkt, dass das Vorkaufsrecht nach Eintritt des Vorkaufsfalls sowohl gegenüber dem Verkäufer (vor der Übertragung) als auch gegenüber dem Käufer (nach der Übertragung) und sogar gegenüber weiteren Erwerbern ausgeübt werden kann, §§ 2035, 2037 BGB.
Das Vorkaufsrecht bietet keine absolute Gewähr gegen den Eintritt unerwünschter Fremder in die Erbengemeinschaft. Es gilt nur für den Fall des Verkaufs, nicht bei Schenkung, Vergleich, Sicherungsübertragung, Nießbrauch, Verpfändung. Außerdem wird es nur bedeutsam, wenn die übrigen Miterben finanziell in der Lage sind, es auszuüben.
Vorkaufsfall
Das Vorkaufsrecht greift nur, wenn ein Miterbe seinen Anteil an einen Dritten, somit nicht an einen Miterben oder Erbeserben, verkauft, § 2034 Abs. 1 BGB. Es gelten die Vorschriften über das schuldrechtliche Vorkaufsrecht (§ 463 ff. BGB), soweit die §§ 2034 bis 2037 BGB keine Sonderregelung treffen. Folgende Voraussetzungen müssen für die Ausübung des Vorkaufsrechts gegeben sein:
Ein Miterbe (oder dessen Erbe22) verkauft seinen Miterbenanteil. Es liegt kein Vorkaufsfall vor, wenn ein Erwerber seinen Anteil verkauft. Er ist nicht Miterbe (§ 2034 Abs. 1 BGB), so dass § 2037 BGB nicht auf § 2034 BGB verweist. Diese Vorschrift lässt nur das beim Verkauf durch den Miterben begründete Vorkaufsrecht fortbestehen, falls der Erwerber weiterveräußert.
Der Verkauf erfolgt an einen Dritten. Dritter ist jeder, der nicht Miterbe ist. § 2034 BGB greift somit selbst dann ein, wenn ein Erbteilskäufer einen weiteren Erbanteil aufkauft, denn diese Bestimmung soll auch vor einer Überfremdung des Nachlasses schützen.23
Ob ein Verkauf als Voraussetzung des Vorkaufsrechts vorliegt, muss im Hinblick auf die in den §§ 2034 bis 2037 BGB geschützten Interessen der übrigen Miterben beurteilt werden. Vereinbarungen, die denselben wirtschaftlichen Zweck wie ein Kaufvertrag verfolgen und nur zur Umgehung des Vorkaufsrechts abweichend vom Kauf getroffen werden, begründen ein Eintrittsrecht der übrigen Miterben.24 Kein Verkauf im Sinne von § 2034 BGB ist die gemischte Schenkung, da die vom Gesetz vorausgesetzte Entgeltlichkeit der Verfügung dabei teilweise fehlt.25
Der Miterbe muss freiwillig verkaufen. Ein „Verkauf“ bei der Pfandverwertung, in der Zwangsvollstreckung oder durch den Insolvenzverwalter begründet kein Vorkaufsrecht.26 Gleichzeitig muss der Verkauf gültig sein, denn auch ein formungültiger Kaufvertrag begründet kein Vorkaufsrecht.27
Vorkaufsberechtigte
Das Vorkaufsrecht steht den übrigen Miterben gemäß § 2034 Abs. 1 BGB zu. Anteilserwerber haben kein Vorkaufsrecht.28 Auch einem Miterben, der seinen Erbanteil bereits vorher veräußert hat, steht kein Vorkaufsrecht mehr zu.29 Das Vorkaufsrecht des Miterben ist nach § 2034 Abs. 2 Satz 2 BGB vererblich.
Die Miterben können das Vorkaufsrecht gemeinschaftlich ausüben. Wenn ein Miterbe es nicht in Anspruch nimmt, sind die übrigen gemäß § 472 Satz 2 BGB dazu berechtigt. Erklärt ein Miterbe, er berufe sich auf das Vorkaufsrecht, ist das im Zweifel dahin auszulegen, dass er es allein ausübt, wenn andere Miterben nicht ebenfalls fristgemäß die Ausübung erklären. Die erforderlichen Erklärungen brauchen nicht gleichzeitig abgegeben zu werden.30
Verpflichtete des Vorkaufsrechts
Die Berechtigten können das Vorkaufsrecht vor der Übertragung des Anteils nur gegenüber dem Verkäufer, nach der Übertragung nur gegenüber dem Käufer und nach einer weiteren Übertragung durch den Käufer nur gegenüber dem Dritterwerber ausüben, §§ 2035 Abs. 1, 2037 BGB. Verpflichteter des Vorkaufsrechts ist somit der, dem der Anteil jeweils dinglich zugeordnet ist.
Die weiteren Übertragungen nach § 2037 BGB müssen nicht auf Verkäufe zurückgehen. Damit die Berechtigten wissen, wem der Anteil jeweils zusteht, verpflichtet § 2035 Abs. 2 BGB (auch § 2037 BGB) den Verfügenden, die Übertragung den Berechtigten anzuzeigen. Solange diese Anzeige nach § 2035 Abs. 2 BGB fehlt, können die Miterben ihr Recht analog § 407 Abs. 1 BGB wirksam gegenüber dem Verkäufer ausüben (mit Wirkung gegen den Erwerber).31
Ausübung des Vorkaufsrechts
Das Vorkaufsrecht kann gemäß § 2034 Abs. 2 Satz 1 BGB nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten ausgeübt werden. Die Ausübungsfrist beginnt für jeden Vorkaufsberechtigten jeweils mit dem Zugang der Mitteilung über den Abschluss des Kaufvertrags, die der Verpflichtete den Vorkaufsberechtigten unverzüglich machen muss, § 469 Abs. 1 BGB.32 Die Frist berechnet sich nach den §§ 187, 188 BGB; die Mitteilung bedarf keiner bestimmten Form, sondern sie kann sogar mündlich erfolgen. Jedoch muss es sich für den Empfänger erkennbar um eine rechtlich erhebliche Erklärung, nicht nur um eine gesprächsweise Äußerung handeln.33 Nur wenn die Erklärung (Mitteilung) den Inhalt des Kaufvertrags zutreffend und vollständig wiedergibt, beginnt die Frist nach § 2034 Abs. 2 Satz 1 BGB.34 Um über die Ausübung des Vorkaufsrechts entscheiden zu können, muss der Berechtigte die Vertragsbestimmungen kennen. Wird keine Angabe über den vereinbarten Kaufpreis gemacht, liegt keine Anzeige im Sinne von § 469 Abs. 1 BGB vor. Die Frist ist für jeden Vorkaufsberechtigten gesondert zu berechnen. Die Mitteilung des Verkäufers wird durch eine solche vonseiten des Käufers ersetzt, § 469 Abs. 1 Satz 2 BGB. Nach § 469 Abs. 1 BGB bedarf es keiner Anzeige, wenn der Vorkaufsberechtigte beim Vertragsschluss anwesend war. Die Frist beginnt in diesem Fall am Tag der Beurkundung.35
Die Ausübungsfrist läuft nur einmal von der Anzeige des Veräußerers im Sinne von § 469 Abs. 1 BGB an. Wird der Erbanteil erneut veräußert, beginnt keine neue Frist. Es entsteht auch kein neues Vorkaufsrecht, vielmehr handelt es sich auch jetzt um dasselbe Recht, das beim Erstverkauf des Miterbenanteils durch den Miterben entstanden ist. Nur insoweit liegen die Entstehungsvoraussetzungen eines Vorkaufsrechts vor. Läuft die Ausübungsfrist noch, kann das Vorkaufsrecht auch nach erneuter Veräußerung geltend gemacht werden. Von der fristauslösenden Anzeige des § 469 BGB ist die Benachrichtigungspflicht nach § 2035 Abs. 2 BGB zu unterscheiden. Letztere trifft den verkaufenden Miterben bzw. einen weiteren Veräußerer, wenn er den Anteil auf den Käufer bzw. weiteren Erwerber (dinglich) übertragen hat. Sie wirkt sich nicht auf den Lauf der Ausübungsfrist aus, sondern lediglich auf die Person des Erklärungsempfängers.
Üben die Berechtigten das Vorkaufsrecht aus, ist es verbraucht. Es erlischt außerdem durch Verstreichenlassen der zweimonatigen Ausübungsfrist nach § 2034 Abs. 2 Satz 1 BGB. Dies gilt auch dann, wenn der Anteil noch nicht auf den Käufer übertragen worden ist. Das Vorkaufsrecht kann auch durch Verzicht (§ 397 BGB) sämtlicher Miterben zum Erlöschen gebracht werden. Ein solcher ist schon vor Abschluss des Kaufvertrags bzw. vor der Anzeige nach § 469 BGB formlos möglich. Der Verzicht kann nicht durch einseitige Erklärung erfolgen, notwendig ist vielmehr ein Vertrag gemäß § 311 Abs. 1 BGB. Ist das Recht einmal durch Verzicht erloschen, entsteht es bei Weiterveräußerung nicht wieder.36
Wirkung der Ausübung
Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts entsteht ein Schuldverhältnis zwischen den vorkaufsberechtigten Miterben und dem Verpflichteten (Verkäufer, Käufer oder weiterer Erwerber). Es wird kraft Gesetzes begründet und richtet sich gemäß § 464 Abs. 2 BGB nach den Vorschriften über den Kauf.37
Die Berechtigten können die Übertragung des Anteils gemäß § 2033 Abs. 1 Satz 2 BGB auf sich verlangen. Durch die Übertragung erwerben die vorkaufsausübenden Miterben den Anteil als Gesamthänder im Verhältnis ihrer Erbteile wie in den Fällen der §§ 1935, 2094 BGB nach Anwachsungs- bzw. Erhöhungsregeln. Die Erbengemeinschaft wird unter den restlichen Miterben fortgeführt. Die Vorkaufsberechtigten werden erst mit der Übertragung, nicht bereits mit Geltendmachung des Vorkaufsrechts Inhaber des Anteils. Gehört ein Grundstück zum Nachlass, ist eine Sicherung des Anspruchs auf Übertragung des Erbanteils durch Vormerkung nicht möglich, jedoch kann ein Veräußerungsverbot erwirkt werden.38 Der Anteil, der den Miterben schon vor dem Vorkauf zustand, ist im Hinblick auf Auflagen, Vermächtnisse und Ausgleichspflichten gesondert zu behandeln (ähnlich § 1935 BGB).39
Der Verkäufer hat einen Anspruch gegen die Berechtigten auf den im ursprünglichen Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis, § 464 Abs. 2 i. V. m. § 433 Abs. 2 BGB. Die Berechtigten haften nach außen als Gesamtschuldner entsprechend § 427 BGB, im Innenverhältnis jedoch gemäß der Größe ihrer Anteile.
Wird das Vorkaufsrecht gegenüber dem Käufer oder dem Dritterwerber ausgeübt, sind die Miterben verpflichtet, diesem den entrichteten Kaufpreis als Gesamtschuldner Zug um Zug gegen Übertragung des Erbanteils zu erstatten.40
Die nach E eingetretene Erbengemeinschaft besteht aus den drei Söhnen A, B und C (je 1/3). B ist mit seinen Brüdern völlig zerstritten und hat seinen Erbanteil an K für 275.000 Euro verkauft und übertragen. Der Kaufvertrag wurde in notariell beurkundeter Form am 27.11.2015 geschlossen und der Anteil wurde ebenfalls in dieser Urkunde auf K durch Abtretung übertragen. Der Verkauf wurde am 30.11.2015 durch Übersendung des notariellen Vertrags an den Miterben A, sowie am 01.12.2015 an C durch B mitgeteilt. A hat durch öffentlich beglaubigte Erklärung vom 11.12.2015 auf das ihm zustehende Vorkaufsrecht gegenüber B verzichtet. C möchte sein Vorkaufsrecht ausüben.
Erbe nach dem am 06.06.2015 verstorbenen E bin neben meinen beiden Brüdern A und B ich zu 1/3. B hat mit durch Notar N beurkundeten Vertrag vom 27.11.2015 seinen Miterbenanteil am Nachlass an Sie zu einem Preis von 275.000 Euro verkauft und gleichzeitig übertragen. Vom Inhalt des Vertrags habe ich Kenntnis erlangt am 01.12.2015. Durch die bereits erfolgte Übertragung des Erbanteils ist die Ausübung des Vorkaufsrechts gegenüber des Verkäufers B erloschen, § 2035 Abs. 1 Satz 2 BGB; Verpflichteter sind nunmehr Sie als Erwerber, §§ 2035 Abs. 1 Satz 1, 2034 BGB.
Der Miterbe A hat durch Erklärung vom 11.12.2015 auf sein Vorkaufsrecht verzichtet. Ich übe das Vorkaufsrecht allein und vollumfänglich aus und trete in den o. g. Kaufvertrag ein.
Sie werden aufgefordert, den erworbenen Miterbenanteil Zug um Zug gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises an mich zu übertragen. Zur Absprache eines Termins zur notariellen Beurkundung bitte ich um Rücksprache bis spätestens . . .
BGH WM 1960, 551; 1970, 1319; BGH NJW 1967, 1128; RGZ 129, 122; 137, 171; RG HRR 1934 Nr. 1035; OLG Frankfurt OLGE 16, 280; OLG Hamburg OLGE 14, 285; OLG München JFG 14, 61; OLG Oldenburg HRR 1936, Nr. 877; OLG Hamm RdL 1951, 103; OLG Schleswig SchlHA 1954, 54; MüKo/Musielak, § 2371 Rn 6
21Brox, Erbrecht, § 44 Rn 797 ff.
22BGH NJW 1966, 2207; FamRZ 2011, 471
23BGHZ 56, 115
24BGHZ 23, 301; 25, 174
25RGZ 101, 99
26BGH NJW 1977, 37
27BGH DNotZ 1960, 551; BGHZ 14, 1
28BGHZ 56, 115, 118
29BGH FamRZ 1993, 420
30RGZ 158, 57
31Palandt/Weidlich, § 2035 Rn 1
32BGH WM 1979, 1066; BGH NJW 2002, 820
33RG HRR 1930 Nr. 297
34RG Recht 1924 Nr. 1522; OLG Köln RdL 1958, 327
35OLG Köln RdL 1958, 327
36BayObLGZ 1980, 328, 330; RGZ 170, 203, 207
37BGHZ 6, 85
38OLG Stuttgart BWNotZ 1976, 150
39Damrau, ZEV 1996, 361
40BGHZ 6, 85
3. Verwaltung des Nachlasses in der Gemeinschaft
Grundsätze der Verwaltung
Bereiche der Verwaltung im Innenverhältnis
Vertretungsmacht im Außenverhältnis
Geltendmachung von Nachlassansprüchen
Grundsätze der Verwaltung
Für die Erbengemeinschaft hat das Gesetz keine klare Unterscheidung zwischen Geschäftsführung (Innenverhältnis) und Vertretung (Außenverhältnis) getroffen.
Geregelt sind lediglich:
Verwaltung (§ 2038 BGB i. V. m. §§ 743, 745, 746, 748 BGB)
Verfügungsrecht, § 2040 BGB
Befugnis zur Geltendmachung von Nachlassgegenständen, § 2039 BGB
Den Begriff „Verwaltung des Nachlasses“ hat der BGH 41 folgendermaßen definiert: „Alle tatsächlichen und rechtlichen Maßnahmen, welche der Sicherung, Erhaltung, Vermehrung, Nutzgewinnung, Verwertung von Nachlassgegenständen und Schuldenbegleichung dienen.“
Somit kann Verwaltung Geschäftsführung und Vertretung sein.
Nach dem Erblasser E ergibt sich eine Erbengemeinschaft, bestehend aus der Witwe W sowie den Kindern A und B. Die Erbquoten betragen für W 1/2, für A und B je 1/4.
Keiner der Miterben wohnt in dem zum Nachlass gehörenden Hausgrundstück. Da eine Dachreparatur erforderlich ist, möchten W und A eine Dachdeckerfirma beauftragen, ein für die Kostenbegleichung erforderliches Darlehen mit der X-Bank vereinbaren und durch eine Grundschuld an dem Grundstück absichern. B wirkt bei alledem nicht mit.
Regelungsbedarf:
Abschluss eines Werkvertrags mit der Dachdeckerfirma
b)Abschluss des Darlehensvertrags mit der Bank
c)Grundschuldbestellung zugunsten der Bank
FamRZ 1965, 267
Bereiche der Verwaltung im Innenverhältnis
Für das Innenverhältnis sind drei Bereiche der Verwaltung zu unterscheiden:
Maßregeln, die nur gemeinschaftlich getroffen werden dürfen
Maßregeln, die von der Mehrheit getroffen werden können
Maßregeln, die jeder Miterbe allein treffen darf
§ 2038 Abs. 1 Satz 1 BGB stellt für das Verhältnis unter den Miterben den Grundsatz der gemeinschaftlichen Verwaltung auf. Dieser ist jedoch in mehrfacher Hinsicht durchbrochen.
Verwaltungsmaßnahmen in der GemeinschaftNicht ordnungsgemäße VerwaltungOrdnungsgemäßeVerwaltungNotverwaltung§ 2038 Abs. 1 Satz 1 BGB
(§ 2038 Abs. 2 i. V. m. § 745 Abs. 2 und 3 BGB)
Einstimmigkeit
Mitwirkung aller Miterben
§ 2038 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz BGB
(§ 2038 Abs. 2 Satz 1, § 745 Abs. 1 Satz 1 BGB)
Mehrheitsentscheidung
Stimmrecht nach Erbquoten (§ 745 Abs. 1 Satz 2 BGB)
§ 2038 Abs. 1Satz 2 2. Halbsatz BGB
jeder Miterbe allein
gemeinschaftliche Verwaltung durch alle MiterbenMehrheitsverwaltungEinzelverwaltungGemeinschaftliche Verwaltung
Der Grundsatz der Gemeinschaftlichkeit gilt nur für die nicht ordnungsgemäße Verwaltung, § 2038 Abs. 1 Satz 1 BGB. Was ordnungsgemäße Verwaltung ist, richtet sich nach § 745 BGB. Sie muss der Beschaffenheit des Gegenstands und dem Interesse aller Miterben nach billigem Ermessen entsprechen. Wesentliche Veränderungen des Nachlasses gehören nicht zur ordnungsgemäßen Verwaltung, § 745 Abs. 3 Satz 1 BGB. Die Abgrenzung ist wichtig, weil davon die Willensbildung (Einstimmigkeitserfordernis oder Mehrheitsentscheid) abhängt.
§ 745 BGB geht von einem gemeinschaftlichen Gegenstand aus. Dem entspricht bei der Erbengemeinschaft der gesamte Nachlass, nicht der einzelne Nachlassgegenstand. Einzelne Nachlassgegenstände können somit im Rahmen ordnungsgemäßer Verwaltung durchaus umgestaltet, verarbeitet und veräußert werden, wenn nur der Nachlass als Ganzes nicht wesentlich verändert wird.
Eine „wesentliche Veränderung“ gemäß §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 745 Abs. 3 Satz 1 BGB setzt voraus, dass die Zweckbestimmung oder Gestalt des Nachlasses als Ganzes in einschneidender Weise geändert würde. Dafür spielt nur eine untergeordnete Rolle, ob die Zusammensetzung des Nachlasses umgestaltet werden soll. Bedeutsam ist vielmehr, ob der Substanzwert gemindert würde, weil der Gesetzeszweck dahin geht, wirtschaftliche Einbußen bis zur Teilung des Nachlasses zu vermeiden.42
Der Wiederaufbau eines zerstörten Hauses ist in der Regel keine Maßregel der ordnungsgemäßen Verwaltung43 (zumindest wenn das Haus einen wesentlichen Teil des Nachlasses darstellt) und erfordert Einstimmigkeit.
Mehrheitsverwaltung
Durch die Verweisung des § 2038 Abs. 2 Satz 1 BGB auf § 745 BGB kann eine der Beschaffenheit des Nachlasses entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung durch Stimmenmehrheit beschlossen werden. Das Stimmrecht der Miterben richtet sich nach der Größe ihrer Anteile (Erbquoten), § 745 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Eine briefliche oder telefonische Stimmabgabe ist grundsätzlich zulässig.44 Die Stimmabgabe ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung.45
Aus § 745 Abs. 1 und 2 BGB ergibt sich, dass die Verwaltung der Beschaffenheit des Nachlasses (nicht einzelner Gegenstände) und dem Interesse aller Miterben nach billigem Ermessen entsprechen muss.
Jeder Miterbe ist den anderen gegenüber verpflichtet, zu den erforderlichen Maßregeln an der ordnungsgemäßen Verwaltung mitzuwirken, § 2038 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Mitwirkungspflicht gilt sowohl für die Willensbildung als auch für die Ausführung der beschlossenen Maßnahmen. Die Mitwirkung kann klageweise erzwungen werden. Soweit nur die Zustimmung zu einer Maßregel verlangt wird, gilt sie nach § 894 ZPO mit dem rechtskräftigen Urteil als erteilt. Andernfalls richtet sich die Vollstreckung danach, ob es sich bei der verlangten Mitwirkung um vertretbare (Ersatzvornahme, § 887 ZPO) oder unvertretbare Handlungen (Zwangsgeld oder Zwangshaft, § 888 ZPO) handelt.
Notverwaltung
Nach § 2038 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz BGB kann jeder Miterbe die zur Erhaltung des Nachlasses notwendigen Maßregeln allein treffen. Die Notwendigkeit einer Erhaltungsmaßnahme gibt dem Einzelnen ein Alleinentscheidungsrecht. Die Notverwaltungsbefugnis ist daher grundsätzlich eng auszulegen und nur für notwendige, nicht aber für nützliche Maßnahmen zu bejahen.
Das Alleinhandeln ist regelmäßig nur dann zulässig, wenn der Handelnde die Zustimmung seiner Miterben vorher nicht mehr einholen kann. Zur Notwendigkeit muss somit die Dringlichkeit der Maßnahme kommen.46 Als Notverwaltung kommen nur solche Maßnahmen in Betracht, die zugleich zur ordnungsgemäßen Verwaltung gehören.
Verweigern die übrigen Miterben die Zustimmung zu einer notwendigen, jedoch nicht dringlichen Erhaltungsmaßnahme, scheidet eine Notverwaltung aus. Dabei handelt es sich dann um eine Frage der ordnungsgemäßen Verwaltung nach § 2038 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz, Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 745 BGB. Die regelmäßige Mehrheitsverwaltung hat den Vorrang vor der Notverwaltung des Einzelnen.47 Das Notverwaltungsrecht besteht nur, wenn die sonstige Verwaltungsregelung zum Schaden des Nachlasses versagen würde. Es darf nicht dazu dienen, die ordnungsgemäße Verwaltung der Mehrheit zu durchkreuzen.
Die Vorschrift berechtigt den Handelnden, im Innenverhältnis alle Maßregeln der Notverwaltung zu treffen. Dazu können rein tatsächliche Handlungen, Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte (entgegen § 2040 BGB) gehören.48
Beim Abschluss des Werkvertrags zur Dachreparatur, dem Darlehensvertrag und der Grundschuldbestellung handelt es sich um Maßnahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung, deren Vornahme die Miterben W und A mit ihrer Quotenmehrheit (3/4) vereinbaren können.
Auskunftspflicht
Zweifelhaft ist, ob aus der gesamthänderischen Miterbengemeinschaft als gesetzlichem Schuldverhältnis eine Auskunftspflicht der Miterben untereinander folgt. Unbestritten ist eine solche Auskunftspflicht, soweit sie sich aus konkreten Einzelvorschriften ableiten lässt, insbesondere wenn ein Miterbe die Verwaltung allein führt, §§ 666, 681 BGB, ferner eventuell noch aus § 2027 Abs. 2 (Erbschaftsbesitz) und § 2028 BGB (Auskunftspflicht des Hausgenossen).
Eine darüber hinausgehende allgemeine Auskunftspflicht allein aufgrund der Gemeinschaft wird von der überwiegenden Rechtsprechung verneint.49
Die Erbengemeinschaft mit ihrer Verwaltung untersteht aber wie jedes gesetzliche Schuldverhältnis dem Prinzip von Treu und Glauben,50 so dass entgegen der überwiegenden Praxis eine allgemeine Auskunftspflicht unter bestimmten Umständen zu bejahen sein könnte.51
Es besteht ferner eine Pflicht zur Mitwirkung bei der Errichtung eines Nachlassverzeichnisses, da die Verwaltung des Sondervermögens mit der gesicherten Bestandsermittlung beginnt.52 Diese Verpflichtung ist § 2038 Abs. 1 Satz 2 BGB zu entnehmen, da die Inventarerrichtung zur Nachlassverwaltung gehört.53
Zur Informationsgewinnung bieten sich unter anderem an:
Unterlagen des Erblassers
evtl. Betreuungsakten, falls eine Betreuung bestanden hat
Banken, Finanzbehörden
Grundbuch und Handelsregister
Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO)
Aufgebotsverfahren (§ 1970 BGB, §§ 454 ff., 433 ff. FamFG)
Privataufgebot (§ 2061 BGB)
Auskunftsverlangen nach §§ 2027, 2028 BGB
Auskunftsanspruch gegen Miterben, die die Nachlassverwaltung übernommen haben (§ 666 BGB bzw. § 681 BGB)
Aufwendungsersatz
Soweit einzelne Miterben bei Maßregeln der ordnungsgemäßen Verwaltung tätig werden, wozu sie durch Mehrheitsbeschluss beauftragt sind, haben sie als Beauftragte aus § 670 BGB einen Ersatzanspruch aufgrund ihrer Aufwendungen gegen die Miterben. Dabei ist jedoch der Anteil abzuziehen, den der Handelnde selbst zu tragen hat, §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 748 BGB.
Fehlt ein Mehrheitsbeschluss, kann der Miterbe nach der Aufwendung einen Ersatzanspruch aus Auftrag geltend machen, wenn er die Zustimmung der Mehrheit zu seiner Maßnahme erhält. Kommt kein Mehrheitsbeschluss zustande, kann er nur wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag den Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, § 683 ff. BGB.
Hat ein Miterbe eine Maßnahme der Notverwaltung getroffen, kann er wie ein Beauftragter seinen Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen abzüglich des von ihm zu tragenden Anteils an der Last geltend machen, §§ 2038 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz, Abs. 2 Satz 1, 748 BGB.
Gebrauch
Die Erbengemeinschaft besteht aus der Witwe W (1/2) und den beiden Kindern A und B (je 1/4). W wohnt in dem zum Nachlass gehörenden Hausgrundstück. A und B möchten erreichen, dass W eine angemessene Nutzungsentschädigung erbringt.
Ist W verpflichtet, eine solche zu erbringen?
b)Wie können A und B ihr Verlangen gegen W durchsetzen?
Nach den §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 743 Abs. 2 BGB ist jeder Miterbe zum Gebrauch der Nachlassgegenstände insoweit befugt, als der Mitgebrauch der anderen nicht beeinträchtigt wird. Die Regelung besagt nur, dass allen Miterben ein Anspruch auf Mitgebrauch der Nachlassgegenstände zusteht. Der konkrete Gebrauch verlangt aber regelmäßig eine Vereinbarung der Miterben. Sie ist als Teil der ordnungsgemäßen Verwaltung anzusehen und kann notfalls durch Mehrheitsbeschluss erfolgen. Die unentgeltliche Nutzung einer Wohnung im gemeinschaftlichen Mietshaus durch einen Miterben löst unter Umständen Schadensersatzansprüche aus, wenn sie gegen den Willen der Miterben erfolgt.54
Einschränkend sieht dies der BGH, wenn er feststellt, dass das in § 743 Abs. 1 BGB normierte Recht jedes Teilhabers auf einen seinem Anteil an der Gemeinschaft entsprechenden Bruchteil der Nutzungen gemäß § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB nicht ohne seine Zustimmung durch bloße Mehrheitsentscheidung beeinträchtigt werden kann.55
Man kann anhand des Gesetzeszwecks zu dem Ergebnis kommen, dass die Zahlung einer Nutzungsentschädigung vom nutzenden Miterben zwar unmittelbar und auch sofort verlangt werden kann. Der Anspruch steht allerdings nicht jedem Miterben entsprechend seinem jeweiligen Anteil, sondern nur der Erbengemeinschaft in voller Höhe zu.56 Der Anspruch auf Zahlung an die Erbengemeinschaft kann allerdings gemäß § 2039 BGB von jedem Miterben einzeln geltend gemacht werden.57
Zum o. g. Beispiel:
Nach §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 743 Abs. 2 BGB ist jeder Miterbe zum Gebrauch der Nachlassgegenstände insoweit befugt, als der Mitgebrauch der anderen nicht beeinträchtigt wird. Die Regelung besagt nur, dass allen Miterben ein Anspruch auf Mitgebrauch der Nachlassgegenstände zusteht. Der konkrete Gebrauch verlangt aber regelmäßig eine Vereinbarung der Miterben; sie ist als Teil der ordnungsgemäßen Verwaltung anzusehen und kann notfalls durch Mehrheitsbeschluss erfolgen, § 745 Abs. 2 BGB.
b)Man kann in drei Stufen vorgehen (Horn, ZFE 2007, 249):
1. Stufe: Jedem Miterben steht das Recht zum Gebrauch gemäß §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 743 Abs. 2 BGB zu, soweit der Mitgebrauch der übrigen Miterben nicht beeinträchtigt wird. Ein Nutzungsersatzanspruch steht den nichtnutzenden Miterben erst dann zu, wenn der nutzende Miterbe sich weigert, den Nachlassgegenstand zum Mitgebrauch den übrigen Miterben zur Verfügung zu stellen.
2. Stufe: Durch einen Beschluss oder eine Vereinbarung durch die Miterben kann eine Regelung der ordnungsgemäßen Verwaltung und Benutzung des Nachlassgegenstands gemäß §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 745 Abs. 1, Abs. 3 BGB herbeigeführt werden.
3. Stufe: Wenn eine solche Regelung nicht zustande kommt, kann jeder Miterbe eine Regelung verlangen, die den Interessen aller Miterben nach billigem Ermessen entspricht (§§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 745 Abs. 2 BGB). Nach der außergerichtlichen Geltendmachung kann der Miterbe gegen die übrigen Miterben entweder durch Klage auf Zustimmung zu dieser Regelung oder durch Erhebung einer Zahlungsklage vorgehen.
Früchte
Jeder Miterbe hat Anspruch auf einen seinem Erbteil entsprechenden Anteil der Früchte, § 2038 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 743 Abs. 1 BGB. Die Teilung der Früchte ist jedoch bis zur Auseinandersetzung aufgeschoben, § 2038 Abs. 2 Satz 2 BGB. Ist diese länger als ein Jahr (gemäß §§ 2043 bis 2045 BGB) ausgeschlossen (und nur in diesen Fällen), so kann jeder Miterbe jeweils am Jahresschluss die Teilung des Reinertrags verlangen, §§ 2038 Abs. 2 Satz 3 BGB.58 Eine bloße Verzögerung der Auseinandersetzung genügt nicht. Eine frühere Teilung kann durch alle Miterben einstimmig beschlossen werden.
Lasten
Für die Verteilung der Lasten des Nachlasses unter den Miterben verweist § 2038 Abs. 2 Satz 1 BGB auf § 748 BGB. Die Lasten sind somit nach dem Verhältnis der Erbanteile aufzuteilen.
BGH NJW 2006, 439, 441; OLG Koblenz FamRZ 2011, 402
43BGH LM Nr. 4 zu § 2038 BGB (kriegszerstörtes Haus)
44Brox, Erbrecht, § 29 Rn 493
45OLG Hamm BB 1969, 514
46BGHZ 6, 76
47BGHZ 6, 76
48Jetzt herrschende Meinung, siehe auch Soergel/Wolf, § 2038 Rn 5
49BGH FamRZ 1973; BGH NJW-RR 1989, 450; RGZ 81, 30; KG DR 1940, 1775; OLG Braunschweig OLGE 39, 13, 14; OLG Zweibrücken OLGZ 1973, 217; OLG München FamRZ 2009, 1010; a. A. OLG Braunschweig OLGE 30, 176; OLG Karlsruhe FamRZ 1973, 215
50RGZ 65, 5, 10
51BGH NJW 1986, 1755; MüKo/Gergen, § 2038 Rn 48
52OLG Karlsruhe MDR 1972, 424; OLG Bamberg Recht 1911 Nr. 2583
53OLG Karlsruhe MDR 1972, 424
54Palandt/Sprau, § 743 Rn 4
55BGH NJW-RR 2008, 984
56LG Düsseldorf ZErb 2006, 34; Damrau, ZErb 2009, 326
57Sachs, ZEV 2011, 512
58Palandt/Weidlich, § 2038 Rn 15
Vertretungsmacht im Außenverhältnis
Das rechtswirksame Handeln der Miterben für den Nachlass setzt eine gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht der Handelnden voraus.
Verpflichtungsgeschäfte
Für Verpflichtungsgeschäfte ist die Vertretung der Erbengemeinschaft nicht besonders geregelt. Es gelten daher, entsprechend den drei Möglichkeiten der Geschäftsführung, drei verschiedene Vertretungsmöglichkeiten:
Nicht ordnungsgemäße Verwaltung
Grundsätzlich sieht das Gesetz laut § 2038 Abs. 1 Satz 1 BGB eine Verpflichtung des Nachlasses durch das mitwirkende Handeln aller Miterben vor. Ohne das Erfordernis gleichzeitiger Erklärungen oder eines einheitlichen Rechtsaktes müssen sich die Willenserklärungen der einzelnen Miterben, die oft als Genehmigungen abgegeben werden, zu einem einheitlichen Verpflichtungsgeschäft aller zusammenfügen. Soweit die Miterben erkennbar nur für den Nachlass handeln, werden sie nur mit dem Sondervermögen, nicht mit dem sonstigen Vermögen, verpflichtet. Insofern ist eine vertragliche Haftungsbeschränkung anzunehmen.59
Ordnungsgemäße Verwaltung
Das Eingehen von Verpflichtungen im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung kann im Innenverhältnis mit Stimmenmehrheit beschlossen werden, §§ 2038 Abs. 2 Satz 1, 745 BGB. Die herrschende Meinung geht davon aus, dass einem solchen wirksamen Mehrheitsbeschluss60 auch Außenwirkung zukommt mit der Folge, dass die Mehrheit oder einzelne Beauftragte Vertretungsmacht haben, auch für die anderen Miterben zu handeln, das verlangt der Verkehrsschutz. Ferner folgt das aus § 745 BGB, da eine sinnvolle Vertretungsregelung zur ordnungsgemäßen Verwaltung gehört.
Der Verkauf eines Grundstücks kann eine Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung sein, selbst wenn dieses der einzig werthaltige Nachlassbestandteil ist.61
Notverwaltung
Dem einzelnen Miterben verleiht § 2038 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz BGB eine gesetzliche Vertretungsmacht für Notverpflichtungsgeschäfte.62
Verfügungsgeschäfte
Die Verfügung über einen Nachlassgegenstand erfordert nach § 2040 Abs. 1 BGB das Zusammenwirken aller Miterben. Als Verfügung wird dabei jede unmittelbare Einwirkung (Übertragung, Belastung, Änderung, Aufhebung) auf ein bestehendes Recht verstanden. Verfügungen sind damit beispielsweise Kündigung, Anfechtung, Widerruf, Aufrechnung, Annahme als Erfüllung, Verzicht. Auch die Zustimmung zur Löschung einer Eigentümergrundschuld kann nur von allen Miterben gemeinsam abgegeben werden.63
Verfügungen über Nachlassgegenstände werden häufig zur ordnungsgemäßen Verwaltung des Nachlasses erforderlich sein, können demnach im Innenverhältnis mit Stimmenmehrheit beschlossen werden. Zum Vollzug dieses Beschlusses ist, im Gegensatz zum Verpflichtungsgeschäft, die Mitwirkung aller Miterben erforderlich; § 2040 Abs. 1 BGB geht als Spezialnorm dem § 2038 BGB vor.64 Verweigert ein Miterbe seine Mitwirkung, so kann er von jedem anderen Miterben auf Erfüllung seiner Mitwirkungspflicht verklagt werden, § 2038 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz BGB (Klage auf Abgabe der Zustimmungserklärung – Leistungsklage).
Dieser Grundsatz der Einstimmigkeit bei Verfügungsgeschäften wird in der (neueren) Rechtsprechung nicht mehr uneingeschränkt eingehalten. So hat der BGH65 (bei der Kündigung eines Mietverhältnisses) unter anderem ausgeführt, dass dann, sofern es den Erben möglich ist, aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses wirksam Verpflichtungsgeschäfte zum Zweck ordnungsgemäßer Verwaltung abzuschließen, die Erben somit durch Mehrheitsbeschluss im Rahmen der Nachlassverwaltung verbindlich Verträge mit Dritten abschließen und damit obligatorische Rechtspositionen begründen können, es nicht ersichtlich ist, wieso es ihnen verwehrt sein sollte, diese Rechte – ebenfalls mehrheitlich – wieder aufzuheben. Die Kündigung ist ein – bezogen auf das Schuldverhältnis – unselbstständiges, akzessorisches Gestaltungsrecht. Dem Recht, einen Vertrag zu begründen, muss auch das Recht folgen können, diesen wieder zu kündigen.