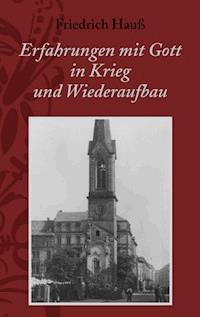
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Linea
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Wunder der Bewahrung, Wunder des geistlichen Aufwachens, Wachsens und Festwerdens. Autobiographische Erinnerungen des Pfarrers und späteren Dekans Friedrich Hauß (1893-1977) aus bewegter Zeit. In den beiden Weltkriegen und in den Neuanfängen nach dem jeweiligen Kriegsende erlebte er Gottes Bewahrung und Eingreifen auf vielfältige Weise. Seine Karlsruher Johanniskirche musste nach dem Bombenangriff neu gebaut werden. Noch mehr ging es ihm jedoch um den Aufbau der Menschen und der Gemeinde. Auch hier durfte er Wunder erleben. Ein motivierendes Buch, das wir jedem Pfarrer und jedem, der an Geschichte und an Biographien interessiert ist, empfehlen. Ein Buch das die Wichtigkeit kirchlicher Gemeindearbeit und von Gottes Wort geprägten Gemeindeaufbaus deutlich macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Hauß
Erfahrungen mit Gott
in Krieg
und Wiederaufbau
Wunder der Bewahrung,
Wunder des geistlichen Aufwachens, Wachsens und Festwerdens
1. Auflage
Verlag Linea Bad Wildbad 2011
So spricht der Herr:
Tretet auf die Wege,
seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit,
wo denn der Weg zum Guten sei
und geht ihn!
So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
(Jeremia 6, 16)
Umschlagsbild: Turm der Johanniskirche, Karlsruhe-Südstadt, nach Bombenangriff (Archiv der Ev. Johannis-Paulus-Gemeinde, Karlsruhe).
© 2011 Verlag Linea, Bad Wildbad
eBook Erstellung: eWort, Stefan Böhringer (www.ewort.de)
ISBN-Print 978-3-939075-37-0
ISBN-eBook 978-3-939075-50-9 (epub)
Von den Vorfahren her
Die Anfänge unseres Lebens liegen bei unseren Vätern. Die Segenslinien und Fluchlinien der Heiligen Schrift sind Wirklichkeit.
Mein Vater
Unser Geschlecht stammt aus dem alemannischen Gebiet westlich der mächtigen Schwarzwaldhöhe, der Hornisgrinde, deren Gebirgszug die Rheinebene nach dem Osten abgrenzt. In der fruchtbaren Ebene, begrenzt vom Rhein, durchströmt von wasserreichen Bächen liegt das Hanauer Land, das einst den Grafen von Hanau-Lichtenfels gehörte und von ihnen der Reformation zugeführt wurde. Die Menschen, die dort wohnen, sind hochgewachsene, blonde Gestalten. Es sind Nachkommen der von Osten herkommenden Alemannen, die das Land eroberten und die Urbevölkerung in die Berge trieben. Es gibt auch dunkelhaarige Menschen von mittlerer Größe, die von der Urbevölkerung der Kelten zurückblieben. Zu den Letzteren gehörte mein Vater, das jüngste Kind von acht Geschwistern. Die Vorfahren waren allezeit Bauern gewesen. Der Urahn, von dem die ältesten Kirchenbücher noch etwas wissen – im Elend des dreißigjährigen Krieges sind die noch älteren Bücher verloren gegangen – war nach diesem großen Krieg Schultheiß des Dorfes gewesen. Frei-stett hieß das Dorf, eine Erinnerung, dass der Ort eine uralte Zufluchtstätte für von der germanischen Blutrache Verfolgte war. So ist wohl anzunehmen, dass die „Hauße“ ein alteingesessenes Geschlecht waren. Nach irgendeinem Vorfahren, der Freude an schönen Pferden hatte, nannte man unsere Familie „Füchsemartes“. Der älteste Sohn hieß auch immer Martin. So hieß auch der älteste Bruder meines Vaters. Die schmucken Fachwerkhäuser hatten der Straße zu ihren Blumengarten und hinter Stall und Scheune einen großen Obstgarten. Wenn die Spätsommersonne darüber lag, war das ein wundersames Duften von süßen Birnen und rotbackigen Äpfeln. Mein Vater fiel schon als Junge aus dem allgemeinen Rahmen. Er war lieber bei den Büchern als auf dem Acker. Sein Vater war in jungen Jahren durch einen Unfall mit dem schwer beladenen Erntewagen ums Leben gekommen. Die Mutter war eine zierliche Frau, eine geborene Siehl, heiter und freigebig. Sie führte kein strenges Regiment. So kam es vor, dass ihr Jüngster, der Karl, stundenlang verschwunden war. Er saß auf dem Speicher und stöberte in den alten Büchern herum, die da lagen, oder er war beim Onkel Schwanenwirt, der einmal Landtagsabgeordneter gewesen war und die höhere Schulbildung der Bürgerschule des nahen Rheinbischofsheim genossen hatte. In dessen Rumpelkammer lagen alte Schulbücher, die der Knabe studierte. Karl durfte auch die Bürgerschule besuchen. Da die drei Jahre der Schule bald absolviert waren, war die Frage, was aus dem Buben werden sollte, der so wenig Interesse für die Handarbeit zeigte. Der Schwanenwirt riet zum Lehrerberuf. Der Schullehrer des Dorfes sollte ihm Geigenunterricht geben. Aber es stellte sich heraus, dass er völlig unmusikalisch war. Man kam auf den Gedanken, ihn auf das Gymnasium nach Karlsruhe zu tun. Dort wohnte in der Schützenstraße eine Freistetter Familie, die könnte ihn wohl aufnehmen. Über seinen Lebensunterhalt machte sich seine Mutter weiter keine Gedanken. Der Junge aber fand die Schulbücher der Untertertia, eine lateinische und eine griechische Grammatik, stürzte sich in den Sommerferien darüber her, konnte eine Klasse überspringen und trat in die Obertertia ein. Er hatte ein absolutes Gedächtnis. Was er einmal gelesen hatte, behielt er. So fiel ihm das Lernen leicht. Als er nun mit seinen halblangen Hosen und seiner Pelzkappe in die Reihe der vornehmen Schüler – viele von und zu, Ministersöhne und ähnlicher Herkunft – eintrat, hatten sie zuerst ihren Spott, bald aber staunten sie über seine Kenntnisse. Es vergingen kaum einige Tage, da wiesen ihm seine Lehrer schon Schüler zu, denen er Nachhilfeunterricht gab. Damit war die Frage seines Lebensunterhaltes gelöst. Sorgen machte er sich keine. Da hatte er die glückliche Art seiner Mutter. Er sparte mit heiterem Gemüt. Nie hatte er ein geheiztes Zimmer. In einem sehr kalten Winter erfroren ihm Hände und Ohren, weil er keinen Mantel besaß. Wir haben noch ein Notizbuch aus seiner Untersekundanerzeit, in das er mit gestochener Handschrift seine Aufgaben, seine Noten und seine Ausgaben aufgeschrieben hat. Es waren meistens Büchereinkäufe, die beträchtliches Geld verschlangen, denn an den Büchern pflegte er nicht zu sparen.
Das Wichtigste aber war sein Zug zu Gott hin. Er hatte in dieser Hinsicht nichts von zu Hause mitbekommen. Aber in Karlsruhe ging er regelmäßig in die Stadtkirche. Ein Vortrag von Prälat Kapff war entscheidend für ihn. Fortan holte er sich wöchentlich das Kirchen- und Volksblatt in der Druckerei. Sein Entschluss, Theologie zu studieren, stand fest, wenn er auch eine Zeit lang dem Studium der alten Sprachen zugeneigt war. Als er 1883 das Abitur mit „Sehr gut“ bestand – alljährlich hatte er die silbernen Preismünzen bekommen – bekam er durch Vermittlung seines Direktors Wendt das Prälat-Haubersche Stipendium, das ihm ein sorgenfreies Studium ermöglichte.
Vater war dann fünf Jahre Pfarrer in Vogelbach bei Kandern am Fuß des Berges „Blauen“.
Er hatte elf Nebenorte und drei Kirchen zu versorgen, was im Winter bei tiefem Schnee sehr anstrengend war, da alles zu Fuß gemacht werden musste. Er holte sich dabei eine Nierenblutung und musste versetzt werden.
Er kam in ein großes Industriedorf nach Sandhausen bei Heidelberg, wo er wegen Gründung einer Diakonissenstation einen Aufruhr der leicht beeinflussbaren Pfälzer Gemeinde hervorrief. Er sehnte sich nach einer gläubigen Gemeinde und bewarb sich um das Henhöferdorf Spöck bei Bruchsal, wo er dann auch einstimmig gewählt wurde. Die Gemeinde war eine Doppelgemeinde mit Staffort zusammen. Drei Jahre vor seiner Zurruhesetzung wechselte er nach Linkenheim, das zu seinem Dekanat Karlsruhe-Land gehörte, das er jahrzehntelang verwaltete.
Meine Mutter
Meine Mutter, Auguste Hauß, geborene Lehmann, war die Tochter eines in Tuttlingen geborenen Uhrenfabrikanten Anton Lehmann, der mit zwei Gesellschaftern in London eine Uhrenfabrik betrieb. Von Hause aus katholisch, wurde er durch eine englische Hausgehilfin erweckt, die bei den den Sonntagsgottesdienst meidenden drei Junggesellen nicht bleiben wollte, wenn sie nicht in den Gottesdienst gingen und das sonntägliche Kartenspielen unterließen. Großvater Lehmann ging nun in den englischen Gottesdienst und wurde zum evangelischen Glauben erweckt. Anfang der sechziger Jahre ließ er sich von seinen Teilhabern ausbezahlen und erwarb vor der Stadt Mannheim ein Gut, auf dem später die Schwetzinger Vorstadt gebaut wurde. Er fühlte den Drang, unter den Katholiken seiner Heimat zu missionieren. Später stellte er sich durch die Vermittlung des ehemaligen Henhöfervikars Ledderhose in St. Georgen in den Dienst der Henhöferbewegung und war einer der ersten Gemeinschaftspfleger, die Seminardirektor Stern, der Vorsitzende der Gemeinschaft Augsburgischen Bekenntnisses, berief. Er hatte einen weiten Bezirk zu bereisen. Er starb mitten im Siebziger Krieg an Nervenfieber und ließ seine aus dem Kraichgau stammende Frau Sophie, geborene Steidel, mit zwei Töchtern als Witwe zurück. Großmutter Lehmann war in Wiesloch Industrielehrerin gewesen und war eine nüchterne, ungemein fleißige Frau, die bei ihrer kleinen Kapitalrente als geschickte Weißnäherin tätig war, um ihre Kinder recht zu erziehen und noch eine offene Hand für das Reich Gottes haben zu können. Sie hielt sich treu zur Mannheimer Stadtmissionsgemeinde und bot in ihrer schlichten Wohnung gläubigen Soldaten ein Heim. Ihre jüngste Tochter war meine Mutter, Auguste Lehmann.
Sie war Konfirmandin von Pfarrer Greiner an der Trinitatiskirche und empfing von ihm bleibende Eindrücke. Sie hat ihrem Sohn das Erbe der Erweckung ins Herz geprägt. In vielfacher Krankheitsnot hatte sie mit der göttlichen Hilfe rechnen gelernt. Sie glühte im Eifer für das Reich Gottes. Sie war tätig im Dienst der Knabensonntagsschule, wo sie zweihundert Jungen durch ihre Erzählergabe bändigte, im Jungfrauenverein und in der Krankenseelsorge, wo sie oft bei wunderbaren Kuren das Eingreifen der göttlichen Hilfe erfuhr.
In der Erziehung ihrer Kinder war sie streng. Von Jugend auf wurden wir in den Gottesdienst mitgenommen, wohl schon als vierjährige Kinder. War ich dann unaufmerksam und störte durch neugieriges Umherschauen, wurde ich zu Hause gestraft. Und die neunschwänzige Klopfpeitsche wurde gefürchtet. Wir Kinder haben sie dann, als wir im Jahr 1906 Sandhausen verließen, um in der Henhöfergemeinde Spöck das Pfarrhaus zu beziehen, mit einem Stein beschwert und auf die hohe Trauerweide hinaufgeworfen. Mutter hat uns von dieser Zeit an nicht mehr körperlich bestraft. Große Sorge machte ihr mein Jähzorn, der mich manchmal überfiel und ins größte Unglück hätte hineinreißen können. Aber sie hat mich freigebetet.
Mutter war eine große Gärtnerin. Obwohl sie als Großstädterin, wie sie uns manchmal erzählte, die Bohnen nicht von den Erbsen unterscheiden konnte, arbeitete sie sich nach einem uralten Gartenbuch in die Geheimnisse des Gartenbaues ein. Ihre Pfarrgärten, die sie viel Kraft kosteten, waren Mustergärten. Was ist auch ein Pfarrhaus ohne Garten? Der Pfarrgarten ist die Welt der Kinder und ihr Paradies. An unseren ersten Garten in Vogelbach erinnere ich mich nicht mehr. Den wunderbaren Zauber des Südbadischen Schwarzwaldes lernte ich erst kennen, als unsere Eltern eine Ferienreise dahin machten. Es war um das Jahr 1907 herum. Unvergesslich das Rauschen der Bächlein, als uns an einem Regenabend eine Pferdekutsche von Kandern nach Vogelbach zog, wo ich 1893 geboren war. Ringsum strohgedeckte Dächer, das Pfarrhaus mit dem Blumen- und Gemüsegarten, die Sausenburg umwogt von Buchenwipfeln. Die Freundlichkeit und Anhänglichkeit der Leute zu meinen Eltern, die uns als deren Kinder überall willkommen hießen, die herrlichen Kirschen, mit denen man uns erfreute, die warme „Chunst“, das „Chriesesäckli“, das da gewärmt wurde und als Wärmflasche diente, sind unvergessliche Erinnerungen.
Ebenso leuchtet der Sandhäuser Garten, wohin mein Vater im Jahr 1895 versetzt wurde, als unser Kinderparadies. Um den kurzen Sonntag, der die Werktagswoche mit ihrer harten Schulpein durchbrach, länger zu machen, stand ich da immer früher auf. Hinter einem lauschigen Plätzchen blühten die Maiblumen, sah man die Nachbargärten am Hang, sah man die Morgensonne, hörte die Lerchen jubeln und erlebte die Morgenstille am Tag des Herrn.
Dunkle Schatten
Wenn ich von der staubigen Bahnhofstraße, wo einen die Buben drangsalierten, in die Stille des heimatlichen Gartens eintrat, fand ich Geborgenheit. Man konnte an Paul Gerhardts schönes Lied denken: „Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein!“ In diesem Garten suchte ich Zuflucht, als meine Großmutter Lehmann nach langem Leiden im Sterben lag. Ich suchte in meinem Naturkundebuch, wo der Mensch biologisch behandelt wurde, nach einem Mittel gegen den Tod und fand es nicht. Es waren schon vorher dunkle Schatten in meine kindliche Seele gefallen. In diesem Haus spukte es, wie ich lange nachher erfuhr. Jedenfalls war dem Kind, das aus dem stillen Schwarzwalddorf in das laute Pfälzer Dorf kam mit seinen vier, dem Pfarrhaus gegenüberliegenden Wirtshäusern, oft angst und bang vor der Nacht. Unheimliche Dinge, wie ein schaudererregendes Streichen über Stirn und Gesicht, ängstigten mich. Eine Zeit lang plagte mich das Nachtwandeln. Die Ärzte sprachen von Gehirnreizen. Meine liebe fromme Patentante Hofer, eine arme Weißnäherin, die einst Großmutter in ihrer Nähschule zum Glauben geführt hatte, betete für mich und auf ihre Veranlassung auch das Mütterlein Sprenger im Heiligenviertel in Dinglingen. Regelmäßige Güsse mit kaltem Wasser halfen mit, dass sich diese Angstzustände völlig verloren.
Aber das laute Leben unter den rohen Schulkameraden war mir oft eine Qual. Die Flucht ins Lesen war ein Trostmittel. Die Lesewut wurde oft unterbrochen von Mutters Aufträgen, die viel anstrengende Arbeit brachten. Da mussten wir zum Beispiel die Riesenbadewanne mit zwei Kindergießkännchen, die wir einige Minuten weit hertragen mussten, füllen und bekamen nach stundenlanger Arbeit fünf Pfennige Arbeitslohn. Das Harken der Gartenwege war ein ähnliches Geschäft.
Meine zwei Jahre jüngere Schwester Elisabeth war ein munteres Geschöpf. Sie hatte unter uns dreien, – eine Schwester war im Jahr 1900 noch dazugekommen, die Führung, weil sie im Gegensatz zu mir ohne jede Ängstlichkeit war. Das viele Lesen schreckhafter Geschichten hatte meine Ängstlichkeit noch vermehrt. Das Schlimmste war, wenn wir an Fastnacht, den weiten Weg durch das Gässchen, die Kirchenstaffel hinauf, den Diakonissen Fastnachtsküchle bringen mussten und uns die Narren mit schrecklichen Nasen verfolgten und mit ihren Schweinsblasen auf uns einhieben. Da hatte Elisabeth keine Hemmungen.
In dem Jahr, als Großmutter starb, wurde ich in Heidelberg ins Gymnasium aufgenommen. Die Schule lag am Neckarufer, und wir sahen die stolzen Schlepper vorbeifahren, Heilbronn zu. Wir hatten einen strengen Lehrer in Latein, Professor Höflin, der für jedes kleine Versagen Arrest diktierte. So plagte mich die Schulangst, weil ich sehr ehrgeizig war. Wenn dann die Schule aus war und das schnaubende Lokalzügle zur Stadt hinausfuhr, war das für mich eine jubelnde Fahrt in die Freiheit.
In den Ferien durfte ich mit Vater zu meinem Paten Adolf reisen, der Pfarrer in Hasel war. Es war die Belohnung für das gute Schlusszeugnis, dessen Ergebnis ich in lateinischer Sprache bei der Heimkehr jubelnd verkündigt hatte: „Primus sum, praemium habeo.“ Im Haseler Pfarrhaus war ein gleichaltriger Sohn Gottfried. Mit Wonne bauten wir im kristallklaren Haselbach einen Steinthron, wo man wie ein König sitzen und sich von der kühlen Flut umspülen lassen konnte.
Mein Vater hatte sich einige Male vergeblich für eine Stadtpfarrei gemeldet, war aber nie gewählt worden, weil das Kirchenregiment und die großen Kirchengemeindeausschüsse, die mit weltlich gesinnten Männern besetzt waren, keine bibelgläubigen Pfarrer wünschten. So waren in den größeren Städten oft nur ein einziger oder ganz wenige Pfarrer der biblisch orientierten Richtung. Bekannt waren uns in Mannheim Greiner, nach ihm Achtnich und Rost, in Karlsruhe Mühlhäuser, Schwarz und Kühlewein, in Freiburg der spätere Prälat Schmitthenner.
Mein Vater hatte in Sandhausen viel erlitten, weil er zwei Karlsruher Diakonissen zur Krankenpflege berufen hatte. Eine nun überflüssig gewordene Rote-Kreuz-Schwester wich nicht aus dem Dorf und erregte die leicht beeinflussbare Bevölkerung, die aus vielen Zigarrenarbeitern bestand, zu einem revolutionären Sturm, der sich gegen meinen Vater richtete. Man brachte ihn sogar vor Gericht, wo er aber freigesprochen wurde. Er wollte nun in der Gemeinde tapfer aushalten, bis sich die Wogen gelegt hätten, aber er sehnte sich nach einer Gemeinde, die den Linien des Neuen Testaments mehr entsprach.
Im Henhöferdorf Spöck
So verzichtete er auf alle Vorteile der Nähe Heidelbergs und meldete sich für die Henhöfergemeinde Spöck-Staffort, obwohl die Doppelgemeinde mehr Arbeit brachte. Und er wurde einstimmig gewählt.
Spöck lag zwischen zwei Bahnlinien, der Linie Karlsruhe–Bruchsal und der Linie Karlsruhe–Graben-Neudorf, dreieinhalb und fünf Kilometer entfernt. Um uns Kindern seine Entscheidung nicht zu schwer werden zu lassen, entschloss er sich, uns selbst zu unterrichten, was ihm bei seiner reichen Begabung nicht schwerfiel.
Das Bauerndorf Spöck zu erleben hatte für uns Kinder einen besonderen Reiz! Das zweihundertjährige Henhöferpfarrhaus mit seinen Gängen und Kammern war geheimnisvoll. Daneben stand ein uralter Nussbaum, in dessen Schatten Henhöfer seine „Textkreise“ um sich versammelt hatte. Ich hatte ein Zimmer mit einem weiten Ausblick zur pappelumsäumten Pfinz. Daneben war das Studierzimmer meines Vaters, das Arbeitszimmer Henhöfers, wo – wie Vater oft sagte, alle guten Geister wohnten. Henhöfer hatte da eine Altane gehabt, auf die er in Ermangelung einer Tür durch das Fenster hinausstieg. Der weite Pfarrgarten, der sich an den Hof anschloss, war von einer Mauer umschlossen. Eine Haselnuss- und Holunderhecke schloss ihn nach Süden ab.
Da machte es mir Freude, im Garten zu helfen. Im Herbst war da ein großes Ernten. Auf der Straße fuhr ein schwerbeladener Erntewagen nach dem andern vorbei, auf denen frohe Leute saßen.





























