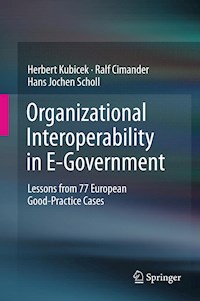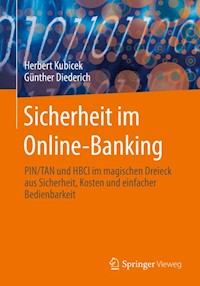Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2011 E-Book-Ausgabe (EPUB)
Lektorat: Helga Berger, Josh WardHerstellung: Sabine ReimannUmschlagabbildung: Thomas Kunsch, BielefeldSatz: Katrin Berkenkamp, Designwerkstatt 12, BielefeldDruck: Hans Kock Buch- und Offsetdruck GmbH, Bielefeld
ISBN : 978-3-86793-318-6
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Zusammenfassung
Kapitel 1 - Zielsetzung und Gegenstand der Studie
Kapitel 2 - Ausgangslage: Annahmen und Forschungs-stand zur Bürgerbeteiligung
2.1 Annahmen über die Wirkungen von Bürgerbeteiligung
2.2 Derzeitiger Forschungsstand und Defizite
2.3 Annahmen und Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren von Bürgerbeteiligung
Kapitel 3 - Konzeptioneller und methodischer Ansatz
3.1 Auswahl der Projekte
3.2 Entwicklung eines Analyse- und Bewertungsrasters
3.3 Angepasstes und operationalisiertes Bewertungsraster
3.4 Vorgehen zur Bewertung des Erfolgs der Projekte
3.5 Methode zur Ermittlung der Bedeutung von Erfolgsfaktoren
Kapitel 4 - Empirische Befunde zu den Wirkungen erfolgreicher Konsultationen
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse für alle Projekte
4.2 Vergleich innerhalb der Projektgruppen
Kapitel 5 - Empirische Befunde zu den Erfolgs-faktoren für Konsultationen
5.1 Berücksichtigung der angenommenen Erfolgsfaktoren in den untersuchten Projekten
5.2 Bedeutung der Erfolgsfaktoren für die Erreichung der einzelnen Wirkungen
5.3 Generelle und zielspezifische Erfolgsfaktoren
Kapitel 6 - Schlussfolgerungen
6.1 Empfehlungen für die Praxis
6.2 Methodische Anmerkungen zur Evaluation von Beteiligungsprojekten
Literaturverzeichnis
Quellen für die Bewertung der Fallbeispiele (Auswahl)
Anhang
Anlage A: Operationalisierung der Erfolgskriterien
Anlage B: Operationalisierung der Erfolgsfaktoren
Anlage C: Sensitivitätsanalyse der Erfolgsfaktoren
Die Autorinnen und Autoren
Zusammenfassung der Studie
Zum vorliegenden Materialband
Kapitel 1 - Bürgerhaushalt Berlin-Lichtenberg
1.1 Erfolgskriterien
1.2 Erfolgsfaktoren
1.3 Quellen
Kapitel 2 - Bürgerhaushalt Köln
2.1 Erfolgskriterien
2.2 Erfolgsfaktoren
2.3 Quellen
Kapitel 3 - Bürgerhaushalt Freiburg
3.1 Erfolgskriterien
3.2 Erfolgsfaktoren
3.3 Quellen
Kapitel 4 - e-PB Belo Horizonte, Brasilien
4.1 Erfolgskriterien
4.2 Erfolgsfaktoren
4.3 Quellen
Kapitel 5 - UN Habitat Jam
5.1 Erfolgskriterien
5.2 Erfolgsfaktoren
5.3 Quellen
Kapitel 6 - Familienfreundlicher Wohnort Hamburg
6.1 Erfolgskriterien
6.2 Erfolgsfaktoren
6.3 Quellen
Kapitel 7 - Listening to the City, New York
7.1 Erfolgskriterien
7.2 Erfolgsfaktoren
7.3 Quellen
Kapitel 8 - Stadionbad Bremen
8.1 Erfolgskriterien
8.2 Erfolgsfaktoren
8.3 Quellen
Kapitel 9 - Interaktiver Landschaftsplan Königslutter am Elm
9.1 Erfolgskriterien
9.2 Erfolgsfaktoren
9.3 Quellen
Kapitel 10 - TOM/TID
10.1 Erfolgskriterien
10.2 Erfolgsfaktoren
10.3 Quellen
Kapitel 11 - Regulations.gov
11.1 Erfolgskriterien
11.2 Erfolgsfaktoren
11.3 Quellen
Kapitel 12 - Police Act Review
12.1 Erfolgskriterien
12.2 Erfolgsfaktoren
12.3 Quellen
Zusammenfassung
Neue Formen der Bürgerbeteiligung werden angesichts veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen immer bedeutsamer. Ihre Etablierung gestaltet sich jedoch nach wie vor schwierig. Vor allem Unklarheiten über die Wirkung und die Erfolgsfaktoren spielen eine große Rolle bei der Entscheidung von politischen Entscheidungsträgern, ob zu einem auf der Tagesordnung stehenden Thema ein Beteiligungsverfahren durchgeführt werden soll. Für die zur Beteiligung eingeladenen Bürgerinnen und Bürger ist die Frage, ob sich der Einsatz lohnt, in vielen Fällen vorab auch nicht klar zu beantworten. Empirisch fundierte Untersuchungen zu diesen zentralen Punkten sind bisher kaum zu finden.
Die hier vorgelegte Studie soll diese Wissenslücke ein Stück weit schließen, indem sie drei Fragen nachgeht:
1. Welche Wirkung und welcher Nutzen lassen sich für als erfolgreich geltende Beteiligungsverfahren empirisch nachweisen?
2. Welche Faktoren spielen für erfolgreiche Beteiligung und die Erreichung bestimmter Beteiligungsziele eine nachweisbare Rolle?
3. Wie lassen sich Nutzen und Erfolgsfaktoren in zukünftigen Evaluationen methodisch fundiert ermitteln und Beteiligungsprojekte so besser evaluieren?
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt mithilfe eines in diesem Prozess entwickelten Analyse- und Bewertungsrasters auf der Basis einer Sekundärauswertung von verfügbaren Berichten zu zwölf Fallbeispielen konsultativer Bürgerbeteiligung. Diese Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:
(1) In Bezug auf Nutzen und Wirkung von Bürgerbeteiligung zeigt die Analyse der verfügbaren Daten zu den zwölf als erfolgreich geltenden Konsultationsverfahren, dass die üblicherweise mit dieser Art von Beteiligung verbundenen Zielsetzungen nachweisbar erreicht werden können. Bürgerbeteiligung kann demnach dazu beitragen:
- Lösungen für gesellschaftliche Problemlagen zu finden,
- Bedarfe und Interessen der Bevölkerung besser aufzunehmen und auszugleichen und
- Verständlichkeit und Akzeptanz von Maßnahmen zu fördern.
Überdies kann sie, wo dies gewünscht ist, den sich beteiligenden Bürgerinnen und Bürgern auch den erhofften Einfluss auf die zur Konsultation gestellten Planungen und Entscheidungen eröffnen.
Allerdings hat keines der untersuchten Projekte alle diese Zielsetzungen in gleichem Maße erfüllt. Daraus ergibt sich die Empfehlung, für ein konkretes Beteiligungsvorhaben Ziele zu priorisieren und es daraufhin auszurichten.
(2) In Bezug auf Erfolgsfaktoren von Bürgerbeteiligung hat die vergleichende Analyse ergeben, dass in allen zwölf Beispielen erfolgreicher Bürgerbeteiligung trotz unterschiedlicher Konsultationsziele, -methoden und -gegenstände drei Bedingungen stets in hohem Maße gegeben waren:
- eine klare Zielsetzung für die Konsultation
- ein Thema von hoher Dringlichkeit
- Bereitstellung ausreichender (finanzieller/personeller) Ressourcen
Für die in der Literatur häufig genannten Faktoren Transparenz, Anschlussfähigkeit und Verbindlichkeit des Konsultationsverfahrens konnte hingegen keine durchgehend hohe Bedeutung für den Erfolg eines Verfahrens nachgewiesen werden. Vielmehr sind für die einzelnen Ziele bzw. Erfolgskriterien jeweils einzelne Faktoren als besonders relevant identifiziert worden. Als (zusätzliche) zielspezifische Faktoren haben sich ergeben:
- für die Gewinnung lösungsrelevanter Informationen
• ein hoher Grad an Professionalisierung - vor allem durch die Unterstützung und Moderation durch externe Dienstleister
- für die Reichweite und Inklusivität des Beteiligungsverfahrens
• intensive Maßnahmen zur Mobilisierung von Teilnehmern, insbesondere durch umfangreiche Bekanntmachung über mehrere und zielgruppengerechte Kanäle sowie die gezielte Einbindung von Multiplikatoren
- für den Einfluss auf Entscheidungen
• die Herstellung von Transparenz
• die Anschlussfähigkeit des Beteiligungsverfahrens an den Entscheidungsprozess
- für die Akzeptanz von Entscheidungen
• ein hoher Grad an Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens durch die klare Kommunikation vor und während des Verfahrens und das Ablegen von Rechenschaft über die Verwendung der Ergebnisse
• die professionelle Umsetzung durch externe Begleitung
- für die breitere Förderung demokratischer Einstellungen und Verhaltensweisen
• spezielle Maßnahmen zur Mobilisierung - mit dem Effekt einer hohen Wahrnehmbarkeit bzw. öffentlichen Aufmerksamkeit
• eine hohe Transparenz des Verfahrens
• ein hoher Grad an professioneller Unterstützung, wobei überraschend ist, dass stärkere Aktivitäten politischer Entscheidungsträger keine positiven Effekte auf die Stärkung demokratischer Einstellungen und Verhaltensweisen zu haben scheinen
- für die Effizienz der Verfahren schließlich
• die intelligente Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien
Diese Zusammenhänge sind überwiegend nicht überraschend, sondern entsprechen durchaus bisherigen Erwartungen und Annahmen. Auf der Grundlage der Auswertung von zwölf Projekten können diese jedoch nun empirisch gestützt werden. Allerdings können umgekehrt aus dem Nachweis in einer noch recht kleinen Anzahl von Fällen keine Erfolgsgarantien abgeleitet werden, sondern nur die Empfehlung, bei Projekten mit den jeweiligen Zielsetzungen auf die genannten Faktoren zu achten und dafür entsprechende Ressourcen zu beschaffen und einzusetzen.
(3) In Bezug auf das methodische Vorgehen zur Evaluation von Bürgerbeteiligung kommt die Studie zu folgenden Schlussfolgerungen:
Die Evaluation von Beteiligungsprojekten sollte nicht anhand eines einheitlichen Kriterienrasters für alle Arten und Formate von Bürgerbeteiligung durchgeführt werden, da die Projekte in ihren Zielsetzungen und ihrer Vorgehensweise zu stark voneinander abweichen. Die Unterscheidung zwischen allgemeinen und zielspezifischen Erfolgsfaktoren, die sich im Zuge der durchgeführten Analysen ergeben hat, sollte bei zukünftigen Evaluationen von Anfang an getroffen werden.
In dieser Studie wurde nur eine begrenzte Anzahl von Erfolgskriterien und Erfolgsfaktoren herangezogen und nur auf einen bestimmten Typ von Beteiligungsverfahren angewendet. Diese Auswahl stützt sich auf ein allgemeines Strukturmodell mit Input-, Output-, Outcome- und Impact-Indikatoren, dem alle in der Literatur genannten Erfolgskriterien zugeordnet werden können. Daraus kann zukünftig für einzelne Arten von Beteiligung und unterschiedliche Evaluationsziele ein passendes konkretes Bewertungsraster abgeleitet werden. In dieser Studie geschah dies für konsultative Beteiligungsverfahren und eine Evaluation zum Zwecke praktischer Orientierungshilfen in Form der Konzentration auf die oben genannten Erfolgskriterien (Outcome- und Impact-Indikatoren) sowie Erfolgsfaktoren (Input-und Prozessindikatoren).
Bei der Operationalisierung von Bewertungsrastern muss zwischen Evaluationen in Form der Primärerhebung und Evaluationen in Form der Sekundäranalyse von Dokumenten zu unterschiedlichen bereits stattgefundenen Beteiligungsverfahren unterschieden werden. Bei Primärerhebungen für Wettbewerbe oder Benchmarkstudien kann für alle betrachteten Projekte dasselbe Raster mit denselben Operationalisierungen zugrunde gelegt werden. Es ist lediglich eine Frage der zur Verfügung stehenden Mittel, wie viele Indikatoren in welcher Tiefe erhoben werden. Sekundäranalysen sind demgegenüber auf vorliegende Berichte angewiesen, die für verschiedene Projekte nie identisch sind und daher keine homogene Datenbasis liefern. Diese Unterschiedlichkeit und auch Lückenhaftigkeit muss durch die interpretierenden Bewertungen der Autoren ausgeglichen werden. Jedoch sollen und können auch dafür Definitionen als Interpretationsleitlinien vorgegeben werden. Um die Subjektivität zu reduzieren, sollten mindestens zwei Evaluatoren die Fundstellen unabhängig voneinander interpretieren und ihre Bewertungen abstimmen. Dieser Prozess sollte dann so transparent wie möglich dargestellt werden. Dies wurde in der vorliegenden Studie sogar mit drei Evaluatoren praktiziert und in einem Materialband (siehe beiliegende CD) dokumentiert. Die Studie will damit in methodischer Hinsicht als Vorbild dienen.
Obwohl die hier betrachteten Projekte auch nach dem Kriterium der Verfügbarkeit von evaluationsrelevanten Daten ausgewählt wurden, erwies sich die Datenlage an vielen Stellen als unzureichend, um fundierte Aussagen zu jedem betrachteten Aspekt zu treffen. Besonders Impact-bezogene Daten, wie zum Beispiel die Bewertung der Ergebnisse durch Experten und Angaben zur Zufriedenheit der Nutzer mit den Ergebnissen sowie zu den demokratiefördernden Effekten und zur Effizienz, werden bei den meisten Projekten nicht ermittelt. Gerade auf diese Aspekte stützen sich aber viele Begründungen für Beteiligungsmaßnahmen. Daher ist es dringend notwendig, Evaluationsstandards zu schaffen und - soweit möglich - verbindlich einzusetzen.
1
Zielsetzung und Gegenstand der Studie
Die geringe Akzeptanz klassischer Beteiligungsformen durch die Bürgerinnen und Bürger und ein wachsendes Misstrauen in die Politik zeigen, dass entscheidende Mechanismen zur Konsensbildung im politischen System nicht mehr adäquat funktionieren. Ob dies eher an geänderten Erwartungen der Bürger an Politik und politische Teilhabe, an komplexer gewordenen Verhältnissen und/oder bestimmten Verhaltensmustern der Politiker liegt, sei dahingestellt. Unabhängig von der Ursachenklärung besteht große Übereinstimmung, dass die Bürger für eine stärkere Mitwirkung zur Bewältigung der aktuellen und absehbaren Herausforderungen gewonnen werden müssen und Bürgerbeteiligung daher für die Wahrung der Demokratie immer wichtiger wird.
Die Beteiligung der Bürger soll dabei unter anderem dazu beitragen:
- neue und bessere Lösungen für gesellschaftliche Problemstellungen zu erhalten, indem das Wissen der Politiker und der sie beratenden Experten durch das lokale und erfahrungsgestützte Wissen der von Entscheidungen oder Planungen Betroffenen ergänzt oder korrigiert wird
- Interessen besser auszugleichen und bisher unterrepräsentierten Stimmen größeres Gehör zu verschaffen
- die Akzeptanz und das Verständnis politischer Entscheidungen zu stärken sowie längerfristig verloren gegangenes Vertrauen in politische Institutionen und Politiker zurückzugewinnen und demokratisches Engagement zu fördern
Gegen eine direkte Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen wird jedoch angeführt, dass diese:
- zumeist nicht zu verwertbaren Ergebnissen führt
- von einzelnen Gruppen der Gesellschaft missbraucht wird und nur die artikulationsstarken und engagierten Teile der Bevölkerung diese Möglichkeiten nutzen
- häufig nur eine Alibi-Veranstaltung ohne echte Einflussmöglichkeit ist
- Nutzen und Kosten in keinem angemessenen Verhältnis stehen
Betrachtet man die in den letzten Jahren auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene durchgeführten Beteiligungsprojekte, so findet man schnell Beispiele, die ihre jeweiligen Ziele nicht erreicht haben und die Kritik belegen. In Wettbewerben, Beispielsammlungen guter Praxis und in Benchmark-Studien werden jedoch regelmäßig auch erfolgreiche Beteiligungsprozesse in Politik und Verwaltung ausgezeichnet, die zumindest nach Ansicht der Juroren und Evaluatoren die jeweils herausgestellten Ziele erreicht haben.
Die Wettbewerbe und Preisverleihungen liefern jedoch kein einheitliches Bild und vor allem kaum methodisch fundierte Erkenntnisse darüber, was mittels Bürgerbeteiligung konkret erreicht werden kann, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen und welche Faktoren für den im Einzelnen definierten Erfolg eine Rolle spielen.
Im wissenschaftlichen Bereich gibt es zwar eine Reihe von Vorschlägen, wie Evaluationen durchgeführt werden sollten. Vergleichende Untersuchungen sind bisher jedoch die absolute Ausnahme (Pratchett et al. 2009; Kubicek, Lippa und Westholm 2009; Albrecht et al. 2008; Neubauer und Kühnberger 2010).
Die hiermit vorgelegte Studie soll diese Wissenslücke ein Stück weit schließen und geht dazu drei Fragen nach:
1. Welche Wirkungen und welcher Nutzen lassen sich für als erfolgreich geltende Beteiligungsverfahren empirisch nachweisen?
2. Welche Faktoren spielen für erfolgreiche Beteiligung und die Erreichung bestimmter Beteiligungsziele eine nachweisbare Rolle?
3. Wie lassen sich Nutzen und Erfolgsfaktoren in zukünftigen Evaluationen methodisch fundiert ermitteln und Beteiligungsprojekte so besser evaluieren?
Diese Fragen wurden im Rahmen dieser Studie auf explorative Weise untersucht. Dazu wurden zwölf ausgewählte Beteiligungsprojekte aus dem In- und Ausland nach einem Bewertungsraster verglichen, das nach hohen konzeptionellen und methodischen Ansprüchen entwickelt und anschließend an die verfügbare Datenbasis angepasst wurde. Die geringe Fallzahl und die unvollständige Datenlage lassen dabei zwar keine gesicherten verallgemeinerbaren Aussagen über Erfolgsfaktoren von Beteiligungsprojekten zu. Sie erlauben jedoch eine bessere Orientierung für zwei mit der Planung von solchen Projekten befasste Zielgruppen:
- Entscheidungsträger und Umsetzungsverantwortliche in Politik und Verwaltung sollen mithilfe des entwickelten Rasters und der beispielhaften Befunde bessere Grundlagen erhalten, um sich im konkreten Fall nachvollziehbar für oder gegen den Einsatz eines Verfahrens der Bürgerbeteiligung zu entscheiden und im positiven Fall die jeweils verfolgten Ziele und die dafür relevanten Erfolgsfaktoren genauer bestimmen zu können.
- Evaluatoren von Beteiligungsprojekten wird ein praktisch erprobtes Raster und realistisches methodisches Vorgehen angeboten, mit dem sich der Nutzen und die Erfolgsfaktoren von Beteiligungsprojekten besser abschätzen lassen.
In Anbetracht der Fülle unterschiedlicher Beteiligungsformen musste auf eine Teilmenge vergleichbarer Projekte fokussiert werden. Ausgewählt wurden konsultative, d. h. auf Beratung zielende Beteiligungsverfahren, die auf Initiative der Politik oder der Zivilgesellschaft durchgeführt werden. Ihre Einordnung in das gesamte Spektrum von Bürgerbeteiligung gibt Abbildung 1 (S.18) wieder, die bereits in anderen Studien zur Klassifizierung von Beteiligungsprojekten verwendet worden ist (vgl. Kubicek, Lippa und Westholm 2009 sowie Albrecht et al. 2008).
In dieser Systematik werden übliche Bezeichnungen für Beteiligungsverfahren nach der Initiierung unterschieden und in beiden Richtungen nach dem Grad der Verbindlichkeit gestaffelt. Die von Verwaltung oder Politik initiierten Verfahren werden entsprechend der Unterscheidung der OECD in Information, Kommunikation und Kooperation differenziert, wobei Kooperation auch die deliberativen Verfahren beinhaltet (OECD 2001). Auf der Seite der von der Zivilgesellschaft, insbesondere Nichtregierungsorganisationen (NROs) oder der Wirtschaft, initiierten Verfahren wird ebenfalls nach dem Grad der Verbindlichkeit zwischen der Bereitstellung von Informationen, verschiedenen Formen des Aktivismus und der Kampagnen sowie förmlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen unterschieden.
Abb. 1: Systematik von Verfahren der Bürgerbeteiligung
Die Konzentration der vorliegenden Studie auf Konsultationsverfahren liegt insbesondere darin begründet, dass die in Abbildung 1 unterschiedenen Klassen von Beteiligungsverfahren unterschiedliche Zwecke verfolgen und unterschiedlichen Anforderungen genügen sollen. Sie alle mit denselben Kriterien bewerten und gemeinsame Erfolgsfaktoren für alle identifizieren zu wollen, halten wir daher für nicht sinnvoll. Konsultationsverfahren werden dabei umfassend verstanden, sodass hierunter sowohl förmliche Beteiligungsverfahren nach Bau- und Planungsrecht als auch informelle Verfahren, wie z. B. Konsultationen zu Bürgerhaushalten, Leitbildentwicklung oder Gesetzesvorhaben, betrachtet werden.
In dieser Studie werden zudem überwiegend Fallbeispiele evaluiert, die eine Kombination aus Online- und traditionellen Kommunikationsformen beinhalten. Der Grund für diese Auswahl liegt in der allgemeinen Erwartung, dass Online-Beteiligung einerseits den Kommunikationsaufwand reduzieren und damit Barrieren traditioneller Beteiligungsformen abbauen kann, andererseits jedoch durch das Erfordernis der Benutzung von Internetdiensten auf andere Barrieren trifft. Beteiligungsverfahren, die ausschließlich online angeboten werden, sind daher nur für bestimmte Themen und Zielgruppen angemessen. Wenn es um einen breiter gefächerten Adressatenkreis geht, ist ein sogenannter Multi-Kanal-Ansatz oder Medienmix heute die Regel (vgl. ausführlicher Kubicek, Lippa und Westholm 2009).
2
Ausgangslage: Annahmen und Forschungs-stand zur Bürgerbeteiligung
Während in der Management- und Organisationsforschung schon lange untersucht wird, wie erfolgreiche Beteiligung in Organisationen zu gestalten ist, wird die konsultative Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Prozessen vor allem aus politikwissenschaftlicher Sicht und überwiegend mit einer kritischen Distanz untersucht. Die Frage nach Kosten und Nutzen sowie Erfolgsfaktoren ist zumindest in Deutschland bisher nicht systematisch geklärt worden. Aus dem europäischen Ausland, insbesondere aus Großbritannien, liegen jedoch einige relevante Ansätze und Ergebnisse vor.
2.1 Annahmen über die Wirkungen von Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung an politischen oder administrativen Prozessen der Willensbildung, Planung und Entscheidungsfindung ist im Wesentlichen ein Produkt der Planungsdiskussion in den 70er Jahren sowie Reaktion auf eine damals entstehende Umwelt- und Sozialkritik in Form sozialliberaler Reformpolitik. Weil die zunächst eingeführten formellen Beteiligungsformen wenig Resonanz erzielten, wurden in den 80er Jahren, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltthemen in der sogenannten Agenda 21, neue Konsultations- und Kooperationsformen eingeführt. Seitdem wurden sowohl die gesetzlichen Beteiligungsrechte erweitert als auch neue informelle Verfahren in unterschiedlichen Politikfeldern mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt.
Innes und Booher (2004) fassen die damals wie heute vorgetragenen Gründe für Bürgerbeteiligung zu folgenden fünf Gruppen zusammen:
- »Through participation, decision-makers can find out what the public’s preferences are and consider them in their decisions.
- Decisions can be improved by incorporating citizens’ local knowledge.
- Public participation can advance fairness and justice.
- Public participation helps getting legitimacy for public decisions.
- Participation is offered by planners and public officials because the law requires it« (Innes und Booher 2004, S. 422 ff.).
Einen weiteren Aufschwung erfuhr die Empfehlung von mehr Bürgerbeteiligung durch die zunehmende Verbreitung des Internets und digitaler Kommunikationsmedien. Mithilfe dieser neuen Medien wird es zumindest theoretisch möglich, auch eine sehr große Anzahl von Menschen zu konsultieren und untereinander diskutieren zu lassen, da interaktive digitale Medien die Einseitigkeit der traditionellen Massenmedien aufheben und alle Empfänger zugleich Sender werden können. So gelang es z. B. im sogenannten IBM-Jam, 400.000 Teilnehmer in nur drei Tagen auf einer einzigen Plattform in eine Diskussion zu involvieren. Noch deutlicher wurde das politische Mobilisierungspotenzial im Wahlkampf des amerikanischen Präsidenten Obama (Bertelsmann Stiftung 2009).
Bei konsultativen Verfahren geht es allerdings weniger um massenhafte politische Mobilisierung, sondern vielmehr um einen zusätzlichen Nutzen für Planungen und politische Entscheidungen durch einen strukturierten, konstruktiven Austausch von Meinungen und/ oder Argumenten. Den von einer elektronischen Unterstützung solcher Beteiligungsprozesse zu erwartenden Zusatznutzen beschreibt eine Expertengruppe der OECD wie folgt:
- »Online offers of participation are easier and cheaper to access than physical meetings and allow for greater flexibility in time, and thereby reach a larger number of people.
- Many people do not like to speak in front of a larger audience and prefer to write comments on a forum.
- Information can be visualized and animated.
- Different levels of aggregation of information can be offered and linked.
- Online offers allow for interactivity, allowing more in-depth consultation, and support deliberative debate.
- Individual replies and comments can be published and shared.
- Online offers allow for more transparency of dialogues (and) are easier to monitor and evaluate« (OECD 2003, S. 33).
Nach der OECD hat vor Kurzem auch der Europarat die Ergebnisse einer internationalen Expertengruppe mit Empfehlungen für eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger verabschiedet und veröffentlicht, in denen die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, ihre Bürgerinnen und Bürger verstärkt an politischen Entscheidungen zu beteiligen und dabei Online-Verfahren zu benutzen (Council of Europe 2009).
Da bei Jugendlichen das Interesse an Politik und die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, geringer sind als bei Älteren, ihre Internetnutzung jedoch deutlich höher, glauben viele, dass man mit On-line-Beteiligungsangeboten gerade jüngere Bürgerinnen und Bürger besser erreichen kann.
Bis dato handelt es sich bei diesen und ähnlichen Thesen allerdings noch um überwiegend ungeprüfte Annahmen, die aus bestimmten Eigenschaften von Medien und Prozessen abgeleitet oder in einzelnen Fällen festgestellt wurden. Inwieweit diese einer umfassenden empirischen Prüfung standhalten und welche Bedingungen für ihr Eintreten erfüllt sein müssen, ist hingegen noch weitgehend ungeklärt.
2.2 Derzeitiger Forschungsstand und Defizite
Es gibt somit zwar hohe Erwartungen an positive Effekte von Bürgerbeteiligung; Evaluationen, die diese aufzeigen könnten, finden jedoch in den seltensten Fällen statt. Die OECD hat 2001 eine diesbezügliche Evaluierungslücke (»Evaluation Gap«) konstatiert und diese 2005 in ihrem Report »Evaluating Public Participation in Policy Making« noch einmal bestätigt:
»As noted in the 2001 OECD Report Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation in Policy Making, there is a striking imbalance between the amount of time, money and energy that governments in OECD countries invest in engaging citizens and civil society in public decision making and the amount of attention they pay to evaluating the effectiveness and the impact of such efforts. That a significant ›evaluation gap‹ exists is hardly surprising. If public engagement in policy making is a recent phenomenon and evaluation is itself a relative young discipline, then it may safely be said that the evaluation of public participation is still very much in its infancy« (OECD 2005, S. 105 f.).
Die aus dem Jahr 2001 stammende und 2005 wiederholte Feststellung, dass sich die Bewertung von Bürgerbeteiligung noch in den Kinderschuhen befinde, muss leider weitere fünf Jahre später immer noch bestätigt werden. Es gibt zwar inzwischen mehrere konzeptionelle und methodische Vorschläge.1 Deren Anwendung steht überwiegend jedoch noch aus und die wenigen durchgeführten Evaluationen werden diesen konzeptionellen und methodischen Anforderungen meistens nicht gerecht.2 Insgesamt sind die in der Literatur vorgeschlagenen Bewertungskriterien auch sehr heterogen. Der Stand der Beteiligungsforschung wird übereinstimmend als Einzelfall-orientiert (case-based, kasuistisch), selektiv hinsichtlich der betrachteten Aspekte und teilweise als ideologisch bezeichnet (vgl. auch Macintosh, Coleman und Schneeberger 2009; Kubicek 2008, 2010a).
Pratchett et al. (2009), die kürzlich die erste größere vergleichende Sekundäranalyse von mehr als hundert Beteiligungsprojekten vorgelegt haben, beurteilen die empirische Datenlage (»Evidence Base«) wie folgt:
»While there is extensive academic literature on this topic, the case-based evidence is actually quite limited. Much of the literature focusing on exploring particular normative accounts of deliberative or representative forms of democracy tends to be highly descriptive in relation to its handling of particular cases and is ›boosterist‹ in relation to e-democracy’s potential more generally. Moreover, there are only a limited number of examples of the Internet being used for policy deliberation, and these are often experimental in nature. (…)
The biggest problem with the literature, however, is that much of it is not concerned directly with seeking to understand or evaluate the impact of devices on empowerment. Research on e-Forums, in particular, focuses on the more direct questions of the type and quality of the deliberation taking place, and the effect of such features as moderation of discussion. There are only a limited number of cases where the wider issues of community empowerment can be identified« (Pratchett et al. 2009, S. 75).
Diese Einschätzungen zeigen deutlich, dass der Forschungsstand bei Weitem nicht ausreicht, um von einem gesicherten Wissen über den Nutzen und die Erfolgsfaktoren von Bürgerbeteiligung zu sprechen. Dies gilt auch für Bereiche, in denen Bürgerbeteiligung gesetzlich vorgeschrieben ist, wie in der Raum- und Stadtplanung (vgl. dazu ausführlicher Kubicek 2010b). In jüngster Zeit sind jedoch mit der Studie von Pratchett et al. (2009) und den bereits oben erwähnten Evaluationen vergleichende Bewertungen von Beteiligungsprojekten vorgelegt worden, die es zumindest erlauben, nachvollziehbar abgeleitete Hinweise auf mögliche Erfolgsfaktoren zu erhalten.
2.3 Annahmen und Erkenntnisse zu Erfolgsfaktoren von Bürgerbeteiligung
Wie angeführt, gibt es kaum systematische und empirisch fundierte Überprüfungen zum Nutzen von Bürgerbeteiligung. Es gibt inzwischen jedoch eine Vielzahl von Berichten über einzelne Beteiligungsprojekte; diese zeigen, dass die festgestellten oder auch nur geschätzten Effekte oft hinter den Erwartungen zurückbleiben, in Einzelfällen aber die Ziele durchaus erreicht werden.
Daher stellt sich die Frage nach den Faktoren und Bedingungen, auf die solche Erfolge zurückgeführt werden können. Da systematische Evaluationen fehlen, gibt es auch keine empirisch fundierten und methodisch validen Kausalanalysen. Dazu müsste eine größere Anzahl von Beteiligungsprojekten mit vergleichbaren Merkmalen, Kriterien und Randbedingungen erfasst werden. Dies ist bisher nicht geschehen.3 Es gibt lediglich einige Sekundärstudien, in denen unterschiedliche Einzelberichte qualitativ verglichen oder aber nachträglich nach gemeinsamen Vergleichsmerkmalen klassifiziert und codiert worden sind.4 Daneben gibt es eine Fülle von handlungsorientierten Ratgebern, in denen aus individuellen Erfahrungen und Eindrücken Vermutungen über Erfolgsfaktoren formuliert werden.5
In methodischer Hinsicht fällt auf, dass häufig keine klare und nachvollziehbare Unterscheidung zwischen Erfolgskriterien und Erfolgsfaktoren vorgenommen wird. So wird in Evaluationskonzepten und Metastudien der Aspekt der Transparenz des Beteiligungsverfahrens als Qualitäts- und Erfolgskriterium genannt, aber auch als Erfolgsfaktor, von dessen Grad die Erreichung anderer Erfolgskriterien wie die Akzeptanz oder Legitimation einer Planung abhängt.
In der bereits erwähnten Studie zum Stand der E-Partizipation für das Bundesministerium des Innern kommen die Autoren des Instituts für Informationsmanagement Bremen (ifib) und Zebralog nach einer Auswertung von über 30 in- und ausländischen Beispielen guter Praxis von Bürgerbeteiligung zu dem Ergebnis, dass vor allem drei Faktoren für den Erfolg von Beteiligungsprojekten maßgeblich sind (Albrecht et al. 2008, S. 142):
- Transparenz durch Veröffentlichung aller Beiträge bereits im laufenden Prozess, um Vertrauen zu schaffen und zunächst Zögernde zur Beteiligung zu motivieren
- Responsivität durch klare Darstellung, wie das Beteiligungsverfahren in den politischen Prozess eingebunden ist und was dabei mit den einzelnen Beiträgen geschieht, einschließlich Tracking und Tracing von Vorschlägen, Eingaben etc.
- Einbeziehung weiterer Kreise durch zusätzliche verkürzte Beteiligungsformen wie Polling und Rating
Als Erfolgskriterium wird dabei implizit eine möglichst große Anzahl sich beteiligender Adressaten angenommen. Für eine hohe Qualität der eingebrachten Beiträge dürften andere Faktoren maßgeblich sein.
Unter besonderer Berücksichtigung von Kommunikationsaspekten kommen Kubicek, Lippa und Westholm (2009) nach der qualitativen Auswertung von zehn Beteiligungsprojekten zu dem Ergebnis, dass die von ihnen so bezeichnete Metakommunikation, d. h. die Kommunikation über das Beteiligungsverfahren, ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Sie konnten zeigen, dass Berichte über ein Beteiligungsangebot sowie über Zwischenergebnisse in den Massenmedien bei lokalen Projekten, insbesondere in der örtlichen Tageszeitung, zur Erhöhung der Nutzung der Online-Angebote im Internet geführt haben.
Zur Frage nach dem angemessenen Verhältnis von Online- und traditionellen Kommunikationsformen im Beteiligungsprozess geht die Studie von Kubicek, Lippa und Westholm (2009) davon aus, dass es auf die richtige Entsprechung von Verfahrensziel, Thema und Zielgruppe ankommt. Mit der geringen Zahl von elf untersuchten Fällen konnten diese Faktoren jedoch nicht nachgewiesen werden. Neubauer und Kühnberger (2010) kommen nach Auswertung von 30 Online-Beteiligungsprojekten zu der Schlussfolgerung, dass dadurch sowohl eine Qualitätsverbesserung als auch eine höhere Akzeptanz erreicht werden konnte und sich die erfolgreichen Projekte insbesondere dadurch auszeichnen, dass ein klares Thema vorgegeben und die Diskussion in den Foren moderiert wurde, die Beteiligten einen persönlichen Bezug zu dem Thema hatten und der Ausgang des Prozesses noch offen war. Dabei handelt es sich allerdings um eine qualitative Einschätzung und nicht um einen differenzierten empirischen Nachweis.
Den einzigen bekannten methodisch elaborierten Ansatz zur Bestimmung von Erfolgsfaktoren bietet die bereits zitierte Studie von Pratchett et al. (2009). Sechs Wissenschaftler der Local Government Research Unit an der DeMontfort University sowie des Centre for Citizenship and Democracy der University of Southampton haben für das britische Department for Communities and Local Government in einem gemeinsamen Projekt nach über einjähriger Auswertung von ca. 100 Projekten einen Bericht mit dem Titel »Empowering communities to influence local decision making - A systematic review of evidence« vorgelegt. Der als »Empowering« bezeichnete Gegenstandsbereich dieser Studie ist etwas weiter gefasst als die hier eingegrenzte Bürgerbeteiligung und wird in sechs Gruppen von Verfahren unterteilt. Neben E-Partizipation im Sinne von elektronischen Foren werden Bürgerhaushalte (»Participatory Budgeting«) und Petitionen als eigene Klassen unterschieden und um die Kategorie »Redress« ergänzt, die sich auf Verfahren bezieht, in denen Bürgerinnen und Bürger Beschwerden und Klagen mit dem Recht auf eine faire Überprüfung und Antwort registrieren lassen können. Als Beispiel werden Beschwerden bei einem Ombudsmann genannt (Pratchett et al. 2009, S. 139). Darüber hinaus wurden noch zwei weitere Arten der Stärkung des Einflusses der Bürgerschaft untersucht, nämlich Fälle der Übertragung von Anlagen und Einrichtungen an Bürgerinnen und Bürger zur Selbstverwaltung (»Asset Transfer«) sowie Bürgermitverwaltung und -engagement in Bereichen wie Schulverwaltung, Stadterneuerung, öffentliche Sicherheit oder gesunder Lebenswandel (»Citizen Governance«).
Interessant für die hier verfolgte Fragestellung ist der methodische Ansatz. Für jede der sechs Klassen von Community Empowerment wurden verfügbare Projektberichte gesammelt und die Projekte nach einem gemeinsamen Bewertungsschema codiert und verglichen. In dem Bezugsrahmen wird zwischen Ergebnisfaktoren oder Erfolgskriterien (»Empowerment Success«) und Erfolgs- bzw. Einflussfaktoren (»Influencing Empowerment Success«) differenziert. Bei den Erfolgskriterien wird unterschieden zwischen:
- Effekten auf die beteiligten Personen wie Bildung und Stärkung von Vertrauen, Fachwissen, Engagement u. a.
- Effekten auf die Community (Stadtteil, Nachbarschaft) im Sinne von Effizienz, Zugkraft, sozialem Kapital und Zusammenhalt
- Effekten auf die Entscheidungsprozesse im Sinne von größerem Einfluss der Bürgerinnen und Bürger insgesamt und bisher ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen im Besonderen
Erfolgsfaktoren werden begriffen als Maßnahmen oder Bedingungen, die den Zuwachs an Einfluss und Verantwortung befördern oder behindern. Sie werden unterteilt in:
- Faktoren des Designs der jeweiligen Mechanismen oder Interventionen, insbesondere ob sie offen für alle sind, ob sie unterstützende Maßnahmen beinhalten und ob es Verbindungen zu den politischen Entscheidungsprozessen gibt
- Faktoren des Kontexts der Mechanismen bzw. Interventionen, insbesondere ob dieser Kontext durch eine geringe Ressourcenausstattung und eine große ethnische Vielfalt gekennzeichnet ist, ob die Maßnahmen von der Politik und Verwaltung vor Ort unterstützt werden und ob es sich um ein Thema von großem öffentlichem Interesse handelt
Für jede der sechs Klassen von Community Empowerment wurden ca. 20 Fallbeispiele guter Praxis danach codiert, ob der jeweilige Aspekt vorlag (1) oder nicht (0). Dies nennen die Autoren Boole’sche Reduktion. Dann wurden für jede Klasse für alle Ergebnis- und Einflussfaktoren sogenannte Wahrheitstabellen (»Truth Tables«) erstellt, aus denen ersichtlich wird, welche Faktoren im jeweiligen Einzelfall vorlagen und welche nicht. Für die Klasse E-Partizipation sieht dies wie folgt aus (Tabelle 1):
Tab. 1: Boole’sche Wahrheitstabelle nach Pratchett et al. (2009, S. 77)
In einem zweiten Schritt wird für jede Ergebnisgröße geprüft, in welchen Fällen sie positiv codiert wurde, und für diese Fälle wird dann die jeweilige Kombination der Einflussfaktoren ausgewiesen. Falls die Erfolgsfaktoren im jeweiligen Fall positiv codiert waren, werden sie in Großbuchstaben dargestellt, anderenfalls in kleinen Buchstaben. Für die Ergebnisgröße »Effekte auf die Beteiligten« ergab sich folgendes Ergebnis für die Einflussfaktoren A bis F:
Tab. 2: Einflussfaktoren für positive Wirkungen auf Beteiligte nach Pratchett et al. (2009, S. 77)
Daraus wird geschlossen, dass die Einflussfaktoren B (Moderation) und F (Thema von hohem Interesse) als Erfolgsfaktoren für positive Effekte auf die sich beteiligenden Individuen betrachtet werden können, da sie jeweils in fünf der hier ausgewählten sechs Fälle registriert wurden, in denen solche positiven Effekte festgestellt oder angenommen worden sind.
Das sechsköpfige Forscherteam hat mehr als ein Jahr für die Sammlung des Materials und die Codierung der ca. 100 Fälle benötigt. Die Ergebnis- und Einflussgrößen wurden für die untersuchten sechs Kategorien von Verfahren jeweils unterschiedlich operationalisiert. Bei allen Kategorien konnten Wirkungen auf die sich beteiligenden Individuen festgestellt werden, aber nur in Fällen der Citizen Governance und der Bürgerhaushalte konnten Effekte für die Community und die Entscheidungsprozesse nachgewiesen werden. Die untersuchten Beteiligungsverfahren haben danach nur sehr begrenzt auf die jeweilige Community ausgestrahlt. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für positive Effekte auf dieser Ebene waren ein klarer Bezug zu den jeweiligen Entscheidungsprozessen und ein Thema von sehr großem öffentlichem Interesse (Pratchett et al. 2009, S. 7 f.).
Die Ergebnisse dieser Analysen wurden im Rahmen der Studie auch mit Praktikern erörtert und fanden hohe Zustimmung. Auch wenn dies kein Nachweis der Validität der Befunde ist und die Lückenhaftigkeit der zugrunde liegenden Datenbasis stets bedacht werden muss, soll der methodische Ansatz in dieser Studie übernommen werden, in Anbetracht der kürzeren Bearbeitungszeit jedoch mit einer deutlich kleineren empirischen Basis. Allerdings erscheint es sinnvoll, für die hier betrachteten Verfahren der konsultativen Bürgerbeteiligung die Ergebnis- und Einflussgrößen konkreter zu definieren und differenzierter zu operationalisieren.
3
Konzeptioneller und methodischer Ansatz
Ein valider empirischer Nachweis der erwarteten Wirkungen von Beteiligung und ihrer Erfolgsfaktoren steht vor einer Reihe von Herausforderungen:
- Der Erfolg hängt vom Untersuchungszweck und den daraus abgeleiteten Bewertungskriterien ab. Es gibt kein universelles Bewertungsraster; vielmehr muss stets ein den jeweiligen Zwecken einer Evaluation angemessenes Bewertungsraster entwickelt werden, das den unterschiedlichen Anforderungen Rechnung trägt, die an Beteiligungsverfahren gestellt werden, und es muss genau dargelegt werden, was warum wie bewertet wird.
- Bestehende Evaluationsansätze und Vorgehensweisen erscheinen entweder theoretisch fundiert, aber mit den praktischen empirischen Forschungsmöglichkeiten und der bestehenden Datenlage nicht vereinbar oder umgekehrt zwar empirisch umsetzbar, aber wenig systematisch und nachvollziehbar.
- Die Datenlage in Bezug auf Evaluationen von Beteiligungsprojekten muss als heterogen und in weiten Teilen unzureichend bezeichnet werden. Gleichzeitig gestalten sich Primärerhebungen bei bereits gelaufenen Projekten schwierig bis unmöglich.
Für diese Studie mussten daher:
1. ein Bewertungsraster entwickelt werden, das verschiedene Zwecke und Ziele abbilden kann sowie theoretischen Annahmen, heterogenen Datenbeständen und praktischer Ermittelbarkeit gleichzeitig gerecht wird
2. Projektbeispiele ausgewählt werden, die eine möglichst große Breite von konsultativen Beteiligungsverfahren repräsentieren
3. eine Methode der Bewertung und des Vergleichs entwickelt werden, die möglichst valide und vor allem nachvollziehbar ist
Da die verfügbare Datenlage letztlich einen Engpass für eine Sekundäranalyse darstellt, sollen zunächst die für die vergleichende Evaluation ausgewählten Projekte vorgestellt werden. Anschließend wird die Entwicklung eines allgemeineren Bewertungsrasters aus bestehenden Ansätzen der Partizipations- und Evaluationsforschung wiedergegeben, das in einem zweiten Schritt an die verfügbare Datenlage und die konkreten, praxisbezogenen Zielsetzungen dieser Studie angepasst wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!