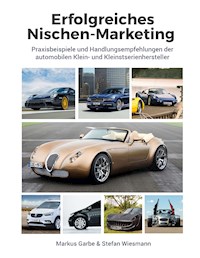
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Erfolgreiche Nischenanbieter müssen eine Marktlücke entdecken und versuchen, diese langfristig zu besetzen und abzusichern. Im Wettbewerb mit großen Anbietern, die den Nischenmarkt täglich beobachten, funktioniert dies nicht nur über Investitionen, sondern mit intelligentem, kreativem und vor allem schnellem Marketing. Das zeigen eindrucksvoll die Fallstudien dieses Buches. Die Kapitel vermitteln im Einzelnen: o Nischenmarketing als Kernelement des klassischen Marketings o Der Wandel des Automotive Marktes Deutschland o Fallstudien deutscher und niederländischer Klein- und Kleinstserienhersteller o Exklusive Interviews mit Geschäftsführern und Experten o Praxisempfehlungen für effizientes Marketing in der Nische o Nischenmarketing-Instrumente und Checklisten Das Buch richtet sich an Marketingverantwortliche im Automotive-Markt und im großen Marken-Mittelstand sowie an Dozenten und Studierende der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften mit dem Fokus auf Marketing und Vertrieb sowie Social-Media. Und nicht zuletzt an Automobil-Enthusiasten und Kleinserienfahrer, die sich einen Überblick über die Historie und den Status quo der Kleinserienhersteller verschaffen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Garbe
Filialleiter bei einer deutschen Nischenbank – der führenden Bank im Gesundheitswesen. Markus Garbe ist seit 2010 in der Finanzbranche tätig. Neben seiner Begeisterung für den Vertrieb und die Finanzwelt, schlägt sein Herz für die Automobilwelt. Bereits in der Kindheit haben ihn Automobile verzaubert und seine Automotive-Leidenschaft begründet.
Von der Leidenschaft angetrieben, konnte er im Rahmen seines berufsbegleitenden Master-Studiums seinen Dozenten Herrn Stefan Wiesmann als Betreuer für seine Master-Thesis gewinnen. Die Master-Thesis untersucht den Nischenmarkt der automobilen Klein- und Kleinstserienhersteller, die mit großer Leidenschaft, Energie und Enthusiasmus automobile Träume - teilweise in Handarbeit - wahr werden lassen. Die Untersuchungsergebnisse bilden die Basis für dieses Fachbuch.
Lieblingsautomobile: Porsche 918 Spyder, Wiesmann MF5 und Aston Martin Vantage
Stefan Wiesmann
Dipl.-Kfm. Stefan Wiesmann ist seit 1996 im Automotive- und IT-Markt tätig und seit 1999 als Unternehmensberater, Managementtrainer und FH-Dozent mit dem Fokus auf Marketing, Finanzmanagement und M&A. Seit mehr als 20 Jahren fasziniert ihn die automobile Kleinserie, die bis heute innovative Impulse für etablierte Marken liefert.
Lieblingsautomobile: Wiesmann MF4, Lamborghini Miura und Karmann Ghia
„David und Goliath oder unserer Vorliebe für die Kleinen“
Liebe Leserin,
lieber Leser.
versuchen Sie doch einmal die Zahl aller automobilen Marken zu schätzen, die seit Erfindung des Automobils weltweit auf dem Markt waren. Und das unter der Berücksichtigung, dass heute etwa 20 Marken die Mehrheit des Marktes dominieren. Die Zahl überrascht sogar manchen Automobilexperten: es wurden zeitweise schätzungsweise über 9.000 Automobilhersteller gezählt.
Dies zeigt die gewaltige Konzentration auf dem globalen Automobil-Massenmarkt und führt zwangsläufig zu effizienten Standards bei Design und Technik. Immer wieder gibt es jedoch kleine Hersteller, die sich eigensinnig und mutig gegen den Mainstream stemmen und ihre eigene Vision vom Automobil verwirklichen. Viele darunter beschäftigen sich mit puristischen Sportwagen und neuen Antriebstechnologien.
Im Sommersemester 2016 befassten wir uns im Rahmen der BWL-Vorlesungen an der FOM und an der Hochschule Düsseldorf im Teilgebiet Automotive Marketing unter anderem mit diesem interessanten Nischen-Markt und stellten fest, dass es über die Welt der Kleinserienhersteller bisher keine wissenschaftliche Untersuchung gab. Zudem gibt es kein aktuelles Lehrwerk für Hochschulstudenten und Praktiker zum Thema KMU Nischenmarketing.
Dies ist umso erstaunlicher, da „Marktlückenmarketing“ genau das ist, was mehr als 80 % der KMUs umsetzen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Anzahl aktueller Fachliteratur ist überschaubar oder veraltet.
So reifte der Entschluss, aus einer aufwändigen und sehr guten Masterthesis ein Fachbuch für Praxis und Studium zu verfassen, um diese beiden Lücken zu schließen.
Wir wissen gleichwohl, dass einige Inhalte - vor allem des Digitalen Marketings - schon bei Erscheinen bereits nicht mehr aktuell sind, aber dieses Buch soll dem interessierten Leser einen Überblick über den Kleinserienmarkt geben und das KMU Nischenmarketing beleuchten. Bei der Analyse stellten wir fest, dass die meisten Instrumente und Wirkungsweisen des Automotive Nischenmarketings auch eine wesentliche Rolle bei anderen Marken-Nischenanbietern spielen. Im Kapitel 5.3 finden sich daher Ratschläge und eine Checkliste für erfolgreiches Nischenmarketing.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine kurzweilige und auch spannende Lektüre. Dabei bedanken wir uns ausdrücklich bei allen Mitwirkenden, ohne die das Buch nur graue Theorie geblieben wäre. Unser besonderer Dank gilt den Herren Dr. Padberg, Kurek, Wiesmann, Bovensiepen, Dr. Knapp, Donkervoort, Fatthauer, Bitter, Zimmer und Fröhlich für Ihre tiefen Einblicke in einen besonderen Markt.
Markus Garbe & Stefan Wiesmann
Die größte Veränderung im Marketing und die große Chance für Nischenmarken
Für viele Marken- und Markenverantwortliche sind die zwei größten Veränderungen im 21. Jahrhundert Big Data und Social-Media. Auf operativer Ebene mag dies stimmen, aber auf strategischer Ebene ist die mit Abstand größte Veränderung die fortschreitende Globalisierung und Standardisierung.
Im 20. Jahrhundert war der Platz an der Sonne die Mitte des Marktes. Nur heute im globalen Wettbewerb ist die sogenannte Mitte entweder bereits besetzt oder sie ist aufgrund der Einkommensstruktur in der Bevölkerung nicht vorhanden. Deshalb gibt es im 21. Jahrhundert zwei Plätze an der Sonne, nämlich eine am oberen Ende des Marktes und eine am unteren Ende des Marktes.
Genau hier liegt auch die große Chance für Nischen- und vor allem auch für Supernischenmarken. Speziell im Automobilbereich könnten zudem Supernischenanbieter massiv von der Abkehr vom Verbrennungsmotor profitieren. Denn genau diese wird dazu führen, dass es lukrative Nischen genau für diesen Verbrennungsmotor speziell bei den Reichen und Superreichen geben wird. Nur wird man dazu zwei Grundbedingungen aus Markensicht erfüllen müssen:
Eine klare Premiumpositionierung und
eine konsequente globale Ausrichtung.
Michael Brandtner
Positioning-Consultant
Rohrbach, im Sommer 2017
Markenstratege Michael Brandtner ist der Spezialist für strategische Marken- und Unternehmenspositionierung in Rohrbach, OÖ, seit 2001 Associate of Ries & Ries und Autor des Buches „Brandtner on Branding“. Sein Blog: www.brandtneronbranding.com
Gefühl ist alles - oder Liebe geht durch den Wagen
Warum geben Menschen überproportional viel Geld dafür aus, ein Fahrzeug zu besitzen, das im Wesentlichen nicht zweckdienlich ist? Und dies, obwohl sie wahrscheinlich schon ein zweckdienliches Automobil ihr Eigen nennen können?
Mit rationalen Gründen kann das aus psychologischer Sicht kaum etwas zu tun haben. Vielmehr geht es wohl darum, emotionale Bedürfnisse zu erfüllen – zumal bei einem Nischenprodukt. Hierzu gehören Besitzerstolz, „Anders-sein-wollen“, mit allen Sinnen wahrnehmen, Beherrschung von Technik (und nicht von ihr beherrscht werden), Tradition, Rennsport-Faszination, Spirit. Diese Motivationswolke ließe sich leicht fortsetzen.
Der Mensch allerdings ist kein rationales Wesen, sondern ein rationalisierendes, d.h. er benötigt für sein Handeln oder Nicht-Handeln „gute“ Gründe. In der Erwartung, dass sich diese – ausgesprochen subjektiven Gründe – auch in Zukunft finden lassen, wird gerade in einer solchen Marktnische ein wachsender Raum für das Begehren automobiler Schätze vorhanden sein.
Seien es Klassiker, Kleinserien, Restaurationen, liebenswerte Kleinode oder auch Schrulligkeiten, die automobile Träume Gestalt werden lassen. Insbesondere exotische, leistungsstarke und hochpreisige Fahrzeuge fordern geradezu markante Fahrerprofile und ebensolche Persönlichkeiten, die genau dies mit einem entsprechenden Modell unterstreichen wollen.
Von Seiten der Anbieter von Nischenfahrzeugen wird es nach Lage der Dinge stets Enthusiasten geben, die ihren persönlichen Traum von der Produktion eines solchen Manufaktur-Automobils auf die Beine stellen: Der Erfolg sei ihnen gewünscht!
Prof. Dr. Rüdiger Hossiep
Ruhr-Universität Bochum
Bochum, im Dezember 2017
Die Freiheit des Autofahrers
Das Auto der Zukunft soll Autofahrer mit dem neuesten Stand der Technik, insbesondere in den Punkten Fahrdynamik, Lifestyle und Komfort, überzeugen. Dafür setzen Automobilhersteller ihren Schwerpunkt auf Software gestützte Systeme, die dem Kunden ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit mithilfe von Fahrzeugassistenzsystemen bieten. Dass solche Systeme nur mittels Erhebung und Austausch großer Datenmengen bestehen können, versteht sich von selbst. Und obwohl die Vorteile der Connected Cars keinesfalls von der Hand zu weisen sind und konsequent weiterentwickelt werden sollten, muss der Datenschutz als Individualinteresse des Autofahrers dabei ausreichend Berücksichtigung finden.
Fahrzeugassistenzsysteme sollen dem Fahrer dienen. Sie dürfen nicht zum Spion auf dem Beifahrersitz werden, der womöglich ohne explizite Einwilligung des Fahrers private Informationen an Dritte (Hersteller, Ordnungsbehörden, Versicherungen u.a.) weitergibt. Denn es ist bekannt, dass das Bewusstsein permanenter Beobachtung das Freiheitsgefühl des Autofahrers stört. Automobilhersteller sollten daher der Beeinträchtigung des Lebensgefühls „Freude am Fahren“ durch die selbstverständliche Beachtung elementarer Grundrechte jedes einzelnen Kunden entgegenwirken.
Prof. Dr. Julius Reiter
FOM / Kanzlei Baum, Reiter & Collegen Düsseldorf
Düsseldorf, im Dezember 2017
Rainer Kurek,
gf. Gesellschafter der AUTOMOTIVE MANAGEMENT CONSULTING GmbH
Das letzte Auto, sagte einst Ferry Porsche, werde ein Sportwagen sein. Dies ist die klarste Aussage, die jemals getroffen wurde über das Wesen des Automobils und die Rolle, die es in unserer hochstehenden technischen Gesellschaft spielt. Der SPIEGEL-Redakteur Christian Wüst, verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft und Technik“, bezeichnet Sportwagen als puren Ausdruck der Beziehung des Menschen zum Automobil, das dem zentralen Zweck dient, Emotionen freizusetzen.
Klein- und Kleinstserienhersteller widmen sich oftmals und sehr bewusst der Konzeption, Entwicklung und Herstellung solcher emotionalen, faszinierenden Sportwagen, die nicht nur sie selbst, sondern auch viele andere begeistern, die von diesen hochindividuellen Produkten träumen. Einen richtigen Sportwagen zu besitzen – das ist für viele noch immer Kindheitstraum und Vision zugleich. Sportwagen sind die ausdrucksstärksten Gradmesser für die industrielle Kultur eines Unternehmens, eines Landes, ja einer ganzen Epoche. Sportwagen verkörpern Automobilbau und Gesamtfahrzeugkompetenz in Reinkultur. Sportwagen emotionalisieren.
Die laufende Transformation von einer Industrie- hin zu einer höherentwickelten Wissensgesellschaft – im Rahmen einer stetig zunehmenden Internationalisierung – ist für alle Industrienationen dieser Welt zu einer unabwendbaren Herausforderung geworden. Dies gilt insbesondere auch für Deutschland, dem ein gravierender gesellschaftlicher, strategischer, struktureller und demografischer Wandel bevorsteht. Erste Auswirkungen für die Automobilindustrie lassen sich derzeit am Beispiel des „Dieselgates“ und anderen Entwicklungen in der Branche gut studieren.
Wertschöpfung findet bereits heute, verstärkt aber noch in Zukunft, in einer wirksamen Überleitung unseres bestehenden technischen (Erfahrungs-)Wissens in neue, bessere Problemlösungen statt. Nicht nur Produktivitätsstrategien und Effizienzsteigerungsprogramme werden die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen in Zukunft sichern, sondern vor allem Innovationen, die auf einer gezielten (Weiter-) Entwicklung unseres bestehenden (Erfahrungs-)Wissens basieren. Nur echte Innovationen ermöglichen die Beibehaltung und Verbesserung der aktuellen Wettbewerbsposition hiesiger Unternehmungen im (inter-)nationalen Vergleich. Die Grundlage für den Erfolg aller westlichen Industrienationen stützt sich seit jeher und verstärkt noch in Zukunft auf die technischen Errungenschaften einer funktionierenden, innovativen und freien Wirtschaft. Dabei ist es eine Irrmeinung, zu glauben, nur große Unternehmen könnten innovativ sein, da sie über die erforderliche Finanzkraft verfügen. Das Gegenteil ist der Fall, wie viele kleine, meist hochqualifizierte Manufakturen beweisen.
Dies gilt insbesondere auch für die aktuelle Marktsituation, die zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts von einem noch nie da gewesenen Wettlauf um Innovationen geprägt ist. Dieser Innovationswettlauf birgt allerdings auch die Gefahr in sich, den wahren Kundennutzen aus den Augen zu verlieren. Diese Entwicklung ist in vielerlei Hinsicht kritisch, da die Pkw-Neuzulassungen in den gesättigten Triademärkten (Nordamerika, Westeuropa, Japan) mittel- und langfristig kein Wachstum mehr versprechen und die Branche bis heute einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige unserer modernen Volkswirtschaft darstellt. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks in den Weltmärkten ist gutes und vor allem kundenorientiertes Innovationsmanagement zu dem entscheidenden Erfolgsfaktor aller Industrienationen geworden, von dessen professioneller Ausübung das Wohlstandsniveau künftiger Generationen abhängen wird. Innovationen sind der einzige Ausweg aus gesättigten Märkten – und diese entstehen oftmals auch bei Klein- und Kleinstserienherstellern, die im Fokus des vorliegenden Automobilfachbuchs stehen.
Im Gegensatz zur Vergangenheit reicht es heute nicht mehr aus, allein durch kreative Erfindungen den Markt »zu erobern«, da das strategische, prozessuale, strukturelle und kulturelle Fundament unserer hochentwickelten Industriegesellschaft mittlerweile eine enorm hohe Komplexität aufweist. Um unseren Kunden die richtigen Produkte in der richtigen Qualität zum richtigen Preis und richtigen Zeitpunkt anbieten zu können, ist es entscheidender denn je, neben substanziellen fachlichen Fähigkeiten auch über ein hochentwickeltes Management- und Marketingverständnis zu verfügen. Nur eine gezielte Verknüpfung von fundierter Branchenkompetenz mit bewährtem Management- und neuem Marketing-Wissen ermöglicht in den heutigen Industriestrukturen die Konzeption, Entwicklung und Realisierung von echten Innovationen, die in den (inter-)nationalen Märkten zu nachhaltig erfolgreichen Produkten und Ergebnissen führen. Dabei ist die Beherrschung der kompletten Prozesskette im Produktentstehungsprozess von vordergründiger Bedeutung.
Vor dem Hintergrund schwindender fossiler Brennstoffreserven und zunehmender Klima- und Umweltschutzanforderungen gewinnen alternative Antriebstechnologien und Leichtbau in der internationalen Automobilindustrie derzeit signifikant an Bedeutung. Und es ist davon auszugehen, dass sogenannte „Radikalinnovationen“ in diesen Technologiefeldern bereits in naher Zukunft über den Erfolg und Misserfolg von Unternehmen in der Branche entscheiden werden. Innovationen in diesen hochkomplizierten Technologiefeldern können nur von hochqualifizierten Experten realisiert werden, die ebenso gesamtfahrzeug- wie prozessfähig sind.
Deshalb steht das Thema „Leichtbau“ auch im unmittelbaren Zentrum laufender Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vieler Automobilhersteller und wissenschaftlicher Institute, die aufgefordert sind, durch verbrauchsärmere und abgasoptimierte
Fahrzeuge einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von Primärenergie zu leisten. Nachdem sich die kinetische Energie aus ½ mv2 (mxa) bestimmt, kommt der Fahrzeugmasse und damit dem Leichtbau künftig eine immer größere Bedeutung zu. Neue, leichtere, innovative Konzepte und Werkstoffe werden gesucht, um die gesellschaftlich wie (umweit-) politisch geforderten Niedrigenergie- und Niedrigemissionsfahrzeuge prozesssicher „auf die Straße“ bringen zu können.
Und gerade Leichtbau-Innovationen stehen oftmals auch im Fokus unterschiedlicher, hochinnovativer Klein- und Kleinstserienhersteller, die meist diszipliniert, konsequent, willensstark und beharrlich das Ziel verfolgen, leichte, qualitativ hochwertige und fahrdynamisch begeisternde Produkte zu realisieren. Melkus, McLaren, Pagani und viele andere Sportwagen sprechen für sich – diese Fahrzeuge emotionalisieren.
Enzo Ferrari postulierte einstmals, dass das Auto erfunden worden sei, um den Freiheitsgrad des Menschen zu vergrößern, aber nicht, um den Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Deshalb liegt die Genialität im Automobilbau doch meist auch in der Einfachheit, wie an vielen Klein- und Kleinstserienherstellern wie Artega, Wiesmann oder Donkervoort studiert werden kann. Leitbild, (Business-) Mission und strategische Ziele orientierten sich bei diesen Kleinserienherstellern an einfachen, transparenten und konsequenten Leichtbau-Lösungen.
Deshalb sollten wir gerade diesen Klein- und Kleinstserienherstellem in großer Achtsamkeit, Dankbarkeit und mit dem entsprechenden Respekt begegnen. Markus Garbe, der auf diesem Wege seinen Master of Science erlangte, und Stefan Wiesmann, der die wissenschaftliche Arbeit in vorbildlicher Art und Weise betreute und unterstützte, haben den Klein- und Kleinstserienherstellem jene Achtung und Aufmerksamkeit entgegengebracht, die diese mutigen, zivilcouragierten und oftmals auch sehr bescheidenen Unternehmungen verdienen. Deshalb gilt Herrn Markus Garbe und Herrn Stefan Wiesmann unser aller Dank. Die monatelange Forschung und Entwicklung für das vorliegende Werk haben sich wahrlich gelohnt – von den Ergebnissen, insbesondere im Bereich des strategischen und digitalen Marketings, können nicht nur die Klein- und Kleinstserienhersteller, sondern alle Leser profitieren. Die ernsthafte, professionelle und verantwortungsbewusste Analyse hat Vorbildcharakter, sodass ich allen Lesern des vorliegenden Werkes viel Freude bei der weiteren Lektüre wünsche.
Rainer Kurek, Penzberg, Im August 2017
©Rainer Kurek; Quelle: Kurek
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1.1 Ziele und Fragestellungen
Markt und Marketing
2.1 Begriffsverständnis der automobilen Klein- und Kleinstserienhersteller
2.2 Marktsegment der Klein- und Kleinstserienhersteller
2.3 Die selektierten Kleinserienhersteller im Profil
2.3.1 Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG
2.3.2 Bitter Automotive GmbH
2.3.3 Classic Motors Design GmbH
2.3.4 Donkervoort Automobielen B.V. (NL)
2.3.5 Kurek-Sportprototypen
2.3.6 Sono Motors GmbH
2.3.7 Wiesmann Automotive GmbH
2.3.8 9FF Engineering GmbH
2.4 Aktuelle Herausforderungen für die Automobilindustrie
2.5 Technologie-und Mobilitätstrends
2.6 Grundlagen des strategischen Marketings
2.6.1 Dialogmarketing
2.6.2 Customer-Relationship-Management
2.6.3 Medien des Dialogmarketings
2.6.4 Touchpoint Hopping
2.6.5 Internetauftritt
2.6.6 E-Mail-Marketing
2.6.7 Mobile Marketing
2.6.8 Social-Media-Marketing
Methodik
3.1 Qualitative Interviewforschung
3.2 Erhebung
3.2.1 Konstruktion und Inhalt des Interviewleitfadens
3.2.2 Nonstandardisiertes Interview
3.2.3 Stichprobe
3.3 Auswertung der Interviews
3.3.1 Transkription
3.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse
Untersuchungsergebnisse
4.1 Ergebnisse der Fragestellung 1
4.1.1 Nischenbesetzung
4.1.2 Unternehmensdiversifikationen
4.1.3 Faszination der Klein- und Kleinstserienhersteller
4.1.4 Zielgruppe der Klein- und Kleinstserienhersteller
4.2 Ergebnisse der Fragestellung 2
4.2.1 Differente Ursachen für die betriebswirtschaftliche Problematik
4.3 Ergebnisse der Fragestellung 3
4.3.1 Marketingaktivitäten der Klein- und Kleinstserienhersteller
4.3.2 Bedeutung und Effizienz des Digitalen Marketings
4.3.3 Kosten für den Aufbau des Digitalen Marketings
4.3.4 Einsatz des Digitalen Marketings in der Automobilbranche
4.4 Ergebnisse der Fragestellung 4
4.4.1 Erfolgsfaktoren für die Klein-und Kleinstserienhersteller
4.4.2 Zukunftsperspektiven für die Klein- und Kleinstserienhersteller
Diskussion
5.1 Kritische Reflexion der Methodik
5.2 Interpretation der Ergebnisse
5.2.1 Marktpositionierung der selektierten Hersteller
5.2.2 Ursachen für die betriebswirtschaftliche Problematik
5.2.3 Strategisches Marketing und Effizienz des Digitalen Marketings
5.2.4 Datenschutz und IT-Sicherheit
5.3 Checkliste für die Klein-und Kleinstserienhersteller
5.4 Lernfelder für die Großserienhersteller
5.5 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1. Fragestellungen
Abbildung 2. Unternehmen in der Konzernstruktur
Abbildung 3. Kurzprofil Alpina
Abbildung 4. Modellübersicht Alpina
Abbildung 5. Kurzprofil Bitter
Abbildung 6. Modellübersicht Bitter
Abbildung 7. Kurzprofil Fröhlich
Abbildung 8. Kurzprofil Donkervoort
Abbildung 9. Modellübersicht Donkervoort
Abbildung 10. Kurzprofil Kurek
Abbildung 11. Kurzprofil Sono Motors GmbH
Abbildung 12. Kurzprofil Wiesmann
Abbildung 13. Modellübersicht Wiesmann
Abbildung 14. Kurzprofil 9FF
Abbildung 15. Prognostizierte Umsatzentwicklung
Abbildung 16. Entwicklung der weltweiten Automobilproduktion
Abbildung 17. Bestandteile des Marketingkonzeptes
Abbildung 18. Voraussetzung für Dialogmarketing
Abbildung 19. Medien im Dialogmarketing
Abbildung 20. „Touchpoint Hopping“
Abbildung 21. Inhalte einer Website
Abbildung 22. Anteil der Smartphone-Nutzer in Deutschland
Abbildung 23. Ziele von Mobile Marketing
Abbildung 24. Kommunikationsmaßnahmen Mobile Marketing
Abbildung 25. Zielsetzungen von Social-Media-Marketing
Abbildung 26. Social-Media-Plattformen
Abbildung 27. Prozessmodell induktiver Kategorienbildung
Abbildung 28. Gütekriterien
Abbildung 29. Zielgruppe
Abbildung 30. Chancen von Digitalem Marketing
Abbildung 31. Erfolgsfaktoren
Abbildung 32. Lernfelder
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Rekorde von 9FF
Tabelle 2. Aktuelle Herausforderungen
Tabelle 3. E-Mail-Marketing
Tabelle 4. Inhalt des Interviewleitfadens
Tabelle 5. Spezialisierung der selektierten Hersteller
Tabelle 6. Unternehmensdiversifikationen
Tabelle 7. Faszination für die eigene Marke
Tabelle 8. Preisspannen der Klein-und Kleinstserienhersteller
Tabelle 9. Ursachen für die betriebswirtschaftliche Problematik von automobilen Klein-und Kleinstserienherstellern
Tabelle 10. Marketingaktivitäten
Tabelle 11. Kostenschätzung: Aufbau und Pflege von Digitalem Marketing
Tabelle 12. Checkliste für Klein-und Kleinstserienhersteller
Tabelle 13. Interviewleitfaden: Automotive-Unternehmensberater
Tabelle 14. Interviewleitfaden: Käuferklientel
Tabelle 15. Interviewleitfaden: Unternehmensberater – Digitales Marketing
Abkürzungsverzeichnis
B2C
Business-to-Consumer
Bitter CD
Bitter Coupé Diplomat
BVDW
Bundesverband Digitale Wirtschaft
CRM
Customer-Relationship-Management
CC
Connected Car
CFK
Carbonfaserverstärkter Kunststoff
DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung
ECSSTA
European Community Small Series Type Approval
GFK
Glasfaserverstärkter Kunststoff
KBA
Kraftfahrt-Bundesamt
OEM
Original Equipment Manufacturer
ROMI
Return-on-Marketing-Investment
RWTH
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
SEC
United States Securities and Exchange Commission
USP
Unique Selling Proposition
VDA
Verband der Automobilindustrie
1 Einleitung
„Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden: einen kleinen, leichten Sportwagen, der die Energie effizient nutzt. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen.“ (F.A.E. Porsche).
Seit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 durch Gottlieb Daimler und Carl Benz hat die Automobilgeschichte schon viele Automobilmarken hervorgebracht, deren Gründer von dem gleichen Wunsch getrieben waren wie dem Schöpfer des ersten Porsche-Sportwagens, Ferdinand Anton Ernst Porsche (Daimler, n.d.). Wie viele Automarken es weltweit tatsächlich gab, ist auch von Automobilhistorikern kaum zu bestimmen. Schätzungsweise wurden zeitweise weltweit insgesamt über 9.000 Automobilhersteller gezählt (Köhnlechner, 2014). Viele Hersteller sind innerhalb von wenigen Jahren wieder vom Automobilmarkt verschwunden. Im Rahmen dieser Marktbereinigung wird die Automobilindustrie immer mehr von wenigen großen Automobilkonzernen dominiert, die eine Vielzahl von Automarken unter dem Konzerndach vereinen. Die weltweite Produktion von Personenkraftfahrzeugen belief sich im Jahr 2018 auf rund 70,5 Millionen Stück (OICA, 2019).
Dennoch gab und gibt es immer wieder Neugründungen von Automobilherstellern in verschiedenen Marktsegmenten. Die automobilen Neugründungen beziehen sich in der Regel auf Klein- und Kleinstserienhersteller, die mit ihrer Nischenstrategie die vielseitigen Ansprüche bestimmter Kundengruppen bedienen und mit großer Leidenschaft und Enthusiasmus automobile Träume wahr werden lassen. Seit der Erfindung gehört das Automobil zu den emotionalsten Produkterlebnissen der Menschheit. Gleichzeitig gehören Automobile zu den technisch anspruchsvollsten Produkten unserer Zeit. Zu Beginn der Erfindung waren Autos nur wenigen Menschen zugänglich und galten in der Gesellschaft als Prestigeobjekt. Die Einführung der Fließbandfertigung machte Autos auch für die breiten Bevölkerungsmassen erschwinglich. Das Auto entwickelte sich im Laufe der Zeit zum dominierenden Verkehrsmittel. Heute versuchen die Hersteller, sich durch Individualisierung und Differenzierung von der Konkurrenz abzuheben. Das steigende Produktangebot und die Ausdehnung der Modellpaletten von den Großserienherstellern wecken bei einigen Kunden aus bestimmten Gründen den Wunsch nach einem besonderen Fahrzeug. Diese Kunden schätzen es, dass ihr Auto nicht von einem Großkonzern stammt und in der Regel in aufwändiger Handarbeit in einer handwerklichen Manufaktur mit viel Hingabe und Leidenschaft gefertigt wird. Die Klein- und Kleinstserienhersteller bedienen mit ihren hochemotionalen Produkten also einen Nischenmarkt, wo Exklusivität, Luxus, Emotionalität, Unabhängigkeit und Individualität für die Zielgruppe Kaufkriterien sind. Auf den Straßen bleiben die Fahrzeuge der Nischenanbieter aufgrund der begrenzten Stückzahlen eine rare Ausnahmeerscheinung. Auf den verschiedenen internationalen Automobil-Messen sind traditionell viele der automobilen Exoten zu bestaunen. Die Supersportwagen von bekannten Kleinserienherstellern wie Pagani, Koenigsegg oder McLaren gehören zu den derzeit teuersten Automobilen der Welt.
Der Firmensitz automobiler Klein- und Kleinstserienhersteller wird aufgrund der ausgeprägten Automobilkultur oftmals in Ländern wie Großbritannien oder Italien vermutet, wo es eine ganze Reihe von kleinen Sportwagenherstellern, Tunern und Karosseriebauern mit einer motorsportlichen Vita und langer Markentradition gibt. Aber auch in Deutschland und in den Niederlanden gab und gibt es Klein- und Kleinstserienhersteller, die mit unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten und Strategien Marktnischen besetzen möchten. Dazu zählen beispielsweise die Hersteller Alpina, Artega, Bitter, e-Wolf, Gumpert, Melkus, Roding Automobile, Veritas, Wiesmann, YES!, 9FF, Donkervoort, Spyker Cars oder Vencer. Doch die wenigsten Hersteller haben es geschafft, bekannt zu werden, die eigene Marke erfolgreich aufzubauen und auf Dauer mit der Klein- und Kleinstserienherstellung profitabel zu sein. Die Mehrzahl der kleinen Hersteller hatte finanzielle Krisen, eine hohe Anzahl an Eigentümerwechseln, stellte Insolvenzanträge oder musste ihre Unabhängigkeit aufgeben. Einige sind vom Markt verschwunden, einige wenige sprechen von einem Comeback.
In der wissenschaftlichen Fachliteratur ließen sich keine Forschungsarbeiten über den Nischenmarkt der Klein- und Kleinstserienhersteller recherchieren. Bisherige mediale Berichterstattungen skizzieren die Welt der automobilen Klein- und Kleinstserienhersteller nur oberflächlich. Damit stellt der automobile Nischenmarkt und sein Marketing ein bisher noch unerforschtes Themengebiet dar.
Derzeit können nur Vermutungen über die möglichen Ursachen für die betriebswirtschaftliche Problematik und Zukunftsperspektiven der Klein- und Kleinstserienhersteller angestellt werden.
Exkurs: Nischenmarketing als Reaktion auf Marktveränderungen
Das Markenprodukt Automobil wird rasant weiterentwickelt. Der Wettbewerbsdruck aus der VR China und Indien wird forciert und digitalisiert. Alternative Mobilitätskonzepte benötigen immer mehr externes Knowhow. Der Internet-Riese Google dringt schon jetzt machtvoll mit selbstfahrenden Autos in den Automarkt ein. Weitsichtige Hersteller und Zulieferer richten ihr Produktionsprogramm auf die zunehmende E-Mobilität, Batterie- sowie Digitalisierungsentwicklung aus. Noch sind diese in der Minderheit und der Verbrennungsmotor ist in Deutschland das Maß aller Dinge. In Ländern wie Schweden oder der VR China verändert sich die Sichtweise rasant. Das US-Unternehmen Tesla zeigte als erstes, dass ein E-Automobil ansehnlich und preislich erschwinglich sein kann.
Im bisherigen Analog-Bereich wird die kooperative Fertigung von Automobilen oder Zubehör und die Reduzierung von Überkapazitäten in den deutschen Unternehmen mit Weitblick zu einer Konzentration des Angebots und zu mehr Kapitaleffizienz und Rendite führen. Wer weiterhin allein auf den Verbrennungsmotor setzt, wird künftig globale Märkte verlieren. Es sei denn, er bedient als Nischenanbieter einen Teilmarkt. Hier liegt die Verantwortung bei den Managements, nicht bei der Politik.
Der Autohaus-Vertrieb und Service werden sich konsequent verändern. Bei etablierten Autohausgruppen werden sich künftig für Konzentrationen und Mergers & Acquisitions weitere Optionen ergeben. Mehr als 70 % der Autohausumsätze liegen noch im fossilen V-Motorbereich. Künftig wird es aber eher um Software Updates, Bordnetzentwicklung, die Batteriewartung und Digital-Reparaturen gehen. Führende Hersteller, wie BMW, VW, Volvo und Porsche, haben das längst erkannt.
Wie reagieren die Automobilhersteller auf den rapiden Wandel?
Autohersteller und Zulieferer kaufen sich digitales oder technisches Knowhow ein, gleichzeitig etablieren sich globale Technologieanbieter aus Nordamerika, Israel und Indien als automobile Zulieferer für Sicherheitssysteme, autonomes Fahren, Digitalisierung und Konnektivität sowie Batteriemanagement Systeme. Investitionen in dem digitalen Sektor sind schon im Gründungsstadium keine „Schnäppchen“ und CEOs aus der Startup-Branche müssen nach der Transaktion beim traditionellen, analogen Automobilhersteller langfristig und konkret zur digital-analogen Wertschöpfung beitragen. Das Fahrzeug wird immer mehr zum „rollenden PC“, sodass die bisherige Expertise der Automobilkonzerne, beispielsweise bei Motoren oder Bremsen, immer mehr an Bedeutung verliert. Die größte Wertschöpfung wird zukünftig aus dem
Datencenter der Autos entstehen. Der wirtschaftliche Effekt solcher gravierenden Innovationen ist für die bisherige Automobilbranche dramatisch.
Konzentrationen wird es zudem bei der Erfassung der Umwelt und Verarbeitung der Daten geben, bei der Telekommunikation und bei der Infrastruktur für E-Mobilität. Hersteller und Zulieferer werden sich einen harten Wettbewerb um die Startups und bereits erfolgreichen IT-Unternehmen in der Seed-Phase liefern, die strategisch und produkttechnisch in das Produkt-Portfolio passen und Automobilen einen konkreten Mehrwert geben.
Die operativen Margen großer und kleiner Hersteller geraten verstärkt unter Druck.
Insbesondere Nischenhersteller müssen genau kalkulieren, da die Entwicklungs- und Vorlauf- sowie Zulassungskosten nahezu identisch sind mit denen der Konzerne. Der europäische Zulieferermarkt ist noch fragmentiert. Trotz eines hohen Grades an Professionalisierung bei der Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge wird der technische und digitale Anspruch an die Teile weiter zunehmen. Somit wächst der Druck, digitalisierte Geschäftsprozesse zu implementieren. Es ist mehr als fraglich, ob die klassischen KMUs bis zu einer Jahresumsatzklasse von 50 Mio. Euro dauerhaft diesem Konkurrenz- und Margendruck standhalten können. Das wissen die Nischen-Unternehmer und sind zumindest gesprächsbereit bezüglich einer Beteiligung oder Fusion. Große Unternehmen sind hier grundsätzlich kooperativ, da sie Massenanbieter sind und vom Knowhow und Image des kleinen Herstellers profitieren. Hier seien nur die Beispiele der langjährigen Zusammenarbeit von BMW und Wiesmann sowie BMW und Alpina genannt. Und dennoch wissen die kleinen Anbieter: Es wird auch künftig einen Markt geben für Kunden, die das Geräusch des Verbrennungsmotors schätzen und sich nicht mit dezent integrierten Außen-Lautsprechern zufriedengeben, die dem Fahrer und der Umwelt ein Motorgeräusch vortäuschen. Das Seltene ist das Besondere und daher wird der Nischenmarkt immer Bestand haben. Genau da liegt die Nische für Hersteller von Alpina bis Wiesmann. Wie die einzelnen Anbieter mit ihrem Nischenmarketing und Automotive Management darauf reagieren, zeigen die einzelnen Kapitel.
1.1 Ziele und Fragestellungen
Anknüpfend an die beschriebene Ausgangslage ist ein Ziel dieser Markt-Analyse, das Defizit der bisher fehlenden wissenschaftlichen Betrachtung zu mindern. Hierfür wird eine umfassende qualitative Untersuchung mit selektierten deutschen und niederländischen Klein- und Kleinstserienherstellern durchgeführt, die den automobilen Nischenmarkt und dessen Vielseitigkeit repräsentieren. Für die Untersuchung konnten unter anderem die ehemaligen oder aktuellen Geschäftsführer, die in den meisten Fällen auch die Gründer der selektierten Klein- und Kleinstserienhersteller waren, im Rahmen von Experteninterviews gewonnen werden. Die authentischen, individuellen Erfahrungen, Einschätzungen, Meinungen und Sichtweisen der verschiedenen Interviewpartner ermöglichen wertvolle Einblicke in das reale Kleinserien-Unternehmertum und die speziellen Marktgegebenheiten.
Aufgrund der Komplexität in der Automobilbranche, die als eine der komplexesten Industriezweige weltweit gilt, werden inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, die das Thema eingrenzen. Ein Ziel ist es, dem Leser einen Einblick in die Unternehmensgeschichte der selektierten Automobilhersteller zu geben, um den besonderen Charakter der Nischenanbieter zu verdeutlichen. Da sich nur wenige Kleinserienhersteller in Deutschland und in den Niederlanden mit einer wettbewerbsfähigen Kleinserienfertigung etabliert haben, ist ein grundlegendes Anliegen dieses Buches, Aufschlüsse über die Ursachen der betriebswirtschaftlichen Problematik und finanziellen Krisen der Automobilunternehmen zu bekommen.
Weitere Ziele sind, Erfolgsfaktoren des Nischenmarketings herauszukristallisieren und denkbare zukünftige Entwicklungen dieses Marktsegmentes darzustellen. Verschiedene Aspekte des Marketings und die Bedeutung sowie Effizienz von Digitalem Marketing finden dabei besondere Berücksichtigung. Der Erkenntnisgewinn aus den genannten Schwerpunkten ermöglicht die Entwicklung von Handlungsempfehlungen, die als Impulsgeber helfen können, als Automobilmarke in einer speziellen Nische, insbesondere betriebswirtschaftlich und markentechnisch, erfolgreich zu sein.
Für die Fragestellungen wurde ein exploratives Vorgehen mit qualitativen Experteninterviews gewählt. Aus der beschriebenen Zielsetzung leiten sich die folgenden Fragestellungen ab:
Abbildung 1. Fragestellungen (eigene Darstellung), 2017.
2 Markt und Marketing
In diesem Kapitel wird zum Einstieg ein kurzer Überblick über das Begriffsverständnis der automobilen Klein- und Kleinstserienhersteller gegeben und eine Definitionsgrundlage für diese Untersuchung festgelegt (Kapitel 2.1). Im nächsten Schritt wird eine kurze Charakterisierung des automobilen Nischenmarktes vorgenommen (Kapitel 2.2). Anschließend werden die acht ausgewählten Automobilunternehmen für das weitere Verständnis dieser Arbeit mit ihrer Unternehmenshistorie vorgestellt (Kapitel 2.3). Im Anschluss werden die aktuellen Herausforderungen der Automobilbranche dargestellt, um das dynamische und komplexe Branchenumfeld der Klein- und Kleinstserienhersteller zu verdeutlichen (Kapitel 2.4). Um die Spezialisierung und Schwerpunktlegung einiger Klein- und Kleinstserienhersteller in einer bestimmten Nische nachvollziehen zu können, werden im Kapitel 2.5 die aktuellen Technologie- und Mobilitätstrends der Automobilindustrie aufgezeigt. Im letzten Teil des 2. Kapitels werden die für diese Arbeit wichtigen Grundlagen des strategischen Marketings (Kapitel 2.6) skizziert. Dabei finden das Dialogmarketing, Customer-Relationship-Management und einzelne Instrumente des Digitalen Marketings besondere Berücksichtigung.
2.1 Begriffsverständnis der automobilen Klein- und Kleinstserienhersteller
Sowohl Groß-, Mittel- oder Kleinserien benutzen den Produktionstyp der Serienfertigung. Je nach Seriengröße lassen sich beispielsweise Automobilunternehmen den drei Begrifflichkeiten zuordnen. Allgemein werden derartige Automobilhersteller als Kleinserienhersteller bezeichnet, die Autos nur in geringer Stückzahl herstellen und deren Absatz um ein Vielfaches kleiner ist als der Absatz der Großserienhersteller (Adam, 1998). Unternehmen, die Fahrzeuge in Klein- oder Kleinstserie bauen, gleichen meist einer Manufaktur und scheinen oft im Übergangsstadium von der Handarbeit zur halbindustriellen Produktion zu stehen. Dabei geht es bewusst nicht um die Fertigung großer Mengen und gleichartiger Produkte, sondern um die Spezialisierung und Individualisierung. Für die Abgrenzung durch die genaue Seriengröße gibt es bislang keine einheitliche Definition. Nochmals von der Kleinserie abzugrenzen, ist die Kleinstserie, die oftmals auch als Einzelanfertigung bezeichnet werden kann. Die Abgrenzung zur Mittel- und Großserie ist weitaus schwieriger. Hier kann keine allgemeingültige Stückzahl festgelegt werden, vielmehr sollte nach branchenüblichen Maßstäben differenziert werden.
Für die verwaltungsrechtliche Anerkennung durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) wird nicht zwischen Kleinserienhersteller und Großserienhersteller unterschieden. Laut dem KBA erfolgt die Genehmigungserteilung für Kleinserienfahrzeuge, sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene nach der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG (insbesondere Artikel 22 und 23). Demnach ist die Zahl der Einheiten eines Fahrzeugtyps, die in der EU zugelassen wird, in der Fahrzeugklasse M1 auf 1.000 Einheiten jährlich begrenzt. Für nationale Kleinserien (NKS) gelten geringere Stückzahlen, je nach Mitgliedsstaat. Für die Kleinserienfahrzeuge gelten grundsätzlich erleichterte Bedingungen in der Durchführung von Aufprallprüfungen, wie Frontal- und Seitencrash (KBA, 2016).
Für diese Untersuchung wird unter Berücksichtigung der selektierten Automobilunternehmen eine produzierte Stückzahl pro Jahr von mindestens fünf bis maximal 2.000 Autos zu Grunde gelegt, um für das Begriffsverständnis der automobilen Kleinserienhersteller eine Orientierung zu geben. Unternehmen mit Stückzahlen von maximal fünf Autos pro Jahr werden für diese Untersuchung als Kleinstserienhersteller definiert. Die Daimler AG konnte beispielsweise im Jahr 2015 rund 2 Millionen Fahrzeuge (Mercedes-Benz und Smart) verkaufen (Daimler, 2015). Durch den Vergleich der betrachteten Stückzahl sollte die definitorische Abgrenzung der Kleinserie zur Mittel- und Großserie deutlich werden.
2.2 Marktsegment der Klein- und Kleinstserienhersteller
Nach Michael E. Porters Konzept der strategischen Hauptrichtung gibt es drei grundlegende Strategie-Typen, um sich als Unternehmen klar am relevanten Markt zu positionieren. Neben der Kostenführerschaft und der Differenzierungsstrategie kann sich ein Unternehmen mit einer Nischenstrategie (Fokussierung) durch seine Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen auf bestimmte Kunden- und Produktgruppen, Segmente oder Märkte konzentrieren (Porter, 1998). Die betrachteten Klein- und Kleinstserienhersteller bedienen mit ihren hochemotionalen Produkten jeweils einen Nischenmarkt, wo Exklusivität und Individualität für die Zielgruppe eine große Rolle spielen. Die Exklusivität der Hersteller ist durch den minimalen Marktanteil am gesamten automobilen Weltmarkt gesichert. Der Erwerb eines Kleinserienfahrzeuges verkörpert oftmals auch die Lebenseinstellung der Kundschaft. Die Käufer möchten ein Auto, welches nicht „von der Stange kommt“, sondern weitgehend in akribischer Handarbeit gebaut wird. Das betont die eigene Unabhängigkeit und Individualität. Im Vergleich zur Massenfertigung mit großen Mengen eines Produktes haben Klein- und
Kleinstserienhersteller in der Regel sehr hohe Stückkosten, wodurch sich viele der Hersteller im Hochpreissegment und damit im Luxussegment positionieren. Damit wird der potentielle Käuferkreis bereits eingeengt (Schurig, 2013). Dieser wird im Abschnitt 4.1.4 thematisiert. Auf der anderen Seite können sich die Nischenanbieter mit einem hochspezialisierten Team auf die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen konzentrieren und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren.
Dabei ist es aufgrund der Individualität, Einzigartigkeit, Unternehmensgröße und unterschiedlichen strategischen Ausrichtung der Hersteller nicht möglich, einen bestimmten Nischenmarkt für alle Hersteller zu definieren. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen und Ansätze von einem Automobil fallen auch die jeweiligen Produkte unterschiedlich aus. Daraus resultiert eine natürliche Diversifikation. So bedienen beispielsweise der italienische Kleinserienhersteller Pagani oder der schwedische Kleinserienhersteller Koenigsegg mit rennstreckentauglichen „Hypersportwagen“ ein anderes Nischensegment als der deutsche Kleinserienhersteller Wiesmann. Trotz der unterschiedlichen Ausgestaltung des Nischen-Marktsegmentes sollen die für den Marktsektor der Kleinserienhersteller dominierenden Erfolgsfaktoren, Risiken und Perspektiven im weiteren Verlauf der einzelnen Betrachtungen erarbeitet werden.
Bei der allgemeinen Betrachtung des Marktsegmentes der Klein- und Kleinstserienhersteller lassen sich zwei Bereiche unterscheiden. Die Unternehmen, die im Konzernverbund agieren und die Unternehmen, die sich als unabhängige Hersteller in dem Nischenmarkt bewegen. Bei den kleinen unabhängigen Unternehmen können noch Unterscheidungen hinsichtlich der Unternehmensgröße gemacht werden (Schurig, 2013). In der folgenden Abbildung sind beispielhaft drei Automobilunternehmen aufgeführt, die in Kleinserie produzieren, aber in einem großen Konzernverbund agieren:
Abbildung 2. Unternehmen in der Konzernstruktur (eigene Darstellung nach Ferrari, 2017; VW, 2015).
Für diese Untersuchung sind die drei dargestellten Hersteller aufgrund des Konzernverbundes und der damit verbundenen Synergieeffekte und möglichen Kompensation von negativen betriebswirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb des Konzerns nicht repräsentativ und daher auch kein weiterer Bestandteil dieses Buchs.
2.3 Die selektierten Kleinserienhersteller im Profil
In diesem Kapitel werden die acht Unternehmen vorgestellt, die in dieser Untersuchung beispielhaft für den Nischenmarkt der Klein- und Kleinstserienhersteller betrachtet werden. Als Titel wurde in der jeweiligen Kurzvorstellung für diese Untersuchung aus Gründen der Aktualität der aktuelle Name bzw. die Markenbezeichnung gewählt, da sich einige der Unternehmen während ihrer Unternehmensgeschichte mehrfach umfirmiert haben. Da die Automobilbranche schnelllebig und dynamisch ist. wurde aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Praktikabilität eine zeitliche Befristung für die inhaltliche Literaturrecherche zu den Automobilunternehmen gesetzt.
2.3.1 Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG
Der deutsche Fahrzeughersteller Alpina (Eigenschreibweise: ALPINA) wurde 1965 von Burkard Bovensiepen (*1936) gegründet. Im Jahr 1962 erkannte der junge Maschinenbau- und Betriebswirtschafts-Student Bovensiepen für den damals vorgestellten BMW 1500 mit 80 PS das Potential einer möglichen Leistungssteigerung. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Motorenbau von Eugen W. Huber in München entwickelte er in der väterlichen Alpina-Büromaschinenfabrik eine Weber-Doppelvergaseranlage für den BMW 1500, die eine Leistung von 90 PS ermöglichte. Die qualitativ hochwertigen Alpina Motoren mit Doppelvergaseranlagen wurden gut verkauft und fanden Anerkennung bei der Fachpresse und Öffentlichkeit, sodass BMW mit dem damaligen Verkaufschef Paul G. Hahnemann den Alpina-Modellen die volle Werksgarantie gewährte. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kooperation mit der BMW AG ist auch heute noch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Alpina (Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016; Günther, 2015).
Abbildung 3. Kurzprofil Alpina (eigene Darstellung nach Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016).
1965 wird die Alpina Burkard Bovensiepen KG mit acht Mitarbeitern gegründet. Das ursprüngliche Firmenlogo beinhaltete die Ansaugtrichter und eine Kurbelwelle jener Doppelvergaseranlage. Alpina entwickelte in Folge für die neuen BMW-Modelle ein breites Spektrum an sportlichem Zubehör, Tuningaktivitäten und entwickelte weiterhin Benzin-Motoren, die zugleich sparsam und leistungsstark waren. Ab 1968 nahm Alpina auch am Tourenwagen-Rennsport teil und konnte viele Siege im Europapokal und bei vielen Meisterschaften feiern. Alpina fungierte praktisch als externe Motorsportabteilung für BMW. Neben den Motorsportaktivitäten begann parallel mit BMW der Aufbau eines deutschen Händlernetzes, um die Alpina-Modelle auf die Straße zu bringen. 1977 zog sich Alpina vorläufig vom Motorsport zurück. 1978 präsentierte Alpina drei komplette Eigenentwicklungen mit einer vollelektronischen Computerzündung, den BMW Alpina B6, den Alpina B7-Turbo Coupé und den BMW Alpina B7-Turbo, der mit 300 PS zu dieser Zeit die schnellste Limousine der Welt war. 1983 wird Alpina offiziell vom KBA als Automobilhersteller anerkannt. 1988 zog sich Alpina aus dem Rennsport zurück und fokussierte sich auf die Entwicklung und Produktion von neuen Alpina Straßenfahrzeugen. Dabei gab es im Vergleich zu den Anfängen auch neue Produktionsabläufe. Im Rahmen einer Zug-um-Zug Integration werden die Alpina Komponenten, wie Kolben und Kühler, Instrumente oder Felgen, in täglichen Logistiktransporten direkt in die BMW-Werke geliefert und dort montiert, sodass rund 75 -80 % eines Alpina-Fahrzeuges im BMW-Werk gebaut werden. Anschließend erfolgt in der Alpina Manufaktur die Umsetzung der exklusiven Kundenwünsche. Dazu gehören beispielsweise der Anbau von Aerodynamikteilen, die Abgasanlage oder die Gestaltung eines individuellen Interieurs mit hochwertigem Lavalina-Leder und Sonderanfertigungen, die jeden Alpina zu einem Unikat machen. Insbesondere für eine individuell gestaltete Lederausstattung investiert Alpina in Summe viele Arbeitsstunden, um den hohen Ansprüchen der Zielgruppe gerecht zu werden (Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016; Bovensiepen, 2016; Günther, 2015).
© Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG; Quelle: A. Bovensiepen
In den folgenden Jahren expandierte Alpina immer weiter. 1990 hat Alpina bereits 120 Mitarbeiter, das Firmengelände in Buchloe wird mit einem Neubau für Verwaltung und Produktion ausgebaut. Es folgten eigene technische Entwicklungen, wie das elektronische Kupplungsmanagement „Switch-Tronic“ oder der elektrisch beheizte Metallkatalysator „E-Kat“. 1999 entwickelte Alpina in Zusammenarbeit mit BMW den ersten Dieselmotor für Alpina-Fahrzeuge. Im Jahr 2008 vollzieht Alpina die größte Expansion seit der Firmengründung: Der Neubau eines Versuchs-, Ingenieur-, und Entwicklungszentrums, um der steigenden Nachfrage nach Alpina-Modellen durch eine schnellere Produktentwicklung gerecht zu werden. 2009 engagiert sich Alpina erneut im Motorsport und gewinnt 2011 die deutsche GT-Serie mit dem BMW Alpina B6 GT3 Evo (Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016; Günther, 2015).
© Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG; Quelle: A. Bovensiepen
Die Vermarktung der BMW Alpina-Modelle, die Sportlichkeit und eine hohe Reise- und Alltagstauglichkeit verbinden, erfolgt über ausgewählte BMW-Händler. Im Jahr 2014 konnte Alpina mit gut 200 Mitarbeitern rund 1.700 Fahrzeuge verkaufen und damit einen Umsatz von rund 95,5 Millionen Euro erzielen. Die wichtigsten Absatzmärkte bilden heute Deutschland, Europa, USA und Japan. 2015 feierte Alpina das 50-jährige Firmenjubiläum. Zusammen mit seinen beiden Söhnen Florian und Andreas leitet Burkard Bovensiepen heute das Familienunternehmen, das von betriebswirtschaftlichen Krisen in der Vergangenheit weitgehend unbeeindruckt blieb und auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken kann (Alpina Burkard
Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016; Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2014; Günther, 2015).
Die folgende Abbildung zeigt die aktuellen Alpina-Modelle:
Abbildung 4. Modellübersicht Alpina (eigene Darstellung nach Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016).
Neben der Automobilentwicklung und Produktion ist das zweite Standbein des Familienunternehmens der Weinhandel. Burkard Bovensiepen entdeckte auf vielen seiner Reisen die Liebe zum Wein und gründete 1979 mit dem Weinimport einen weiteren Geschäftszweig von Alpina. Als Weinimporteur und -distributor handelt Alpina heute mit exklusiven Weinen aus Frankreich, Italien, Kalifornien und Deutschland (Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2016; Bovensiepen, 2016).
Laut Andreas Bovensiepen (2016) macht der Weinhandel rund 12 % des Gesamtumsatzes aus mit einem Anteil in 2014 von rund 11,3 Millionen Euro (Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG, 2014).
2.3.2 Bitter Automotive GmbH
Erich Bitter gründete im Jahre 1971 die Bitter GmbH & Co. KG. Die Gründung seines Unternehmens ist stark von der Person und dem Charakter des Erich Bitter geprägt. Der Unternehmer und Automobil-Designer wurde 1933 in Schwelm geboren. Die Familie und Eltern besaßen Geschäfte, in denen Fahrräder, Kinderwagen und Nähmaschinen verkauft wurden. Doch für den jungen Bitter stellten die familiären Geschäfte nicht die berufliche Perspektive dar. Nach anfänglichen Radsporterlebnissen im Profibereich wechselte Bitter aus gesundheitlichen Gründen in den Motorsport. Seine Rennsport-Karriere war von beachtlichen Erfolgen geprägt. Er ließ sich jedoch von keinem Rennstall fest anstellen, sondern blieb immer unabhängig. Nebenher verdiente er Geld mit dem Verkauf von Autos und Rennzubehör. Bitter fokussierte als Autohändler die Marken NSU, Abarth, Volvo, Jaguar, Saab und verdiente sich mit der seinerzeitigen Firma Rallye Bitter als Importeur von Rennfahrerschutzkleidung seinen Ruf. Unter anderem entwickelte er den ersten feuerfesten Rennanzug (Göbel und Keiss, 2013).
Abbildung 5. Kurzprofil Bitter (eigene Darstellung nach Bitter Automotive GmbH 2016; Busse, 2014).
Aufgrund eines schweren Unfalls auf dem Nürburgring mit einem Abarth 1300 SP, der in Brand geriet, beendete Bitter im Jahre 1969 seine Karriere im Rennsport. 1971 folgte mit der Gründung der Bitter GmbH & Co. KG (seit 2010: Bitter Automotive GmbH) in Ennepetal die Erfüllung seines Lebenstraums. Im Jahr 1972 konnte Bitter mit General Motors (USA) einen Vertrag schließen, der Bitter die Möglichkeit gab, als anerkannter Aufbauhersteller für Opel-Fahrzeuge tätig zu sein. Dieser einmalige Vertrag existiert bis heute. Zudem ermöglicht der Vertrag Bitter die Opel-Unterstützung und Hilfestellung in relevanten Bereichen wie Crash-Test, Zulassungsbestimmungen, Vertrieb und Teilebeschaffung. Das Projekt wurde von Opel unterstützt, um den eigenen Opel-Autos mehr Prestige zu verschaffen. Zudem pflegte Bitter immer gute Verbindungen in die Führungsetage von GM und Opel. Der bis heute legendäre Bitter CD wurde zusammen mit der Karosseriefabrik Baur und dem Automobil-Hersteller Opel entwickelt. 395 Stück wurden davon gebaut. Erstmals wurde der Bitter CD auf der IAA 1973 der Öffentlichkeit präsentiert. Die Nachfrage war trotz des damals hohen Kaufpreises von 60.000 D-Mark mit 200 Bestellungen sehr hoch. Auch Fußball-Weltmeister Paul Breitner fand daran Gefallen und zählte zu den Käufern. Der Bitter CD repräsentierte italienisches Design mit solider Serientechnik von Opel beziehungsweise General Motors (Bitter, 2016; Busse, 2014; Göbel und Keiss, 2013; Münder, 2014). Das gab es schon einmal in der Automobilgeschichte bei der Zusammenarbeit von Italienern und Deutschen beim legendären Karmann Ghia.
© BITTER Automotive GmbH, Foto: Lutz Keiss; Quelle: Erich Bitter
Nach Gründung der Firma und Vorstellung des Bitter CD folgten weitere Modelle und exklusive Konzepte aus dem Hause Bitter auf der Basis von Serienmodellen des Herstellers General Motors. Von 1987 bis 1997 betrieb er zudem parallel in Santa Monica (USA) zusammen mit einem Geschäftsfreund die „Bitter Automobile Company“ (Göbel und Keiss, 2013).
© BITTER Automotive GmbH, Foto: Lutz Keiss; Quelle: Erich Bitter (Bitter Rallye GT)
Abbildung 6. Modellübersicht Bitter (eigene Darstellung nach Bitter Automotive GmbH, 2016; Busse, 2014; Göbel und Keiss, 2013; Münder, 2014).
Bitter entwickelte zusammen mit dem befreundeten GM-Manager Bob Lutz Pläne für Tochterfirmen in der Schweiz und in den USA, um sich langfristig im internationalen Geschäft zu etablieren. Bitter plante 1996 die Gründung einer Aktiengesellschaft mit einer Listung an der Nasdaq in Amerika. Nach der offiziellen Listung und Handelsfreigabe an der Börse musste Bitter eine böse finanzielle Schieflage einstecken, da ein Finanzbetrüger mit einer Firma in Düsseldorf die Bitter-Aktien kopierte und an Investoren weiterverkaufte. Nachdem der Betrug aufflog und der Beschuldigte eine Gefängnisstrafe erhielt, wurde der Handel mit den Bitter-Aktien durch die SEC eingestellt. Für ein Drittel der Bitter-Firma hätte Herr Bitter ca. 14 Millionen Dollar einsammeln können. Bitter gelang es jedoch mit einem Team, durch Entwicklungs- und
Forschungsaufträge für den Volkswagen-Konzern, seiner Firma eine stabile Ertragsquelle zu sichern. Er blieb insgesamt neun Jahre bei VW. Bitter konzentrierte sich in den folgenden Jahren auf die Entwicklung weiterer Prototypen und Konzepte wie dem Bitter CD 2 in 2003 (Bitter, 2016; Busse, 2013; Busse, 2014; Münder, 2014).
Es folgten noch weitere Konzepte und Serienmodelle, wie die Abbildung 6 zeigt. Unter anderem der Bitter Insignia als V6 mit 260 PS (Maltzan, 2010). Schätzungen zu Folge wurden bis heute insgesamt ca. 1.000 Bitter-Fahrzeuge produziert. Viele werden heute noch von Fans gefahren und gepflegt. Die Automobile haben Kultstatus. Jährlich treffen sich die Besitzer eines Bitter zum „Bitter-Treffen“ (Busse, 2013; Busse, 2014; Münder, 2014).
© BITTER Automotive GmbH, Foto: Lutz Keiss; Quelle: Erich Bitter
Die aktuellen Bitter-Modelle sind der Bitter-Adam und der Bitter-Mokka. Die Basismodelle werden direkt von Opel eingekauft und dann im Exterieur mit einigen Umbauten, wie einem neuem Frontspoiler, Kühlergrill und Veredelungen im Innenraum mit verschiedenen hochwertigen Ledervarianten, zu den Bitter-Editionen aufgewertet (Bitter, 2016).
© BITTER Automotive GmbH, Foto: Lutz Keiss; Quelle: Erich Bitter
Zudem gibt es einen Beratungsvertrag mit der Firma e.GO in Aachen, die auf dem RWTH Aachen-Campus ein besonders günstiges Elektrofahrzeug mit verschiedenen Partnern entwickelt. Erich Bitter kann hierbei auf sein Netzwerk bei Opel und GM zurückgreifen. Laut Bitter (2016) ist eine Dreiecks-Beziehung Bitter-e.Go-Opel geplant. Herr Bitter fungiert als indirekter Berater für das noch unbekannte Projekt.
2.3.3 Classic Motors Design GmbH
Das Unternehmen Classic Motors Design GmbH, kurz auch CMD, das 1985 gegründet wurde, ist eng mit der Person Michael Fröhlich verbunden. Herr Fröhlich wurde 1950 in Berlin geboren und zog später nach Düsseldorf. Um sein Studium der Rechtswissenschaften zu finanzieren, verschrieb sich Herr Fröhlich der Modebranche und gründete als Modedesigner eine eigene Mode-Firma, mit der er damals als junger Mann viel Geld verdiente. Da Michael Fröhlich schon von klein auf autobegeistert war, leistet er sich teure Autos, wie einen Ferrari und Jaguar. Sein Lieblingsauto damals war ein Jaguar E-Type. Er beschäftigte sich intensiv mit historischen Fahrzeugen aus dem Rennsport, die er auch selber umkonstruierte, da er nebenbei hobbymäßig auch Rennen fuhr und im Jahr 1985 den Grand Prix am Nürburgring gewann (Dütsch und Fröhlich, 1990; Fröhlich, 2016).
Er erweiterte seine berufliche Tätigkeit zum Autodesigner und gründete das Unternehmen Classic Motors Design GmbH.
Abbildung 7. Kurzprofil Fröhlich (eigene Darstellung nach Dütsch und Fröhlich, 1990; Fröhlich, 2016).
Er hatte sich zuvor von seinem Vorbild Carroll Shelby in Amerika inspirieren lassen. Shelby war ein amerikanischer Rennfahrer und Sportwagenkonstrukteur, der in Kleinserie die legendären Shelby AC Cobras herstellte, mit denen viele Rennen gewonnen wurden. Fröhlich entwickelte die Idee, den Shelby-Cobra auf deutsche Art und Weise zu bauen, unter anderem mit einer wesentlich breiteren Karosserie. Dafür entwickelte Fröhlich unter anderem ein eigenes Fahrgestell als Leiterrahmen. Den ersten selbst konstruierten Prototypen, der in einer Doppelgarage entstanden ist, präsentierte Fröhlich auf der Jochen-Rindt-Show, dem Grundstein der heutigen Motorshow in Essen. Dort wurde Ford Motorsport auf den Prototypen aufmerksam und bot Herrn Fröhlich eine Zusammenarbeit an. Die Phoenix Cobra war geboren: Mit einem Budget von einer Million Mark baute Fröhlich in seiner Manufaktur zu Beginn zehn Phoenix Cobras mit V8 Ford-Motoren, die auch vom TÜV erfolgreich getestet wurden. Ford kümmerte sich anschließend um den Verkauf, der sehr erfolgreich war. Auch Keke Rosberg erwarb einen Phoenix Cobra. Insgesamt wurden 123 Stück gebaut, da Herr Fröhlich immer nur eine Kleinserie bauen wollte. Herr Fröhlich erwarb sich mit der Produktion der Cobras in der Automobilbranche einen sehr guten Ruf, sodass viele Autoliebhaber auf ihn aufmerksam wurden, die Fröhlich zu vielen weiteren Autoprojekten und Auftragsarbeiten inspirierte. Als hauptberufliche Tätigkeit gründete er mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen dann eine Herstellungs- und Restaurierungsfirma mit Fahrzeugverkauf für außergewöhnliche Fahrzeuge in Düsseldorf, die er in einem neuen Standort in Mettmann auch heute noch leitet. Viele seiner Projekte sorgten auch immer wieder in den Medien für Schlagzeilen, wie beispielsweise ein Panzer mit Straßenzulassung, der Verkauf von Hitlers Mercedes 770 K oder der Jagdwagen aus dem marokkanischen Königshaus (Dütsch und Fröhlich, 1990; Fröhlich, 2016; Zips, 2010).
©Michael Fröhlich; Quelle: Michael Fröhlich (Phoenix Cobra)
Im Jahr 2012 präsentierte Fröhlich in Berlin ein weiteres Kleinstserienprojekt in Zusammenarbeit mit der Regensburger Firma PG, die exklusive und hochpreisige High-Tech-Bikes und E-Bikes produzieren. PG Elektrus heißt der Zweisitzer, mit Elektromotoren bis zu 270 PS und 350 Nm Drehmoment auf Basis des Lotus Elise. Die Karosserie ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Für die Exklusivität muss der Käufer ca. 250.000 Euro bezahlen, bisher wurden vier Stück gefertigt, den Prototypen fährt Herr Fröhlich selber. Auch der Hollywoodstar Brad Pitt hat ein Exemplar des PG Elektrus bestellt (Fröhlich, 2016; Rose, 2012). Laut Herrn Fröhlich (2016) ist der Elektrus Deutschlands schnellster Elektrosportwagen.
©Michael Fröhlich; Quelle: Michael Fröhlich
2.3.4 Donkervoort Automobielen B.V. (NL)
Die Erfolgsgeschichte des holländischen Automobilherstellers Donkervoort beginnt im Jahr 1978, als der Niederländer Joop Donkervoort das Unternehmen gründete. Die Idee für den ersten Donkervoort, den S7, entwickelte Joop Donkervoort auf Basis eines Bausatzautos, das er von einem niederländischen Importeur bezog. Donkervoort konnte jedoch keine Typenzulassung für dieses Auto erlangen und durfte damit nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Eine Auflage für eine mögliche Zulassung waren unter anderem notwendige Änderungen am Fahrgestell. Daraufhin gründete Donkervoort seine eigene Sportwagenmarke (Donkervoort Automobielen B.V., 2016).
Abbildung 8. Kurzprofil Donkervoort (eigene Darstellung nach Donkervoort, 2016; Donkervoort Automobielen B.V., 2016).
Die ersten eigenen Donkervoort-Modelle basierten auf einer Ableitung des Lotus Seven, daher die Bezeichnung „S“ in den folgenden Modellnamen. Das erste Donkervoort-Modell, der Donkervoort S7, wurde mit einem 1,6 Liter-Ford-Motor gebaut und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h, was für die damalige Zeit eine Sensation war. Der Donkervoort S8 Super Eight war das Nachfolgermodell des S7. Der S8 wurde technisch verbessert, hatte einen leistungsstärkeren 2-Liter-Motor mit 110 PS und war vor allem moderner. Gleichzeitig distanzierte sich Donkervoort mit dem S8 offiziell von den anfänglichen Bausätzen. In den ersten Jahren der Firmengründung konnten insgesamt ca. 140 S7- und S8-Modelle verkauft werden. Produziert wurden diese in einer kleinen Werkstatt in Tienhoven. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, zog Donkervoort 1983 in eine größere Fabrik im niederländischen Loosdrecht, wo die beiden Folgemodelle S8A und S8AT mit einem komplett neuen Fahrgestell und elektronischer Einspritzung entwickelt wurden. 1988 wurde auf dem Pariser-Auto-Salon der Donkervoort D10 vorgestellt mit einer limitierten Ausgabe von zehn Exemplaren. Mit dem D10 vollzog Donkervoort durch den Wegfall des „S“ in der Modellbezeichnung einen Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte. In den folgenden Jahren wurden mit dem D8 Zetec und D8 Cosworth weitere Donkervoort-Modelle entwickelt, die bereits mit Carbon-Komponenten ausgerüstet wurden (Donkervoort Automobielen B.V., 2016).
©Donkervoort Automobielen B.V.; Quelle: Donkervoort (D10)
Donkervoort engagierte sich auch im Rennsport. So wurde in den Jahren 1993 bis 2001 regelmäßig der Donkervoort-Cup ausgetragen, eine Rennklasse für begeisterte Donkervoort-Besitzer mit Rennen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und anderen Ländern. Im Jahr 1999 beginnt auf der Suche nach einem neuen Motorenlieferanten die Kooperation mit der Audi AG, unterstützt durch den damaligen Audi-Manager Franz Josef Paefgen. Bis heute besteht die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Audi. Neben dem Motor als Antrieb bezieht Donkervoort auch weitere Teile wie beispielsweise das Radlager von Audi. Mit dem technischen Knowhow und der Unterstützung von Audi wurde 1999 der D8 Audi entwickelt, der zu den leistungsstärksten Donkervoort-Modellen zählte und die Audi-Kooperation festigte (Donkervoort, 2016; Donkervoort Automobielen B.V., 2016).
©Donkervoort Automobielen B.V.; Quelle: Donkervoort (D8 Audi)
Die guten Verkaufsergebnisse und die anhaltende hohe Nachfrage ermöglichten Donkervoort weiter zu wachsen, sodass im Jahr 2000 in Lelystad ein neues Firmengebäude mit einer jährlichen Produktionskapazität von 100 Fahrzeugen gebaut und bezogen wurde. Zug-um-Zug wurden ausgelagerte Fertigungsarbeiten von Lieferanten in das eigene Werk verlegt, um den eigenen Qualitätsansprüchen und der Firmenphilosophie des perfekten, ultimativen und agilen Sportwagens in Leichtbauweise für Liebhaber gerecht zu werden. Es wurde beispielsweise ab dem Jahr 2003 das Fahrgestell der
Im Jahr 2012 gelang es Donkervoort, die Europäische Kleinserien-Typzulassung zu erhalten, die sogenannte ECSSTA. Damit wurde der Zugang zu Russland, zu den Golfstaaten und zu Osteuropa als neue Absatzmärkte ermöglicht. Heute ist Donkervoort neben dem Firmensitz in den Niederlanden mit eigenen Servicepunkten in Deutschland (Bilster Berg und Classic Remise Düsseldorf), Frankreich, Belgien und der Schweiz vertreten, die sich um die Wartung, Reparatur, Ersatzteilbesorgung und Ausstellung von Echtheitszertifikaten kümmern. Bis heute wurden seit der Firmengründung ca. 1.270 Donkervoort-Fahrzeuge produziert. Donkervoort beschäftigt aktuell ca. 30 Mitarbeiter und fertigt pro Monat zwei Autos vom aktuellen Modell D8 GTO für je rund 180.000 Euro. Da aktuell eine Lieferzeit von eineinhalb Jahren besteht, soll die Produktion auf vier Autos monatlich aufgestockt werden, um die Lieferzeit auf ein halbes Jahr zu verkürzen. Zusammen mit seinem Sohn Denis und seiner Tochter Amber leitet Joop Donkervoort heute das Familienunternehmen, das von betriebswirtschaftlichen Krisen in der Vergangenheit weitgehend unbeeindruckt blieb und auf eine erfolgreiche und solide Unternehmensgeschichte zurückblicken kann (Donkervoort, 2016; Donkervoort Automobielen B.V., 2016; Hommen, 2016).
©Donkervoort Automobielen B.V.; Quelle: Donkervoort (D8)





























