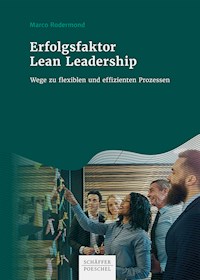
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein Unternehmen nach bewährten Lean-Prinzipien auszurichten, bedeutet agilere, schnellere und deutlich günstigere Prozesse im täglich schärfer werdenden Wettbewerb zu schaffen. Lean-Projekte funktionieren jedoch nur, wenn man Mitarbeiter in den gesamten Lean-Prozess mit einbezieht, sie motiviert, coacht und zur Eigenverantwortung befähigt. In allen Lean-Projekten ist Führung der entscheidende Faktor. Der Autor zeigt, wie Führungskräfte Leadership-Qualitäten entwickeln, so dass Lean-Projekte überdurchschnittlich erfolgreich werden. Dabei wird deutlich: Lean Leadership hat viele Parallelen zu agiler Führung. Unternehmen, die gelernt haben, nach Lean-Kriterien zu führen, tun sich auch leichter digitale Führungsformen wie agiles Projektmanagement einzuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortEinführung: Am Limit oder schon darüber?Teil A: Lean-Management – der Weg zum fließenden Wertstrom1 Ressourceneffizienz versus Flusseffizienz1.1 Warum Lean unentbehrlich ist1.2 Wie die beiden Arten von Effizienz sich auswirken1.3 Verschwendung blockiert den Fluss1.4 Machen Sie sich auf die Socken!2 Die Kraft der Veränderung – wie Change gelingen kann2.1 Das Besser-Modell – der Weg zu Lean-Leadership2.2 Management ohne Leadership funktioniert nicht2.3 Der lange Weg vom Denken zum Handeln3 Drei Stufen als Transmissionsriemen zwischen Geschäftszielen und Prozessen3.1 Die richtige Auswahl von Verbesserungsprojekten treffen3.2 Die Aufstellung der Gewinnkaskade3.3 Die Erarbeitung der Prozesslandkarte3.4 Zeitpotenziale und Nervthemen identifizieren3.5 Bessere Ergebnisse durch Kulturwandel – Interview mit Dr. Stefan Klatt 4 Fünf hilfreiche Regelkreise zur Lean-Umsetzung4.1 Die Optimierung der Kernprozesse4.2 Das PDCA-Prüfungs- und Abweichungsmanagement 4.3 Die Prozessbestätigung4.4 Führen am Ort des Geschehens4.5 Die Regelkommunikation5 »Viele Lean-Glücksmomente« – Wie Yellotools zum Marktführer wurde5.1 Mit Lean aus der Not heraus begonnen5.2 Der tägliche Start in den Arbeitstag5.3 Ein Rundgang durch den Betrieb5.4 Achtung, diese Firma ist gefährlich!5.5 Marktposition, Kunden und WettbewerbTeil B: Lean-Leadership – der Weg zu wachsender Wertschätzung6 Die Initialzündung: Ausbildung der Lean-Leader und Lean-Experten6.1 Führungskräfte und Mitarbeiter besser machen6.2 Zwei Ausbildungsschienen mit unterschiedlichem Schwerpunkt6.3 Die praktische Anwendung von Lean nach der Ausbildung7 Vom klassischen Führungsverständnis zur Lean-Führung7.1 Führungskultur im Wandel7.2 Das Lean-System erleichtert die Führung7.3 Vom Manager zum Lean-Leader – Interview mit Michael Kutzner 8 Der Aufbau der Leadership-Kompetenz8.1 Die Selbstentwicklung der Führungskraft8.2 Coachen und Befähigen der Mitarbeiter8.3 Kopf, Hand und Herz der Mitarbeiter gewinnen8.4 Schaffen einer Vision und Abstimmung der Ziele9 »Zum besten Problemlöser werden« – Wie Huppertz eine Krise überwand9.1 Vom regionalen Spediteur zum internationalen Supply-Chain-Dienstleister9.2 Der Turnaround mit Lean 9.3 Herausragender Problemlöser und Marktführer9.4 Entwicklung der Führungskräfte und MitarbeiterTeil C: Lean-Transformation – der Weg zur kontinuierlichen Wertschöpfung10 Die konsequente Leanifizierung des Unternehmens10.1 Die Bedeutung der Lean-Transformation10.2 Reifegrade in der Leanifizierung 10.3 Krisenstabil dank Lean 11 Der Zukunft gewachsen11.1 Lean und agil – zwei Welten im Vergleich11.2 Entscheidend sind die Führungskräfte – Interview mit Kristian Schweitzer11.3 Lean und die Digitalisierung – wie beides ineinandergreift LiteraturverzeichnisSachregisterDanksagung Über den AutorHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft - Steuern - Recht GmbH
[4]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-4953-3
Bestell-Nr. 10563-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-4954-0
Bestell-Nr. 10563-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-4955-7
Bestell-Nr. 10563-0150
Marco Rodermond
Erfolgsfaktor Lean Leadership
1. Auflage, Mai 2021
© 2021 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Bildnachweis (Cover): © FlamingoImages, gettyimages
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Dr. Sonja Ulrike Klug, Bad Honnef
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group
[5]Vorwort
Gelebtes Lean bringt Unternehmen nicht nur nachhaltige Verbesserungen und größere Wettbewerbsstärke, sondern es macht auch Spaß! Wir wissen, dass es so ist, denn in unseren Unternehmen setzen wir es mit Erfolg ein. Wer glaubt, Lean sei »ein alter Hut« oder »überholt«, weil es schon vor mehr als 20 Jahren in Westeuropa eingeführt wurde, hat es nie selbst praktiziert und seine Vorteile nicht wirklich kennengelernt. Oder er richtet seinen Blick nur auf die Lean-Werkzeuge in einem mehr oder weniger gelungenen Veränderungsprojekt, ohne den tieferen Sinn und den Bezug zur Führung zu verstehen.
In der Tat ist Lean – gerade im Kontext von wachsender Agilität und Digitalisierung – aktueller denn je, und zwar nicht nur als »Methoden-Baukasten«, sondern vor allem auch im Hinblick auf eine moderne, zeitgerechte Führung, die den heutigen Ansprüchen der Mitarbeiter an größere Mitwirkung gerecht wird und gerade dadurch zum Gelingen von Change-Prozessen maßgeblich beiträgt. In vielen Branchen wächst die Komplexität der Produktstrukturen und -varianten, der Informationsströme und Lieferketten. Das erfordert mehr denn je Organisationen, deren Führungskräfte und Mitarbeiter auf der Höhe der Zeit sind und bleiben, die professionell und strukturiert Veränderungen bewältigen.
Der Autor Marco Rodermond legt in seinen Trainings und Coachings zu Recht besonderen Wert auf die Führungskraft als zentralen Erfolgsfaktor. Im Lean als »geführten Prozess« bekommt sie eine neue Rolle und andere Aufgaben, als sie es in traditionell geführten Unternehmen hat.
Im Grunde geht es bei Lean darum, dass wir uns als Unternehmer oder Führungskräfte bewusst werden, was gerade in unserem Betrieb oder Wirkungsbereich geschieht und wie der Zustand tatsächlich ist. Wir lernen, Prozesse gründlich anzuschauen, ja regelrecht in sie hineinzufühlen, anstatt in den üblichen, aber nur kurzfristig wirksamen »Feuerlöschmodus« zu verfallen, in dem wir nur auf vorhandene Probleme reagieren, aber nicht vorausschauend handeln. Wenn wir die Prozesse verbessert, die Arbeitsschritte standardisiert und die Schnittstellen sauber definiert haben, sinkt der Stresslevel deutlich. Und dann entsteht Raum dafür, sich kreativ und gemeinsam Gedanken zu machen, wie es noch glatter, besser, einfacher, entspannter und effizienter gehen könnte. So setzt sich mithilfe von Lean ein positiver Kreislauf in Gang.
Dass Lean Freude macht, liegt nicht zuletzt an der Konsequenz im Vorgehen und an der Konzentration auf die Reduzierung der Durchlaufzeiten sowie den Kundennutzen. So eröffnen sich große, ungeahnte Potenziale, Unternehmen effizienter, stärker und resilienter zu machen. Das hat eine völlig andere Qualität, als sich von der sonst üblichen Budget- und Kostenstellenhörigkeit leiten zu lassen!
Den Autor Marco Rodermond haben wir als professionellen Lean-Fachmann kennengelernt, der seine Begeisterung für Lean und den Spaß am Optimieren auf die Geschäftsführung und [6]die Mitarbeiter übertrug. Lean »von der Stange« ist nicht sein Ding. Gemeinsam mit den Unternehmen, mit denen er arbeitet, findet er den individuell passenden Lean-Weg. Seit er unsere Führungskräfte zu Lean-Leadern ausgebildet und uns bei der Umsetzung in der kritischen Startphase als Coach begleitet hat, wirken wir in unserem mittelständischen Unternehmen anders. Wir sind gewachsen und deutlich krisenstabiler als manch andere Firma, die die Vorteile von Lean noch nicht kennt und nutzt.
Dieses Buch hilft »Neulingen«, in das Thema Lean aus Sicht der Führung einzutauchen. Gleichzeitig inspiriert es durch viele anschauliche Praxisbeispiele und Interviews mit »leanifizierten« Führungskräften und Unternehmern. Es lädt ein, die praxiserprobten Methoden direkt auszuprobieren. Lean-erfahrene Führungskräfte finden hier ebenfalls neue Ansätze und wertvolle Tipps, ihr eigenes Vorgehen auf den Prüfstand zu stellen und besser zu werden.
Dr. Anja HuppertzHans-Helmuth SchmidtHuppertz GroupCWS-Lackfabrik GmbH & Co. KG[9]Einführung: Am Limit oder schon darüber?
Stabilität ist in der sich so rasant verändernden Welt von heute fast zu einem Fremdwort geworden. Viele Unternehmen kommen dem Veränderungs- und Entwicklungsdruck sowie der ebenfalls zunehmenden Komplexität nur mit Mühe nach. Sie ringen mit steigenden Kosten, mit zumindest tendenziell sinkenden Gewinnen, erhöhtem Wettbewerbsdruck, dem Fachkräftemangel und nicht zuletzt mit den ungewohnten Anforderungen, die die jüngeren Mitarbeiter der Generation Y an ihre Arbeitgeber stellen. Zu den internen Anforderungen kommen zusätzlich völlig neue Situationen und Ansprüche von außen auf die Unternehmen zu, wie zum Beispiel »New Work«, Agilität und die Digitalisierung mit komplett neuen Technologien wie auch Geschäftsmodellen; von Wirtschaftskrisen wie der Corona-Pandemie mit ihren tiefen Einschnitten, die erst in den kommenden Jahren ihre volle Wirksamkeit entfalten werden, gar nicht zu reden.
So ist es nicht erstaunlich, dass viele Unternehmer und Führungskräfte heute das Gefühl haben, einen Großteil ihrer Arbeitszeit darauf zu verwenden, die an allen Ecken und Enden aufflackernden »Problem-Brandherde« durch permanente Troubleshooting-Aktionen zu löschen und dabei ihre eigentlichen Aufgaben zu vernachlässigen. Manchmal scheint es, dass »Feuerlöschaktionen« zur hohen Kunst des Managements geworden sind, denn nicht selten entstehen die Problemherde schneller, als sie beseitigt werden können. Oftmals entsteht der Eindruck, irgendwie immer mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Schritte hinter der notwendigen Entwicklung herzuhinken.
Ein Unternehmen zu führen scheint eine Herkules-Aufgabe geworden zu sein: Wie der griechische Sagenheld kämpft die Führungskraft heute mit einem seltsamen vielköpfigen Ungeheuer, das sofort zwei neue Feuer speiende Problemköpfe produziert, sobald sie ihm einen erfolgreich abgeschlagen hat. Viele kratzen durch das zeit- und nervenaufreibende Troubleshooting bereits am Limit – oder sind schon darüber. Wo bleiben die Konzentration und die Zeit, um ein Unternehmen mit ruhiger Hand zu steuern und die Weichen für die Zukunft zu stellen? Kommt sie jemals wieder? Liegt es an den turbulenten Zeiten – oder woran sonst? Kann Lean eine Lösung sein?
Seit fast drei Jahrzehnten befasse ich mich intensiv mit Lean und unterstütze Unternehmen wie auch Unternehmer und Führungskräfte dabei, Lean in ihrem Verantwortungsbereich erfolgreich einzuführen. Sie finden mit meiner Hilfe einen anderen, konstruktiveren Weg, das Unternehmen zu sehen und zu lenken als bisher – einen Weg, der das Troubleshooting zur Ausnahme macht, der den Stresslevel senkt, der Führungskräfte wie auch Mitarbeiter entlastet und Raum für Innovation schafft.
Das vielköpfige Ungeheuer, das so viele Probleme verursacht und dem Lean den Kampf angesagt hat, versteckt sich hinter einem unscheinbaren Namen – es heißt »Verschwendung«. Das [10]klingt zunächst eher harmlos und ist auch nicht gerade eine Kategorie, der die Betriebswirtschaftslehre besondere Bedeutung beimisst. »Verschwendung« – das ist doch einfach nur »ein bisschen Zuviel« von irgendetwas. Und das soll nun ein »Problemtreiber ersten Ranges« sein?
Doch der geübte Lean-Blick, den Sie zweifellos nach der Lektüre dieses Buches auch haben werden, zeigt, was das »Ungeheuer Verschwendung« in den Unternehmen anrichtet und welche Problemketten es erzeugt, wenn es sich erst einmal gemütlich »eingenistet« hat. Dazu gehören z. B. Sicherheitsbestände, Überproduktionen, Maschinenausfälle, unproduktive Wartezeiten, Schnittstellenprobleme, nicht eingehaltene Lieferzeiten, aufwendige Suche fehlender Informationen, teure Reklamationen, Nacharbeit, Ausschuss und auch die ungenutzte Kreativität der Mitarbeiter. Seinen sichtbarsten Ausdruck findet es in steigenden Kosten, die irgendwie – trotz zahlreicher Maßnahmen – nicht dauerhaft in den Griff zu bekommen sind und manchen Unternehmen derart davonlaufen, dass die Ergebnisse sich Jahr um Jahr verschlechtern und ein Wachstum kaum noch möglich scheint.
Alle diese Verschwendungen wachsen im Laufe der Zeit zu einer »explosiven Mischung« heran, der irgendwann nicht mehr beizukommen ist, wenn man nicht vorgeht wie der berühmte Herkules in der Sage: Er musste jeden Kopf des Ungeheuers ausbrennen, damit nicht wieder neue Köpfe nachwuchsen. Im Lean-Denken heißt das: Es gilt, die wahren Problemherde zu erkennen, zu identifizieren, auf der Basis einer ausgearbeiteten Methodik sauber zu analysieren und systematisch zu beseitigen. Klingt einfach und logisch, verlangt aber doch ein bisschen mehr als nur den gesunden Menschenverstand.
Ich will Ihnen nichts vormachen: Lean kann natürlich nicht alle Probleme im Unternehmen lösen, schon gar nicht auf der Basis eines einmalig durchgeführten Change-Projektes zur Verbesserung irgendwelcher Prozesse. Voraussetzung ist einerseits, konsequent und kontinuierlich »am Ball« zu bleiben und stetig besser zu werden, andererseits aber auch die Mitarbeiter richtig zu führen, denn Lean ist ein geführter Prozess. Lean wurde oftmals in der Vergangenheit als reiner »Methoden-Werkzeugkasten« wahrgenommen. Die Methodik ist zwar wichtig, doch Lean ist viel mehr. Wenn man die zugrunde liegenden Prinzipien versteht und beherzigt, wird es vor allem zu einer inneren Haltung, einem »Mindset«, das die Sichtweise auf Prozesse, die Art der Führung und den Umgang mit den Mitarbeitern wie auch das tägliche Handeln neu definiert.
Laufen erst einmal die Prozesse stabil und weitgehend verschwendungsfrei, so werden Sie feststellen, dass die Arbeit eine ganze andere, positivere Qualität gewinnt. Sie kommen aus dem Reagieren heraus und haben Zeit, proaktiv zu agieren und sich um die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens oder Verantwortungsbereiches zu kümmern, ohne von einem Problemfeuer zum nächsten zu hetzen. Denn sobald die Störfaktoren aus den Prozessen verschwunden sind, werden bei Mitarbeitern wie auch bei Führungskräften Energien freigesetzt – es fließt schneller, leichter und einfacher. Das Engagement der Belegschaft steigt ebenso wie Motivation, Freude und Begeisterung.
[11]Außerdem werden Sie feststellen, dass Lean im Zusammenhang mit der heute mehr und mehr Einzug haltenden Agilität und Digitalisierung an Bedeutung gewinnt und sich dazu eignet, für beides den Weg zu ebnen. Viele sogenannte »agile« Vorgehensweisen sind von Lean-Methoden abgeleitet.
Im Hinblick auf die umfangreiche Lean-Methodik gibt es bereits zahlreiche Standardwerke; sie ist auch Gegenstand der Ausbildung zum Lean-Experten oder -Leader. Deshalb gehe ich in meinem Buch nicht im Einzelnen auf das methodische Lean-Werkzeug ein, sondern vor allem auf den Leadership-Aspekt. Ich möchte zeigen, welchen Einfluss die Führung auf den Erfolg von Lean hat.
Im ersten Teil des Buches »Lean-Management« erfahren Sie, wie Sie den Fokus vom herkömmlichen Effizienzdenken auf die Flusseffizienz lenken und damit Ihr Unternehmen oder Ihren Verantwortungsbereich unter einem neuen Aspekt sehen. Sie erfahren unter anderem auch, wie Sie sinnvolle Lean-Projekte auf der operativen Ebene finden, also Projekte, die auf das Erreichen Ihrer Geschäftsziele einzahlen.
Im zweiten Teil »Lean-Leadership« steht die Führung im Mittelpunkt. Die Unternehmens- und Führungskultur wandelt sich, sobald ausgebildete Lean-Leader und -Experten ihre Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen. Sie erfahren, wie Sie Kopf, Hand und Herz der Mitarbeiter für das »Mitmachen« gewinnen, denn die Kompetenz für Verbesserungen liegt nun nicht mehr allein beim Management, sondern ganz wesentlich bei den Mitarbeitern vor Ort.
Der dritte Teil »Lean-Transformation« gibt Ihnen einen Einblick, wie Unternehmen dastehen, die über mehrere Jahre konsequent Lean gelebt haben. Sie haben nicht nur an Wettbewerbsstärke gewonnen, sondern sind auch gewachsen, manchmal zu Marktführern geworden – und nicht zuletzt sind sie krisenresistenter, wie sich in der Corona-Pandemie zeigte.
Daneben finden Sie im Buch in Form von Interviews eine Reihe von Praxisbeispielen von Unternehmern und Führungskräften, die über ihre persönlichen Erfahrungen mit Lean berichten, über ihre Probleme und Krisen, aber auch über ihre Erfolge und Perspektiven.
Lassen Sie sich »leanspirieren« und finden Sie heraus, wie Sie Lean für sich nutzen können!
Einen hohen Wirkungsgrad wünscht Ihnen Ihr
Marco Rodermond
[13]Teil A: Lean-Management – der Weg zum fließenden Wertstrom
[15]1Ressourceneffizienz versus Flusseffizienz
KAPITEL-ABSTRACT
In diesem Kapitel lernen Sie zwei grundverschiedene Ansätze von Effizienz kennen. Während die üblicherweise angewandte Ressourceneffizienz im Laufe der Zeit zu ungewollten Engpässen im Unternehmen führt, ebnet die Flusseffizienz den Weg zum Wachstum.
1.1Warum Lean unentbehrlich ist
Krisenhaft oder nicht? Die heutige Situation vieler Unternehmen
Vorbei ist die Zeit, in der Unternehmen alles, was sie produzierten, an eine homogene Käuferschicht verkaufen konnten, in der Umsätze (und Gewinne) beinahe automatisch Jahr für Jahr stiegen und selbst steigende Kosten kein Problem darstellten. Längst haben sich die Verkäufer- in Käufermärkte verwandelt. Das heißt konkret: Die Käufer sind wählerischer geworden, entscheiden selbst, ob, wann, was und bei wem sie kaufen – und das häufig zu einem Preis, den sie selbst mitbeeinflussen können. In Anbetracht der riesigen Angebotsmenge und der im Vergleich dazu geringeren und in einigen Märkten auch stagnierenden oder sinkenden Nachfrage können Käufer vielfach die Preise drücken. Man denke nur an die »Rabattschlachten« in der heutigen Konsumgesellschaft, von der selbst hochkomplexe technische Güter wie Autos oder Unterhaltungselektronik nicht ausgeschlossen sind. Gefällt ein Angebot nicht, ist es zu teuer oder wird es aus anderen Gründen abgelehnt, »stimmen die Käufer mit den Füßen ab« und wenden sich einem anderen Anbieter zu.
Unterhalte ich mich mit mittelständischen Unternehmern, so höre ich vielfach, dass Umsätze und Gewinne tendenziell sinken, dass der Verlust von Marktanteilen droht und man sich den Kopf zerbricht, wie man die steigenden Kosten auffangen kann. Nicht alle empfinden die Situation als krisenhaft, aber viele erkennen die Tendenz: »Wenn es so weitergeht wie bisher, haben wir irgendwann ein dramatisches Problem. Wir müssen unbedingt gegensteuern.« Das heißt konkret: Die Produktivität müsste gesteigert und die Kosteneffizienz deutlich erhöht werden. Aber wie?
Abb. 1.1: Die von mittelständischen Unternehmen heute am gravierendsten empfundenen Probleme
Selbst ein Unternehmen, das über Jahre hinweg konstante und stabile Umsätze erwirtschaftet, kann nicht verhindern, dass die Kosten weiter ansteigen – und dementsprechend die Gewinne sinken. Und das tun sie: Material- und Energiekosten sowie Inflation wirken von außen auf jedes Unternehmen ein, ohne dass es einen Einfluss darauf hat (vgl. Abb. 1.1). Hinzu kommen andere Faktoren wie zunehmender Wettbewerb und steigende Anforderungen des Gesetzgebers, deren Einhaltung ein wachsendes Arbeitsaufkommen erfordert; man denke z. B. an die DGSVO, an klimaneutrales Produzieren, an Umweltfreundlichkeit und Entsorgung und an die restriktiven Arbeitsschutzgesetze, die nur wenig Spielraum lassen.
Im Grunde müsste jedes Unternehmen jährlich ein Stück weit effizienter werden, um die Schere zwischen Umsätzen und Kosten zu schließen – erst recht, wenn es darum geht, die Gewinne nicht nur zu halten, sondern auch zu erhöhen, wonach jedes gesunde Unternehmen strebt.
Wichtig:
Die steigenden Kosten aufzufangen und dabei möglichst gleichzeitig die Gewinne zu erhöhen, ist die Herausforderung, die jedes Unternehmen heute zu leisten hat – eine Aufgabe, die immer schwieriger zu werden scheint. Neben dem typischen Wettbewerbsdruck in Käufermärkten sind auch die Globalisierung und die Digitalisierung potenzielle Kostentreiber wie auch Unsicherheitsfaktoren.
[17]Das typische Vorgehen zur Kostenreduzierung
Was tun Unternehmen üblicherweise, um effizienter zu werden? Häufig gibt es betriebsinterne Projektmanager, die damit beauftragt werden, regelmäßig Einsparungen durchzuführen, z. B. in Form von Business-Reengineering-Programmen. Das läuft zu Anfang recht gut und scheint auch lohnenswert zu sein. Allerdings hängen die Früchte, die man bei den Einsparungen ernten kann, im Laufe der Zeit immer höher. Sind erst einmal die größten Kostentreiber beseitigt, wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, noch weitere sinnvolle Maßnahmen zur Kostenreduzierung zu finden; die Projekte werden kleinteiliger und zugleich aufwendiger, während die Kosten dennoch die Tendenz zeigen, weiter anzusteigen. Irgendwann haben auch solche Projekte eine Grenze erreicht, jenseits der sie selbst nicht mehr wirtschaftlich sind, weil die Ausgaben dafür höher sind als die erzielten Einsparungen.
Das liegt meiner Meinung nach unter anderem daran, dass die üblichen Projekte, die die Schere zwischen Kosten und Gewinnen schließen sollen, als einmalige Optimierungen angelegt sind. Will man sie dennoch wiederholt durchführen, muss man jedes Mal wiederum schauen, wo sich der Hebel erneut ansetzen lässt. Eine Kontinuität ist nicht gegeben.
Anders ist es beim Lean-Ansatz, der von Anfang an auf kontinuierliche Verbesserung angelegt ist. Dabei geht es nicht nur darum, Kosten zu senken – dies ist ein erwünschter Nebeneffekt –, sondern vor allem eine Wertschöpfungsorientierung im gesamten Unternehmen zu verankern, die langfristig wirkt und die Gewinne positiv beeinflusst. Sinnvolle Projekte, die die Wertschöpfung erhöhen, legen den Fokus auf Qualität, Kosten und Durchlaufzeit und sind unter Einsatz des methodischen Lean-Werkzeugs leicht auffindbar.
Ich behaupte: Mit Lean lässt sich effizientes Denken und Handeln im gesamten Unternehmen und im Handeln aller Mitarbeiter verankern. Es ist dann nicht mehr die Angelegenheit eines speziellen Managers und seines Projektteams, das seinen Einfallsreichtum in Sachen Kostenoptimierung immer wieder unter Beweis stellen muss, sondern es ist Sache aller Mitarbeiter und sämtlicher Führungskräfte.
Lean hat noch weitere Vorteile: Es stabilisiert die Arbeitsabläufe und Prozesse eines Unternehmens – eine Voraussetzung für die Erhöhung der Wertschöpfung – und trägt damit zur Steigerung der Produktivität bei. Zudem bringt es Angebot und Nachfrage in ein ausgewogeneres Verhältnis, da die Ausrichtung an Kundenbedürfnissen, also an der Nachfrage, eines der wesentlichen Merkmale ist.
Wichtig:
Unter »Lean« versteht man eine Strategie, deren Prinzipien, Methoden, Verhaltensweisen und Führungsgrundsätze zur effizienten Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens beitragen. »Lean« bedeutet »schlank«, zielt aber nicht auf die Entlassung von Mitarbeitern ab, wie häufig fälschlich angenommen, sondern vielmehr auf die Erhöhung der Produktivität durch die Eliminierung von Hemmfaktoren aus den Wertströmen sowie die Schließung der Lücke zwischen der tatsächlichen Leistung und den Erwartungen der Kunden.
[18]1.2Wie die beiden Arten von Effizienz sich auswirken
Der Blick auf betriebliche Ressourcen ist einengend
Fragt man Unternehmer und Führungskräfte, ob sie ihre Organisation für »effizient« halten, so stimmen sie fast durchgehend zu, und zwar ungeachtet dessen, ob sie die Relation zwischen Umsätzen, Kosten und Gewinnen für optimal oder für verbesserungswürdig halten. Einer der bedeutendsten Unterschiede zwischen Lean und anderen Optimierungsprogrammen liegt im Verständnis von »Effizienz«. Daher soll ihr im Folgenden besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das richtige Verständnis von Effizienz ist die Basis für ein Umdenken in eine Richtung, die von Anfang an auf höhere Wirtschaftlichkeit abzielt.
Wichtig:
Wenn Unternehmen Effizienz anstreben, dann meinen sie damit für gewöhnlich die bestmögliche Auslastung von Maschinen, Anlagen, aber auch Arbeitsplätzen bzw. Mitarbeitern. Wer oder was nicht voll ausgelastet ist und zumindest zeitweise »Leerlauf« hat, verursacht Opportunitätskosten. Dies ist die gängige Anschauung von Effizienz, die ich als »Ressourceneffizienz« bezeichne (vgl. Modig/Ahlström 2019).
Ressourceneffizienz bedeutet, dass möglichst viele gleichartige Teile oder Stücke hintereinander an einer Anlage oder einem Arbeitsplatz produziert oder verarbeitet werden, um die (Um-)Rüstzeiten bzw. Stillstände so gering wie möglich zu halten. Bei nicht-materiellen Leistungen, wie sie im Service- oder Verwaltungsbereich erbracht werden, gilt dies ebenso. Denn auch Menschen brauchen eine »mentale Rüstzeit«, bevor sie geistig auf eine komplett andere Aufgabe umschalten können; von daher sind sie bestrebt, gleichartige Aufgaben »am Stück« zu verrichten und Unterbrechungen oder Störungen durch ungewollte andersartige Tätigkeiten zu vermeiden.
Die Ressourceneffizienz geht auf die Frühzeit der Industrialisierung zurück, genauer gesagt auf den Taylorismus, der bemüht war, komplexe Arbeitsabläufe in einzelne, handhabbare Teile zu zerlegen, die jeweils in getrennten, aber spezialisierten Abteilungen erledigt oder an unterschiedlichen Maschinen gefertigt wurden. So konnte man möglichst viel und schnell produzieren, was in Verkäufermärkten entscheidend war, um größtmögliche Gewinne in kürzestmöglicher Zeit zu realisieren. Die Kunden nahmen ohnehin jedes Produkt ab; um es zu bekommen, waren sie sogar bereit, Wartezeiten in Kauf zu nehmen, bis es fertig bzw. verfügbar war.
Genau darin liegt nun das Problem, wenn Unternehmen heute noch entsprechend dem Prinzip der Ressourceneffizienz nach Auslastung streben: Die Märkte haben sich in Käufermärkte verwandelt, die Nachfrage ist geringer, die verkauften Stückzahlen identischer Produkte sind deutlich niedriger als früher. Technische und andere Güter werden mittlerweile in unzähligen Ausstattungsvarianten hergestellt, sodass sogar mehrere Produkte desselben Typs unterschiedlich sind, selbst wenn sie gleich aussehen. Henry Ford konnte am Beginn des industriellen Zeitalters noch sagen: »Meine Autos können die Kunden in jeder Farbe bekommen, solange sie schwarz ist.« Ich brauche nicht auszuführen, wie weit wir inzwischen davon entfernt sind und wie viele Produktvarianten es heute gibt, und zwar bei sehr vielen industriellen Produkten. [19]Sofern man sich an der Ressourceneffizienz orientiert, besteht damit einerseits immer die Gefahr der Überproduktion von Waren, für die sich unter Umständen keine Abnehmer finden und die daher »auf Halde« liegen. Andererseits führt sie aber auch zu erheblichen Stockungen und Verzögerungen im Betrieb selbst und blockiert damit etliche Abläufe.
Schauen wir uns Letzteres genauer an: Angenommen, die Teile A, B und C müssten in großer Stückzahl an einer Anlage produziert werden, die im Vergleich zu den anderen Produktionsschritten am längsten für die Bearbeitung eines Teils benötigt. Für jeden Teilewechsel (A->B->C->A usw.) ist eine lange Umrüstung der Maschine erforderlich. Daher wird der Produktionsverantwortliche aus Effizienzgründen bestimmen, dass zunächst Teil A komplett, anschließend Teil B und zuletzt Teil C bearbeitet wird. Somit muss nur drei Mal gerüstet werden. Die Teile B und C befinden sich also eine ganze Weile – unter Umständen mehrere Tage oder Wochen – in einer »Warteschlange«, bis ihre Bearbeitung an der Reihe ist. Damit ist die betreffende Maschine bzw. Ressource effizient ausgelastet.
Aus Kundensicht entstehen dadurch unbeliebte Wartezeiten. Theoretisch könnte man auch sagen, dass die Prozesse für die Teile B und C sich »hinten anstellen« müssen bzw. sich aufgrund der effizienten Nutzung einer bestimmten Ressource aufstauen. Die enorm verzögernde und behindernde Wirkung von Staus und Stillständen erleben wir täglich hautnah auf den Autobahnen, wenn wir selbst darin stecken. Verengen sich z.B. die Fahrspuren aufgrund einer Baustelle, so bildet sich oftmals ein langer Rückstau, der den Durchlauf der Fahrzeuge stark blockiert, obwohl es sich nur um einen kurzen verengten Streckenabschnitt von wenigen Kilometern, manchmal sogar nur von wenigen Metern, handelt. Die vielen Fahrzeuge, die in den Staus stehen oder nur schleppend vorankommen, entsprechen in der Fertigung den Beständen, die sich vor dem Engpass aufstauen, viel Platz benötigen und organisiert werden müssen. Beide haben eines gemeinsam: Sie benötigen erheblich mehr Zeit, um ihr Ziel zu erreichen.
So betrachtet, reden wir sogar von offensichtlichen Kostentreibern, die das Verhältnis von Gewinnen und Kosten ungewollt verschlechtern. Konkret könnte dies so aussehen, dass die Kunden, die sich »hinten anstellen« und übermäßig lange auf die Fertigprodukte B und C warten müssen, unzufrieden sind, in Zukunft weniger oder gar nichts mehr bestellen und zur Konkurrenz abwandern – und zwar selbst dann, wenn B und C »Spitzenprodukte oder -dienstleistungen« sind, die durchaus wettbewerbsfähig oder sogar dem Wettbewerb überlegen sind.
Werfen wir noch einen genaueren Blick auf das, was innerhalb eines Betriebs passiert, wenn die Ressourceneffizienz als Maßstab für die Produktion bzw. die Bearbeitung von Aufgaben herhält. Die Zeit, in der ein Produkt die Herstellung durchläuft, wird stets von demjenigen Prozessschritt beeinflusst, der die längste Zykluszeit beansprucht; hier besteht der größte Engpass. (Man könnte auch sagen: Jede Prozesskette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.)
[20]Nehmen wir an, B und C werden jeweils in insgesamt sechs Prozessschritten gefertigt. Der Engpass, der »Flaschenhals«, besteht in diesem Beispiel bei Schritt drei, wo die Wartezeit aufgrund der festgelegten Produktionsreihenfolge von mehreren Tagen an der entsprechenden Anlage entsteht, die gerade mit der Produktion von Teil A voll ausgelastet ist. An den Arbeitsplätzen für die Prozessschritte vier bis sechs entsteht aus Produktsicht eine Wartezeit, weil die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit für Produkt A erst fortfahren können, wenn sie von Station drei die entsprechenden Vorprodukte bekommen haben. Um das »theoretische« Warten zu überbrücken, weiß man sich zu helfen. Für gewöhnlich werden an den folgenden Stationen Bestände mit den entsprechenden Halbfertigteilen aufgebaut, um dann, wenn A, B oder C verfügbar ist, »gefühlt« sehr effizient mit den vorproduzierten Beständen weiter zu arbeiten. Die Einrichtung solcher Lager an den Stationen führt zu weiteren Problemen und Verschwendungen, die wir gleich näher betrachten.
Im Lean-Management drückt man es so aus: Der »Primärbedarf« für den Wertschöpfungsprozess der Produkte B und C wurde nicht erfüllt, und daraus erwächst nun ein »Sekundärbedarf«. Das heißt, es entsteht ein neuer, ursprünglich nicht vorhandener Bedarf, der hier in Vorratslagern für die Halbfertigprodukte B und C besteht. Es kommt also zu einer Art Kettenreaktion (vgl. Modig/Ahlström 2019, S. 54 ff.) wie bei einem Dominospiel: Der erste Stein ist gekippt und sorgt dafür, dass der nächste ebenfalls umfällt.
Theoretisch sind noch weitere Problemfälle denkbar. Zum Beispiel könnte es auch an den Stationen vier bis sechs bei der Produktion der B- und C-Teile zu Engpässen kommen, diesmal aber aus ganz anderen Gründen: Ein Mitarbeiter könnte aufgrund von Krankheit wiederholt ausfallen, die Maschinen an den Stationen könnten störanfällig sein oder Ausschuss produzieren, der eine Nacharbeit der Fehler erforderlich macht, sodass wiederum weiterer Bedarf für zusätzliche Bestände entsteht, um die abhängigen Prozessschritte weiter mit Arbeit zu versorgen – mit anderen Worten: Die nächsten Dominosteine kippen.
Vermutlich werden nicht nur Produktionsverantwortliche diesem Gedankengang bis hierhin zustimmen und denken: »Na ja, so ist das eben in der Produktion. Das kann man nicht grundsätzlich ändern, sondern höchstens temporär. Dann müssen eben alle Beteiligten – Mitarbeiter und gegebenenfalls Endkunden – warten, bis die Teile B und C fertig sind, oder es werden Bestände im Fertigwarenlager dazu angelegt. Schließlich können wir nicht extra für B und C noch weitere teure Anlagen erwerben, denn dadurch würde sich die Kostenstruktur des Betriebs erst recht verschlechtern. Also müssen wir zusehen, wie wir das gehandhabt kriegen, zur Not eben mit Troubleshooting-Aktionen, wenn’s mal ganz brenzlig wird.« Das ist richtig und entspricht in vielen Betrieben dem gelebten Alltag. Aber es entspricht grundsätzlich nicht dem Vorgehen in einem lean-orientierten Unternehmen! Mithilfe von Lean ist ein Unternehmen in der Lage, solche Engpässe in Prozessen zu analysieren und zu optimieren. Oft werden sie beseitigt, und zwar dauerhaft.
[21]Ursachen für »Wasserköpfe« und Silo-Denken
Ressourceneffizienz zieht noch weitere ungewollte Effekte nach sich: Wenn man die Ressourcen auslastet, bedeutet dies zwangsläufig, dass viele Arbeitsabläufe gleichzeitig ablaufen müssen. Denn es liegt in der Natur einer nach Auslastung strebenden Organisation sicherzustellen, dass kein Arbeitsmangel besteht, sondern alle Arbeitsplätze und Anlagen maximal genutzt werden. Nicht zuletzt dadurch steigt oftmals unnötig der Verwaltungsaufwand, denn auch Verwaltungsarbeitsplätze rentieren sich nur bei einem entsprechend hohen Beschäftigungsgrad der Mitarbeiter. Darin liegt eine der Ursachen für die »Wasserköpfe«, die sich in Verwaltungen häufig bilden und die die Produktionsbereiche unnötig kontrollieren oder auch behindern. Im Extremfall kann der Eindruck entstehen, dass eine Organisation überwiegend damit beschäftigt ist, sich selbst zu verwalten, und der Kunde dabei eigentlich nur noch »stört«.
Oft spiegelt die Produktion die Qualität der vorgelagerten Verwaltungsprozesse wider, z. B. wenn der Einkauf aus Kostengründen nur billige Einzelteile bei den Lieferanten bezieht und diese anschließend in der Herstellung zeitaufwendig nachgearbeitet werden müssen, weil sie qualitativ minderwertig sind und ohne Nacharbeit nicht verwertbar wären. Oder wenn der Vertrieb bei Eingang vermeintlich lukrativer Sonderaufträge »Schnellschüsse« durch die Fertigung jagt, die Sonderleistungen verlangen und zu Wartezeiten bei anderen Produkten führen. Dann kommt es durch den Termindruck zu einer hohen Anspannung aller Mitarbeiter, und nicht selten passieren in der Hektik unkalkulierbare Fehler, die wiederum behoben werden müssen. Das kostet unter Umständen mehr, als der Sonderauftrag dem Unternehmen an Gewinn gebracht hat. Wir können hier quasi zuschauen, wie die Dominosteine nacheinander umkippen.
Die unterschiedlichen Abteilungen agieren oft isoliert voneinander, weil der Informationsfluss zwischen ihnen nur unzureichend ist. Durch das »Silo-Denken« entstehen Konflikte zwischen den scheinbar konträren Zielen der jeweiligen Abteilungen, die sich häufig neben der lähmenden Bürokratie auch in emotionalen Auseinandersetzungen sowie in einem Mangel an Zusammenarbeit und gegenseitigen Schuldzuweisungen zeigen (vgl. Kotter 2011, S. 17). Typisch sind beispielsweise mehr oder weniger offene Vorwürfe, wobei die Aufforderung zum Handeln gerne an andere Abteilungen abgegeben wird. Sind neue Wettbewerber auf den Markt gekommen, heißt es beispielsweise, es sei Aufgabe des Marketings, dieser Herausforderung zu begegnen. Die Marketingabteilung beklagt jedoch, dass die Entwicklungsabteilung zu lange brauche, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, und sie daher nichts tun könne. Die Produktentwicklung beschwert sich, dass das Marketing keine belastbaren Informationen über die Kundenwünsche liefere und sie deshalb auch keine neuen Produkte entwickeln könne. Man schiebt sich reihum den »schwarzen Peter« zu, während alle weiterhin in der unbefriedigenden Situation verharren. Konkret drückt sich diese Lage beispielsweise in Sätzen aus wie: »Solange die Abteilung XY nicht das und das tut, brauchen wir auch nicht zu reagieren«, oder: »Wir können hier machen, was wir wollen, es verändert sich sowieso nichts«.
Abb. 1.2: Ressourceneffizienz: Silodenken und Trennungen zwischen den Unternehmensbereichen bzw. Abteilungen sind üblich; Prozesse sind entlang den Bereichssilos organisiert
Wollen wir all die negativen Effekte der Ressourceneffizienz vermeiden, müssen wir eine andere Art von Effizienz anstreben, nämlich die Flusseffizienz.
Die Flusseffizienz macht den Unterschied
Dass Prozesse und Abläufe »fließen«, scheint dem Anspruch zu widersprechen, mithilfe der Auslastung der Ressourcen Größenvorteile anzustreben. Es scheint zunächst auch nicht vorstellbar und nicht realisierbar, wenn man über viele Jahre oder Jahrzehnte daran gewöhnt ist, Prozesse auf die übliche Weise zu betrachten. Aber es ist möglich.
Wichtig:
Bei der Flusseffizienz liegt der Fokus nicht auf den betrieblichen Ressourcen, sondern auf der »Flusseinheit«, also auf dem Produkt oder der Dienstleistung und damit auf denjenigen Faktoren, die unmittelbar zur Wertschöpfung beitragen. Die Flusseffizienz ist »die Summe der wertschöpfenden Aktivitäten im Verhältnis zur Durchlaufzeit« (Modig/Ahlström 2019, S. 30).
»Flusseffizienz« bedeutet: Der gesamte Prozess wird aus der Perspektive des zu fertigenden Produktes oder der zu erbringenden Dienstleistung (neu) gestaltet, und zwar so, dass die Durchlaufzeit dabei möglichst gering bleibt. Entscheidend ist dabei jeweils, ob die Flusseinheit einen Wert erhält oder nicht. Einen Wert erhält sie immer dann, wenn sie gerade be- oder verarbeitet wird. Kein Wert wird hingegen dort zugeführt, wo es stockt, staut, stillsteht, Verzögerungen oder Wartezeiten entstehen oder Lager übermäßig anwachsen. Nur dann, wenn ein Wert geschaffen wird, findet tatsächlich eine Wertschöpfung statt, für die der Kunde zu zahlen bereit ist.
Abb. 1.3: Flusseffizienz: Die Prozessketten verlaufen »quer« zu den Unternehmensbereichen, und die Prozesse werden bereichsübergreifend organisiert
Erhöht sich die Flusseffizienz, so fließen die Flusseinheiten schneller durch die Organisation, ungeachtet dessen, inwieweit die betrieblichen Ressourcen dabei jeweils ausgelastet sind. Dies soll am folgenden Beispiel zweier Fluggesellschaften veranschaulicht werden, die wie alle Servicebereiche ebenso den Effizienzgesetzen unterliegen wie die Produktion.
BEISPIEL
Zwei Fluggesellschaften im Vergleich
Für eine Airline gehören die Flugzeuge zu den wichtigsten und zugleich teuersten betrieblichen Ressourcen. Sobald sie am Boden stehen, kosten sie Geld. Deshalb liegt es nahe, sie bestmöglich auszulasten und dafür zu sorgen, dass sie überwiegend in der Luft sind und Passagiere befördern. Ryanair revolutionierte ab 1984 das Flugwesen, indem es radikaler als andere Airlines dafür sorgte, die Maschinen »in Bewegung« zu halten, und damit zum Prototyp für billiges Fliegen wurde. Keine andere Airline bot so günstige Flüge an wie Ryanair, sodass bald auch konkurrierende Airlines wie die Lufthansa Tochtergesellschaften wie Eurowings gründeten, die ebenfalls Billigflüge anboten. Die superpreiswerten Flüge, die oftmals sogar unter 50 Euro liegen, sorgten für eine gute Auslastung der Maschinen und revolutionierten geradezu das Fliegen, machten es für jedermann erschwinglich und trugen dazu bei, dass Kunden selbst der Bahn den Rücken zukehrten. Vordergründig sieht das nach einem echten Erfolg aus der Sicht der Airline aus. Aber was sagen die Kunden, die vom niedrigen Flugpreis profitieren? In der Tat steht kaum eine Fluggesellschaft so unter Beschuss wie Ryanair: Die Passagiere beschweren sich, dass die Flughäfen an kleinen, abgelegenen Orten liegen, die oftmals mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar sind, wie z. B. Hahn im Hunsrück. Zudem wird oft nicht pünktlich abgeflogen, sondern die Flugzeiten verschieben sich unkalkulierbar um viele Stunden, derweil die Fluggäste am Boden warten müssen, zum Teil sogar über Nacht.
[24]Manche Passagiere beklagen sich auch, dass die Flugpreise »Mogelpackungen« seien, weil alles, was nicht den Flug selbst betrifft, extra bezahlt werden muss, so z. B. die Mitnahme eines Koffers, der nicht zum Handgepäck gehört, Essen und Trinken an Bord usw. Stiftung Warentest ermittelte 2009, dass Ryanair im Vergleich zu zehn anderen Fluggesellschaften in Sachen Information und Buchung am schlechtesten abschnitt, weil ein Support für Umbuchungen und Stornierungen nur in Irland und nur in englischer Sprache verfügbar war. Das Fehlen einer E-Mail-Kontaktadresse verstieß sogar gegen EU-Richtlinien und wurde mittlerweile behoben. Doch die Kritik an Ryanair reißt nicht ab, und besonders krasse Fehlleistungen aus Sicht der Verbraucher, aber auch der Mitarbeiter von Ryanair füllen immer wieder Schlagzeilen und Blogs.
Wir haben also auf der einen Seite eine hohe Auslastung der Maschinen, auf der anderen Seite aber eine niedrige Kundenzufriedenheit und eine geringe Flusseffizienz: Die Passagiere haben extrem lange Anfahrtszeiten zu den Flughäfen und unkalkulierbare Wartezeiten bis zum Abflug.
Geradezu konträr verhält sich die britische Airline Virgin Atlantic. Dort hat man sich den gesamten Prozess angeschaut, den ein Passagier durchlaufen muss, um fliegen zu können: angefangen vom Verlassen des Hauses, über den Weg zum Flughafen bis zu den unzähligen und oft stundenlangen mehrfachen Kontrollen im Fluggebäude selbst – und das Ganze wiederum rückwärts, sobald man am Flugziel angekommen ist. In der Tat beträgt die »wertschöpfende« Flugzeit im Vergleich zur gesamten Durchlaufzeit, die ein Fluggast benötigt, oft nur ein Achtel bis ein Fünftel. Diese Zeit ist auch der kritische Faktor, warum viele Leute auf einen Flug verzichten und lieber ein anderes Verkehrsmittel wählen. Aus diesem Grund hat Virgin Atlantic ein spezielles Konzept für viel beschäftigte Unternehmer und Führungskräfte entwickelt, indem sie diese als »Flusseinheiten« betrachtet: Die Reisenden werden am Arbeitsplatz abgeholt, per Motorrad auf dem kürzesten Weg durch den Verkehr geschleust und zum Flughafen gefahren, wo sie mittels eines »Fast Track« durch das Gebäude mit allen Kontrollen gelotst werden, ohne irgendwo Schlange stehen zu müssen. Sie werden direkt in die erste Klasse des Flugzeugs geleitet. Die Airline stellt also das Kundeninteresse an einer niedrigen Durchlaufzeit an die höchste Stelle und konnte dadurch Höchstpreise für Flugtickets erlösen.
Auch in anderen Bereichen betrachtet man bei Virgin Atlantic den Prozess aus der Sicht des Kunden und führte Innovationen ein, z. B. eine neue Klasse zwischen Business und Economy. Zudem wurden die Sitze in der Businessclass diagonal angeordnet, so dass jeder Passagier direkten Zugang zum Gang hat und entsprechend weniger eingeklemmt sitzt.
Wer ist nun unter betriebswirtschaftlichem Aspekt erfolgreicher – Ryanair oder Virgin Atlantic? Im November 2019 – kurz vor dem Corona-Ausbruch, der die Situation aller Fluggesellschaften massiv verändert hat – hieß es in der Presse: Ryanair konnte von 2018 auf 2019 seine Gewinne nicht mehr steigern, obwohl die Anzahl der Passagiere in diesem Zeitraum sogar um 11 Prozent angestiegen war. Der Preis der Flugtickets war in der gleichen Zeit um etwa 3 Euro und der Gewinn pro Fluggast um 2 Euro gesunken. Richtig gut sieht es bei Ryanair hingegen mit [25]der Auslastung der Flugzeuge aus, die bei 96 Prozent liegt – höher als bei sämtlichen anderen europäischen Airlines (vgl. Orange/Handelsblatt 2019).
Wir sehen hier den typischen Verlauf eines seit Jahren auf Ressourceneffizienz getrimmten Unternehmens: Die Maschinen werden in der Tat bestens genutzt, aber die Gewinne stagnieren trotz zweistellig wachsender Kundenzuwächse. Gleichzeitig laufen Ryanair die Kosten davon, da die Treibstoffpreise sich ebenso erhöht haben wie die Gehälter der Mitarbeiter. Ryanair befindet sich in einer kritischen Situation zwischen tendenziell sinkenden Gewinnen, steigenden Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck durch andere Billig-Airlines.
Und Virgin Atlantic? 2018 und 2019 gehörte die Fluggesellschaft laut Airlineratings.com zu den 20 besten der Welt im Hinblick auf Sicherheit, Passagierbewertung, Innovationen sowie Rentabilität, 2020 rangierte sie unter den 20 sichersten der Welt. Ein Schlaglicht aus dem Jahr 2019: Die Airline kündigt an, die Anzahl der Flugverbindungen innerhalb Europas massiv erhöhen und in sieben Jahren um das Vierfache wachsen zu wollen. Unter anderem soll dafür der Flughafen London Heathrow ausgebaut werden (vgl. Frankfurtflyer.de 2019).
Ryanair hat viele für ressourceneffiziente Organisationen typische Probleme: Die Airline kann nur überleben, wenn sie um jeden Preis so viele Passagiere wie möglich in einem einzigen Flugzeug befördert und wenn sich die Kunden der Verfügbarkeit der Maschinen anpassen anstatt umgekehrt. So muss bei jedem Flug zugleich eine preisgünstige Betankung eingeplant werden, oft zulasten der Fluggäste, die ungewollte Zwischenlandungen und weite Umwege zum Zielflughafen sowie Verspätungen in Kauf nehmen müssen. Bei Virgin Atlantic ist all dies nicht gegeben. Aufgrund der hochpreisigen Flugtickets, für die die Passagiere entsprechend dem herausragenden Service zu zahlen bereit sind, kann die Airline auch dann rentabel fliegen, wenn die Maschinen nicht voll besetzt sind.
Der allzu starke Fokus auf die Ressourcen führt automatisch zu einer geringen Flusseffizienz und versperrt den Blick auf die Wertschöpfung, also auf das, was die Kunden schätzen und wofür sie zu zahlen bereit sind.
Wichtig:
Den Fokus auf die Ressourcen- anstatt auf die Flusseffizienz zu richten, birgt das typische Risiko, dem viele Unternehmen diverser Branchen heute unterliegen: sinkende Produktivität bei steigenden Kosten. Statt den Blick nach innen, auf die betrieblichen Ressourcen, zu richten, ist es vorteilhafter, ihn nach außen, auf die Kundenbedürfnisse, zu richten. Nicht den betriebsinternen Ressourcen sollte »Wert zugeführt« werden, sondern den Produkten oder Dienstleistungen bzw. »Flusseinheiten«, die die Endkunden nachfragen.
Während man bei der Ressourceneffizienz den Blick auf die Mittel richtet, schaut man bei der Flusseffizienz auf die Ziele, die man mit diesen Mitteln erreichen möchte. Diese bestehen letztlich darin, wettbewerbsfähige Produkte oder Dienstleistungen für Kunden zu erstellen oder zu erbringen, für die sie gerne zahlen.
[26]Die Flusseffizienz zu erhöhen bedeutet nicht, die vorhandenen Ressourcen zu vernachlässigen oder auf ihre Auslastung zu verzichten – im Gegenteil. Die Auslastung wird sich nur anders gestalten. Eine Organisation, die kontinuierlich ihren Fluss verbessert, wird neue Erfahrungen sammeln, ein neues Verständnis des Kundenbedarfs entwickeln und auf dieser Basis die Ressourcen neu bewerten und anders einsetzen. Idealerweise werden die vorhandenen Ressourcen sogar besser genutzt als je zuvor.
1.3Verschwendung blockiert den Fluss
Die neun Arten der Verschwendung
Eine Organisation flusseffizient zu gestalten, ist die Aufgabe von Lean-Management und Lean-Leadership. Dazu gibt es spezielle Vorgehensweisen wie auch Führungsgrundsätze, die in den folgenden Kapiteln näher vorgestellt werden. Hier möchte ich zunächst den Blick dafür schärfen, wodurch sich die Flusseffizienz erhöhen lässt: Es gilt, sich den Material- und den Informationsfluss anzuschauen, und zwar unter dem Aspekt, was der Wertschöpfung dient und was nicht. Alles, was nicht der Wertschöpfung dient und den Wertstrom behindert, sollte beseitigt werden; im Lean bezeichnet man solche Faktoren als Verschwendung (japan. »Muda«).
Man unterscheidet folgende Arten der Verschwendung:
Überproduktion: Idealerweise sollte immer genau das hergestellt werden, was der Kunde gerade benötigt. Es wird jedoch u. a. aufgrund von unpräzisen Vorhersagen oft mehr produziert. Dies ist die teuerste und schlimmste Verschwendungsart, da sie weitere Verschwendungen hervorbringt.Wartezeit: Die Produktion muss so organisiert werden, dass weder Mitarbeiter noch Maschinen auf geplante Aufträge warten müssen. Wartezeiten entstehen unter anderem bei Fehlmengen, technischen Ausfällen oder Kapazitätsengpässen.Unnötiger Transport: Damit durch den Warentransport nicht unnötige Kosten und Zeitverlust entstehen, sollten die Prozessstationen idealerweise räumlich stets so nahe beieinander liegen wie möglich. Transportwege entstehen u. a. durch funktional orientierte Layouts, Stapelbearbeitung und weit entfernte Lieferanten.Überbearbeitung: An einem Produkt sollte nicht mehr getan werden als für die Erfüllung der aktuellen Kundenanforderungen notwendig. Es kommt zu einer Überbearbeitung, wenn z. B. Annahmen getroffen werden, die mit dem Kunden nicht besprochen wurden, oder der Kundenwunsch falsch interpretiert wird.Überhöhte Bestände: Es sollte genauso viel Material (Halbfabrikate, Hilfs- und Betriebsstoffe usw.) vorhanden sein, wie der interne Kunde gerade benötigt oder nachfragt. Bestände entstehen u. a. durch lange Lieferzeiten, lange Rüstzeiten und schlechte Maschinenverfügbarkeit. Überschüssige Bestände binden Kapital und gehören zu den größten Kostentreibern.Unnötige Bewegungen: Um unnötige Wege und Bewegungen von Mitarbeitern zu vermeiden, sollte alles Benötigte griffbereit in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes zur Verfü[27]gung stehen. Unnötige Wege entstehen u. a. durch unorganisierte Arbeitsplätze, fehlende Teile, Informationen und Arbeitsmittel.Nacharbeit und Ausschuss: Fehler entstehen häufig u. a. durch instabile Prozesse, fehlende Arbeitsstandards oder ungeeignete Maschinen. Idealerweise sollten im Prozess keine Fehler oder gravierenden Abweichungen auftreten, die kostspielige Nacharbeit oder Ausschuss nach sich ziehen.Dies sind die sieben »klassischen« Arten der Verschwendung, die sich mithilfe von Lean-Management-Methoden beseitigen lassen. Daneben gibt es noch zwei weitere, für deren Eliminierung Lean-Leadership der entscheidende Faktor ist.
Fälschlich getroffene Annahmen: Idealerweise werden immer alle Anforderungen zwischen zwei Parteien – sei es zwischen interne Kunden und Lieferanten oder mit externen Kunden – klar und eineindeutig, also unmissverständlich, kommuniziert. Es werden jedoch oft von beiden Parteien unterschiedliche Annahmen getroffen, die sich als nicht eindeutig herausstellen und damit zu kostspieligen Problemen und Konflikten führen können (vgl. dazu das Beispiel Yellotools Kapitel 5.1).Ungenutzte Kreativität: Mitarbeiter sind die mit Abstand wichtigste Ressource im Unternehmen. Sie verfügen über ungeahnte und unentdeckte Potenziale, die es zu identifizieren und zu wecken gilt, anstatt sie ungenutzt zu verschwenden (vgl. Kapitel 8.2).Die Verschwendung führt ein Eigenleben
Verschwendung verschwindet nicht von allein, sondern hat die Eigenart, noch mehr Verschwendung hervorzubringen, sofern sie unerkannt bleibt. Sie ist wie eine Lawine, die immer mehr Kräfte und Energien an sich bindet und immer größer wird, je weiter sie voranrollt.
Angenommen, es existiert in der Produktion ein überhöhter Bestand. Irgendwann muss dafür eine zusätzliche Lagerhalle eingerichtet werden. Gleichzeitig sind nun die Transportwege länger geworden, um die Teile an den Produktionsort zu befördern. Gegebenenfalls braucht es dafür zusätzliche Transportwagen, z. B. Gabelstapler, vielleicht auch Staplerfahrer.
Das neue Lager beginnt nun mehr und mehr, ein »Eigenleben« zu führen, obwohl es eigentlich nur als Unterstützung für einen wertschöpfenden Herstellungsprozess gedacht war. Es verlangt nun selbst die Erfüllung gewisser Aufgaben: Die Lagerhalle muss beleuchtet und beheizt werden; man muss Vorsorge treffen, dass die gelagerten Teile nicht beschädigt werden, Rost ansetzen, verderben oder auf andere Weise sonstwie über einen längeren Zeitraum in ihrer Verwendbarkeit eingeschränkt werden. Zudem braucht es ein Inventar, damit sich die Bestände regelmäßig kontrollieren und auffüllen lassen. Das verlangt die Anschaffung eines Computers und einer Software.
Es ist leicht vorstellbar, dass es nicht lange dauern wird, bis auch mindestens ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt wird, der ausschließlich mit der »Verwaltung« des Lagers beschäftigt ist. Wenn das Unternehmen die Ressource des Lagers gut nutzen will, könnte es sein, dass nun [28]auch andere Teile »zur Sicherheit« auf Vorrat gefertigt werden, sodass der Bestand, das Lager und die damit verbundenen Aufgaben weiter anwachsen. Im Nu ist ein gewaltiger neuer Kostenapparat entstanden: Aus der unerkannten Ursache für den erhöhten Lagerbedarf ist eine regelrechte »Verschwendungslawine« geworden, die immer mehr Kräfte und Energien an sich bindet. Die Ursache bleibt jedoch im Dunkeln, wenn man sich nicht an der Flusseffizienz orientiert, also den Blick konsequent auf die Wertschöpfung für den Kunden lenkt.
Unausgeglichenheit und Überlastung
Neben der Verschwendung gibt es noch die Unausgeglichenheit (japan. »Mura«) im Arbeits- und Produktionsablauf und in der Auslastung von Mensch oder Maschine sowie die Überlastung (japan. »Muri«), wenn Mitarbeiter oder Anlagen überbeansprucht werden. Eine Verbesserung wird aus Sicht des Mitarbeiters nur umgesetzt, wenn dieser keiner zusätzlichen Belastung ausgesetzt wird.





























