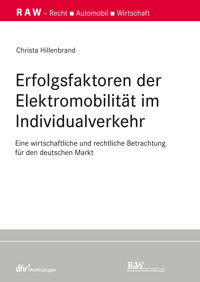
82,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: RAW Schriftenreihe Recht - Automobil - Wirtschaft
- Sprache: Deutsch
Die Elektromobilität, die Notwendigkeit der Technologie und deren Marktdurchdringung werden einerseits stark gefördert, andererseits stellen sich die erwartete Nutzerakzeptanz und Nachfrage noch nicht im wie von weiten Teilen von Wirtschaft und Politik gewünschten Rahmen ein. Frau Hillenbrand zeigt die potenziellen Ursachen dafür auf und geht detailliert auf die Erfolg beeinflussenden Faktoren aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht ein. Durch die Kombination der vielfältigen Bereiche wird das interdisziplinäre Forschungsfeld zur Erfolgsfaktorenforschung sowohl für Unternehmen als auch Produkte systematisch aufgearbeitet und theoretisch sowie empirisch ein geeignetes Erfolgsfaktoren-Konstrukt hergeleitet. Neben einer rechtlichen Legitimation für Markteingriffe auf Grundlage des europäischen Rechtssystems aber auch des deutschen Grundgesetzes werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Erfolg der Elektromobilität analysiert. Ein Überblick deutscher Rechtseingriffe über zivilrechtliche Regelungen, Förderungen sowie Investitionsrichtlinien liefert die Grundlage für deren Evaluation auf Wirkung und Zielerreichung. Die wirtschaftliche Betrachtung wird umfassend sowohl aus angebotsseitiger Perspektive als auch nachfrageseitiger Analyse vorgenommen. Der Fokus richtet sich dabei auf die Untersuchung der Wertschöpfungskette der Geschäftsmodellbetrachtung und die Entwicklungen des Absatzmarkts mit den notwendigen Adaptionsschritten sowie insbesondere dem Preissetzungsmechanismus. Ausblick gibt dabei ein Vergleich zu analogen technologischen Innovationen und deren erfolgreiche Nutzeradaption, Transformation sowie einen dadurch möglichen Markterfolg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Erfolgsfaktoren der Elektromobilität im Individualverkehr
Eine wirtschaftliche und rechtliche Betrachtung für den deutschen Markt
Christa Hillenbrand
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Herausgegeben und gefördert von dem Forschungsinstitut für Automobilrecht.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8005-1946-0
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected] www.ruw.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza
Inhaltsübersicht
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Einleitung
I. Relevanz der Thematik
II. Forschungsstand und Forschungslücke
III. Methodisches Vorgehen der Erfolgsfaktorenforschung
IV. Methodologische Vorgehensweise
V. Gang der Untersuchung
B. Elektromobilität – Treiber, Formen, Definition
I. Treiber alternativer Antriebsformen
II. Formen von Elektrofahrzeugen
III. Definition Elektrofahrzeuge
C. Technische Grundlagen
I. Aufbau Elektrofahrzeuge
II. Energiezufuhr, Netz und Ladeinfrastruktur
III. Fazit Kapitel C.
D. Status quo und Ursachen
I. Status quo
II. Ursachen
III. Fazit Kapitel D.
E. Juristischer Einfluss auf den Marktanteil
I. Juristische Legitimation des staatlichen Eingriffs
II. Deutsche Gesetzgebung zur Förderung der Elektromobilität
III. Fazit Kapitel E.
F. Wirtschaftlicher Einfluss auf den Marktanteil
I. Wirtschaftliche Auswirkungen der Elektromobilität
II. Elektromobilität und deren Absatz
III. Fazit Kapitel F.
G. Erfolgsfaktorenforschung
I. Was ist der Erfolg der Elektromobilität
II. Zusammenfassung
III. Limitation und Ausblick
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Einleitung
I. Relevanz der Thematik
II. Forschungsstand und Forschungslücke
III. Methodisches Vorgehen der Erfolgsfaktorenforschung
1. Theoretische Basis der Erfolgsfaktorenforschung
2. Einordnung etablierter Konzepte
a) HEFAP
b) Trommsdorff
c) Bekannteste EFF-Konzepte für Unternehmen
aa) PIMS-Studie
bb) Steinmann/Schreyögg
cc) In Search of Excellence
d) EFF für Produkte nach Cooper
3. Ansatz zur Identifikation von Erfolgsfaktoren der Elektromobilität
IV. Methodologische Vorgehensweise
V. Gang der Untersuchung
B. Elektromobilität – Treiber, Formen, Definition
I. Treiber alternativer Antriebsformen
1. Ökologisch
a) Klimawandel
b) CO2-Ausstoß
c) Energieträger und fossile Ressourcen
2. Politisch
a) Selbstverpflichtung auf globaler Ebene
b) Europäische Ebene
aa) Weißbuch 2011
bb) Emissionsnormen Pkw
c) Nationale Ebene
aa) Europäische Zielerreichung
bb) Deutsche Förderstrategie
3. Sozioökonomisch
a) Verändertes Mobilitätsverhalten
b) Veränderte Kundennachfrage
II. Formen von Elektrofahrzeugen
III. Definition Elektrofahrzeuge
C. Technische Grundlagen
I. Aufbau Elektrofahrzeuge
1. Energiequelle
a) Definition Begrifflichkeiten
aa) Energiekapazität und -leistung
bb) Energiedichte
cc) Leistungsdichte
dd) Lebensdauer, Zyklenlebensdauer und Zyklentiefe
b) Zusammenhang Gewicht, Batteriegröße und Reichweite
c) Lithium-Ionen-Akku
aa) Rohstoffeinsatz
bb) Kosten
cc) Energiedichte
dd) Crashsicherheit
ee) Reichweite
d) Recycling und zweites Leben der Batterie
2. Elektromotor
a) Typen von Motoren
b) Rohstoffeinsatz, Kosten und Recycling
c) Emissionen
aa) Lärmbelastung
bb) CO2-Belastungen
cc) Elektrosmog
d) Wartung und Restwert von BEVs
3. Idealtypische Karosseriebauweise
a) Leichtbau
b) Fahrzeuggröße
c) Lokalisierung Batterie
d) Design
II. Energiezufuhr, Netz und Ladeinfrastruktur
1. Strom
a) Energienutzung der BEVs
b) Indikative Kalkulation des zusätzlichen Strombedarfs
2. Netz
a) Lademanagement
b) Energiespeicher
3. Ladeinfrastruktur
a) Private Ladepunkte
b) Öffentliche Ladepunkte
c) Alternative Lademöglichkeiten
aa) Mobile Electric Vehicle Charger
bb) Induktives Laden
cc) Batteriewechsel
dd) Stellungnahme
d) Dichte und Ausbau der Ladeinfrastruktur
aa) Bedarf an Ladesäulen
bb) Ausbaumöglichkeiten
cc) Herausforderungen des Infrastrukturausbaus
III. Fazit Kapitel C.
D. Status quo und Ursachen
I. Status quo
II. Ursachen
1. Technologische Unsicherheit
2. Elektromobilität als Innovation
a) Innovationsobjekt
b) Innovationsgrad
c) Innovationsursprung
aa) Disruptive Innovation
bb) Technologische Innovation
3. Akzeptanz von BEVs
a) Technology Acceptance Model
b) Anpassung Nutzungsverhalten
c) Disruptive Technologie
4. Diffusion von BEVs
a) Diffusion nach Rogers
aa) Produkteigenschaften
bb) Geschwindigkeit der Diffusion
b) Diffusion nach Bass
III. Fazit Kapitel D.
E. Juristischer Einfluss auf den Marktanteil
I. Juristische Legitimation des staatlichen Eingriffs
1. Europäische Rechtsgrundlagen
2. Nationale Ermächtigungsgrundlage
3. Wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung
4. Stellungnahme
II. Deutsche Gesetzgebung zur Förderung der Elektromobilität
1. Straßenverkehrsrecht
a) Elektromobilitätsgesetz EmoG
b) Evaluierung des EmoG
2. Steuerrecht
a) Kfz- Steuer
b) Verbrauchssteuern
c) Dienstwagen bei privater Nutzung
d) Evaluierung der steuerlichen Begünstigungen
3. Ladeinfrastruktur
a) Energierecht
aa) Einordnung als Netzbestandteil
bb) Einordnung als Kundenanlage
cc) Infrastrukturrichtlinie RL 2014/94/EU
dd) Strommarktgesetz
ee) Evaluierung Energierecht
b) Blockchain im Microgrid
c) Ladesäulenverordnung
d) Evaluierung Ladesäulenverordnung
e) Messstellenbetriebsgesetz
f) Datenschutz
g) Eichrecht
h) Evaluierung Eichrecht
4. Ausbau der Ladeinfrastruktur
a) Berechtigung zum Ausbau
b) Ausbau LIS im privaten Raum
aa) Zivilrecht
aaa) WEG Reform
bbb) Evaluierung WEG nF
bb) Öffentliches Recht
aaa) Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz GEIG
bbb) Evaluierung GEIG
c) Ausbau LIS im öffentlichen Raum
aa) Baurechtliche Einordnung
bb) Konzessionsrechtliche Einordnung
cc) Bundesfernstraßengesetz
5. Normung und Standardisierung
a) Ladepunkt
b) Ladesteckvorrichtungen
aa) Europäischer Standard
aaa) Energieseitige Ladesteckvorrichtungen
bbb) Fahrzeugseitige Ladesteckvorrichtungen
bb) Internationale Stecker
c) Sicherheit der elektrischen und elektronischen Systeme
6. Akustische Signale im Betrieb
7. Batteriegesetz
8. Förderung
a) Umweltbonus
b) Evaluierung Umweltbonus
c) Förderprogramm für privates Laden
III. Fazit Kapitel E.
F. Wirtschaftlicher Einfluss auf den Marktanteil
I. Wirtschaftliche Auswirkungen der Elektromobilität
1. Theoretische Grundlagen Geschäftsmodell
a) Gestaltung des Geschäftsmodells für Elektromobilität
b) Wertschöpfungskette für die Elektromobilität
2. Auswirkungen für die Geschäftsmodelle entlang der Wertschöpfungskette
a) Hersteller
aa) Strategieausrichtung der Hersteller
aaa) Unsicherheit in der Strategieausrichtung
bbb) Zeitpunkt des Markteintritts deutscher OEMs
ccc) Auswirkungen für die Beschäftigten der OEMs
bb) Forschung und Entwicklung bei BEVs
aaa) Kosten und Gewinnstruktur
bbb) Kooperationen und Zusammenschlüsse
cc) Fahrzeugproduktion
aaa) Wettbewerber der OEMs
bbb) Wertschöpfungserweiterung
dd) Vertrieb und Aftersales
aaa) Vertrieb
bbb) Aftersales
b) Zulieferer
c) Händler
d) Tankstellen
e) Werkstätten
II. Elektromobilität und deren Absatz
1. Verbraucher
a) Faktoren beim Autokaufprozess
b) Zielgruppe
c) Einsatzmöglichkeiten
2. Verbraucheransprache durch OEMs
a) Produkt
aa) Produkteigenschaften für den Erfolg von BEVs
bb) Fahrzeugangebot
aaa) Ausrichtung an Kundenbedürfnisse
bbb) Ladeinfrastruktur und Reichweite
b) Preis
aa) Kosten des BEVs
aaa) Energiepreise
bbb) Batteriekosten
ccc) Total Cost of Ownership
bb) Preisbereitschaft der Kunden
aaa) Reichweite
bbb) Varianten zur Kaufpreissenkung
ccc) Dilemma der Preisbildung
cc) Preissetzung und Kaufprämie
c) Vertrieb
aa) Bisherige Vertriebsstruktur
bb) Sonderfall Tesla
cc) Beratungsbedarf bei Innovationen
dd) Motivation der Absatzpartner
ee) Potenzielle Strategien zur Vertriebsoptimierung
d) Kommunikation
aa) Bisherige Kommunikationsstrategie
bb) Kommunikation bei Innovationen
cc) Inhalt der Marketingkommunikation
dd) Berührung mit BEVs
aaa) Staatliche Initiative
bbb) Unternehmerische Initiative
ee) Gestaltung Marketingkampagne
III. Fazit Kapitel F.
G. Erfolgsfaktorenforschung
I. Was ist der Erfolg der Elektromobilität
1. Integration in bestehende Modelle
2. Ableitung Erfolgsfaktoren
II. Zusammenfassung
III. Limitation und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Methodischer Überblick EFF
10
Abbildung 2:
Struktur des PIMS-Modell
14
Abbildung 3:
Modell Steinmann/Schreyögg
15
Abbildung 4:
Übersicht Erfolgsfaktoren für Produkte
18
Abbildung 5:
Identifikation der EF für die Elektromobilität
19
Abbildung 6:
Ergänzung Steinmann/Schreyögg durch Cooper
20
Abbildung 7:
Treiber der Elektromobilität
26
Abbildung 8:
Klimapolitische Richtlinien EU
33
Abbildung 9:
Vereinfachter Aufbau Elektrofahrzeuge
46
Abbildung 10:
Lademöglichkeiten im Überblick
83
Abbildung 11:
Einnahmen und Ausgaben AC-Ladesäule
99
Abbildung 12:
Überblick Kapitel C. Technische Grundlagen
106
Abbildung 13:
Einordnung des Innovationsobjekts
111
Abbildung 14:
Einstufung des Innovationsgrads der Elektromobilität nach Billing
114
Abbildung 15:
Technology Acceptance Model
119
Abbildung 16:
Akzeptanzmodell mit externen Einflüssen übertragen auf die Elektromobilität
120
Abbildung 17:
Entscheidungsprozess beim Kauf einer Innovation
124
Abbildung 18:
Einflussfaktoren der Adoption von Innovationen
124
Abbildung 19:
Erfolgsfaktoren einer Innovation
125
Abbildung 20:
Kategorisierung von Adoptoren
127
Abbildung 21:
Überblick Kapitel D. Status quo und Ursachen
130
Abbildung 22:
Überblick „punktuelles Aufladen“ § 4 LSV
170
Abbildung 23:
Überblick Inhalt § 5 LSV
172
Abbildung 24:
Überblick Ladesteckverbindungstypen und Anschlüsse bei öffentlicher LIS
199
Abbildung 25:
Überblick Kapitel E. Juristischer Einfluss auf den Marktanteil
211
Abbildung 26:
Überblick Steuerung der Aktivitäten
217
Abbildung 27:
Unterschied Pull- und Push Angebote
218
Abbildung 28:
Wertschöpfungskette Automobilindustrie
222
Abbildung 29:
BEV-Zielgruppen nach Diffusionsgeschwindigkeit
254
Abbildung 30:
Nutzergruppen und priorisierte Eigenschaften des BEVs
255
Abbildung 31:
Dilemma der Preisbildung
274
Abbildung 32:
Überblick Kapitel F. Wirtschaftlicher Einfluss auf den Marktanteil
288
Abbildung 33:
Zusammenhang quantitative und qualitative Faktoren
293
Abbildung 34:
Erfolgsfaktoren Cooper für Elektromobilität
295
Abbildung 35:
Erfolgsfaktoren der Theorienanalyse
297
Abkürzungsverzeichnis
A
Ampere
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
AC
Wechselstrom
(engl. alternating current)
ACEA
European Automobile Manufacturers Association
a.F.
alte Fassung
Art.
Artikel
ASS
Feststoffakku
(engl. All Solid State)
ASM
Asynchronmaschine
Aufl.
Auflage
BAFA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BattG
Gesetz zur Neuregelung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für Batterie und Akkumulatoren
BEV
Batterie-elektrisches Fahrzeug
(engl. Battery-Electric-Vehicle)
BMS
Batterie-Management-System
BRD
Bundesrepublik Deutschland
bspw.
Beispielsweise
ca.
circa
CCS
Combined Charging System
CFK
Kohlefaserverstärkte Kunststoffe
cm3
Kubikzentimeter
CmHn
Kohlenwasserstoffe
CNG
Erdgas
(engl. Compressed Natural Gas)
CO
Kohlenstoffmonoxid
CO2
Kohlenstoffdioxid
CO2e
CO2-Äquivalent
CO4
Methan
CoC
Certificate of Conformity
DC
Gleichstrom
(engl. direct current)
DSRITB
Tagungsband Deutsche Stiftung für Recht und Informatik
EEF
Empirische Erfolgsfaktorenforschung
EEG
erneuerbare-Energien-Gesetz
engl.
Englisch
EnEV
Energieeinsparverordnung
EnGW
Energiewirtschaftsgesetz
EStG
Einkommenssteuergesetz
et
Zeitschrift „Energiewirtschaftliche Tagesfragen“
et al.
et alteri/ et alii
etc.
et cetera
EU
Europäische Union
EmoG
Elektromobilitätsgesetz
EnergieStG
Energiesteuergesetz
f.
folgende
FCEV
Brennstoffzellenfahrzeug
(engl. Fuel Cell Electric Vehicle)
FCV
Brennstoffzellenfahrzeug
(engl. Fuel Cell Vehicle)
ff.
fortfolgende
FSM
fremd erregte Synchronmaschine
FVK
Faserverstärkte Kunststoffe
F&E
Forschung und Entwicklung
GFK
Glasfaserverstärkte Kunststoffe
HE
Hochenergie-Batterien
(engl. High Energy Batteries)
HEV
Hybridfahrzeuge
(engl. Hybrid Electric Vehicle)
HKW
halogenisierte Kohlenwasserstoffe
HOAI
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HP
Hochleistungs-Batterien
(engl. High Power Batteries)
Hrsg.
Herausgeber
IAB
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
ICCB
In-Kabel-Kontrollbox
(engl. In-Cable-Control-Box)
ICEs
Verbrennungsfahrzeuge
(engl. Internal Combustion Engines)
ICEV
Verbrennerfahrzeug
(engl. Internal Combustion Engine Vehicle)
ISO – Norm
Norm der Internationalen Organisation für Standardisierung
KBA
Kraftfahrt-Bundesamt
KfZ
Kraftfahrzeug
Km
Kilometer
km/h
Kilometer pro Stunde
kW
Kilowatt
kWh
Kilowattstunde
l
Liter
LCA
Life-Cycle-Assessment
LiFePO4
Lithium-Eisen-Phosphat Technologie
LIS/LI
Ladesäuleninfrastruktur
LPG
Flüsiggas
(engl. Liquified Petroleum Gas)
LSV
Ladesäulenverordnung
MIV
Motorisierter Individualverkehr
N&R
Zeitschrift „Netzwirtschaften und Recht“
NEFZ
Neuer Europäischer Fahrzyklus
NdFeB
Neodym-Eisen-Bor
N2O
Lachgas
NOx
Stickstoffoxide
NPE
Nationale Plattform Elektromobilität
NPM
Nationale Plattform Zukunft Mobilität
Nr.
Nummer
OEM
Originalausrüstungshersteller
(engl. Original Equipment Manufacturer)
PAngV
Preisangabenverordnung
PEMFC
Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle
PEVs
Plug-in Elektrofahrzeuge
(engl. Plug-in Electric Vehicle)
PHEV
Plug-In-Hybridfahrzeug
(engl. Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
PLC
Powerline Kommunikation
(engl. Power Line Communication)
PM
Feinstaub
(engl. Particulate matter)
Pkw
Personenkraftwagen
PSM
Permanenterregte Synchronmaschine
REEV
Batterie-elektrisches Fahrzeug mit Reichweitenverlängerung/Range Extender
(engl. Range Extended Electric Vehicle)
RFID
Identifizierung mittels elektromagnetischer Wellen
(engl. radio frequency identification)
RL
Richtlinie
S.
Seite
StVZO
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung
Smart Grid
Intelligente Stromnetze
Tab.
Tabelle
TCO
Total Cost of Ownership
V
Volt
VDE
Verband deutscher Elektrotechniker
usw.
und so weiter
Wh/kg
Stundenwatt pro Kilogramm
z.B.
zum Beispiel
ZEV
emissionsfreie Fahrzeuge
(engl. Zero Emission Vehicle)
A. Einleitung
In Deutschland ist der Verkehr wesentliche Grundlage des Wohlstandes, der Wirtschaft und Gesellschaft. Mobilität ist elementar für den Handel und dient gleichzeitig in individueller Form als Luxusgut für alle Bürger. Wirtschaftliches Wachstum, Export und der Erhalt von Arbeitsplätzen werden eng mit dem Verkehr verbunden. Daher wird einer nachhaltigen und langfristig zukunftsfähigen Mobilität politisch und teilweise gesellschaftlich große Bedeutung beigemessen.1
Derzeit befindet sich der Individualverkehr im größten Transformationsprozess seit der Erfindung des Automobils. Klimaschutz2, neue Technologien und der Wandel der Wettbewerbsstruktur3 sowie die veränderten Mobilitätsbedürfnisse4 und die Urbanisierung5 in einem globalen Umfeld6 sind die großen Herausforderungen für die automobile Zukunft.7 Jeder Einzelne ist von den Auswirkungen tangiert und wird zumindest unmittelbar gezwungen sein Mobilitätsverhalten zu überdenken.8 Die Ursachen des Wandels sind vielfältig, sowohl Klima- und Gesundheitsschutz als auch der technische Fortschritt und die Digitalisierung sowie strukturelle Veränderungen, wie Beschränkungen für Verbrennungsmotoren9 oder Forderungen nach Quoten für Elektrofahrzeuge, fördern den Prozess.10 Profund und divers sind die Veränderungen, mangelhafte Infrastruktur und die gewohnten Verhaltensmuster der Verkehrsteilnehmer11 stellen neben zahlreichen anderen Faktoren große Barrieren im Umbruch dar.12
Die letzte historische Initiative zur Etablierung von Elektrofahrzeugen wurde in Deutschland in den 1990er Jahren unternommen und aus wirtschaftlichen Restriktionen durch zu teure Batterien sowie technologische Defizite mittels zu kurzer Reichweiten wieder eingestellt.13 Aktuell ist eine andere öffentliche Motivation in Bezug auf die Elektromobilität und deren Marktdurchdringung zu beobachten, obwohl wirtschaftliche und rechtliche Limitationen auch heute bestehen.
Der zentralen geopolitischen Herausforderung der Ressourcenknappheit steht die innovative Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten für den Fortbestand der individuellen Mobilität als Lösungsansatz gegenüber.14 Der weltweite Trend zeigt, dass die nachhaltige Mobilität und der Klimaschutz auf großes Interesse und Handlungsbereitschaft stoßen. Dies wird von der Politik erkannt und aufgegriffen, als potenzielle Antwort gilt derzeit die Elektromobilität.15 Ein starker energie- und industriepolitischer Fokus zur Förderung des Elektroverkehrs ist beispielsweise durch Subventionen, Umweltauflagen für Emissionen oder in der Förderung des Ausbaus der Infrastruktur erkennbar.16 Diese Motivation in Kombination mit der juristischen Umsetzung ermöglicht neben der Einhaltung umweltpolitischer Ziele den Anstoß technischen Fortschritts eines bedeutenden deutschen Wirtschaftszweiges. Eine nachhaltige Entwicklung der elektrischen Mobilität scheint zunächst wahrscheinlich.
Die Innovationsanstrengungen im Bereich der Elektromobilität zeigen, dass die deutsche Automobilindustrie die Elektromobilität als Zukunftstechnologie erkannt hat und großes Marktpotenzial darin sieht. Die letzte Bundesregierung rief das Ziel aus, Deutschland soll sich zum Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität etablieren.17 Aktuell ist China der Leitmarkt für Elektromobilität, sowohl in der Modellvielfalt als auch in der Nachfrage ist das Land unter den Spitzenreitern.18 Damit ist auch im internationalen Kontext noch ein großes Entwicklungspotenzial für die deutsche Industrie und vor allen Dingen die Nachfrage der Konsumenten zu erkennen.
Obwohl die zugelassenen Fahrzeuge deutscher Hersteller teilweise weniger CO2 produzieren als die einiger Importeure,19 sind vor allen Dingen asiatische und ein amerikanischer Hersteller sehr stark in der Entwicklung alternativer Antriebsformen. Die Elektromobilität versetzt die deutschen Hersteller unter Handlungsdruck, um im Vergleich zu anderen OEMs nicht den Marktzugang und damit den Anschluss zu verlieren. Fraglich ist jedoch in diesem Zusammenhang auch, ob die Elektromobilität mit der uns bekannten Technologie der Energiespeicherung in einer Batterie mit all ihren Vor- und Nachteilen die richtige Lösung ist, oder ob andere technische Antriebs- und Speicherformen wie beispielsweise die Brennstoffzelle eine Alternative darstellen. Offensichtlich ist, dass sich eine Technologie durchsetzen wird, wenn sie in Anbetracht der Nachteile den Nutzer von den jeweiligen Vorteilen überzeugen kann.
1
Boesche et al. (2013)/
Beyer
, S. 2; Europäische Kommission, S. 4.
2
Berger (Hg.), S. 43;
Gottschalk
/Kalmbach, S. 25ff.
3
Gottschalk
/Kalmbach, S. 10ff.
4
Proff/Fojcik/
Zingrebe/Stephan/Lorenz
, S. 49.
5
Strathmann, S. 25.
6
Schwedes/
Rammler
, S. 35f.
7
Schwedes/
Kollosche,
S. 460.
8
Schwedes/
Petersen/Reinert,
S. 468.
9
Wallentowitz/Freialdenhoven, S. 16f; Boesche et al. (2013)/
Beyer
, S. 3; Europäische Kommission, S. 15f.
10
Song, S. 171ff.
11
Strathmann, S. 25.
12
Lorentz et al., S. 1f.
13
Keichel et al./
Schwedes
, S. 69; Berger et al., S. 59.
14
Keichel et al./
Schwedes
, S. 69.
15
Wolf, S. 9ff; Josipovic/Nagl, S. 7.
16
Peters et al., S. 118f.
17
Kers, 187; Josipovic/Nagl, S. 15.
18
Rottmann et al., S. 38f.
19
Ebel/Hofer/
Koers
, S. 180.
I. Relevanz der Thematik
Vor dem Druck umweltpolitischer Auflagen, dem Klimawandel und limitierter fossiler Ressourcen werden alternative Antriebsformen gefordert und deren Entwicklung sowie Marktdurchdringung auf unterschiedliche Weisen gefördert. Sowohl politische Abkommen als auch gesetzgeberische Verordnungen verfolgen das Ziel der erfolgreichen Etablierung elektrischer Mobilität im Individualverkehr.20 Der Erfolg wird darin gesehen, dass Elektrofahrzeuge den Massenmarkt durchdringen und der Anteil der Fahrzeuge gesteigert wird, ohne dass der elektrische Antrieb in kurzer Zeit von einer anderen Technologie abgelöst wird.
Auf den ersten Blick scheinen die Vorteile der Elektromobilität im Bereich des Fahrerlebnisses durch eine ungewohnte Beschleunigung sowie der umweltschonenden und lokal emissionsfreien Antriebstechnologie zu liegen. In Kundenbefragungen ist die Wahrnehmung jedoch oftmals eine andere, selten werden diese beiden Aspekte als Vorteile der Elektromobilität genannt.21 Fraglich ist worin dafür die Ursache zu sehen ist, sicherlich sind nicht ausschließlich mangelndes Marketing oder fehlendes Kundenerlebnis kausal dafür verantwortlich.
In der Betrachtung des Status quo der Elektromobilität stellt sich im Umkehrschluss die Frage welche Faktoren den Erfolg der Elektromobilität hemmen, wie die Marktdurchdringung aktuell verläuft und was die Determinanten des Erfolgs überhaupt darstellen. Sowohl die Ursachen der derzeitigen Situation gilt es zu untersuchen, als auch Auswirkungen und Potenziale zu eruieren. Aufgrund der aktuellen Betrachtung ist es fraglich, welche Faktoren für den Erfolg der Elektromobilität notwendig sind bzw. welche Veränderungen die Elektromobilität zum Erfolg führen können. Maßgeblich darüber entscheiden werden die Kunden, denen das Produkt und die zugrunde liegende Technik für den alltäglichen Gebrauch zusagen müssen. Durch den elektrischen Antrieb weisen die Fahrzeuge einige Merkmale auf, die den Einsatz sowie das Fahrgefühl stark verändern. Dies hat beispielsweise Auswirkungen auf das Laden der Batterien, den Ausbau privater Lademöglichkeiten sowie die zur Verfügungstellung von öffentlicher Ladeinfrastruktur, das Stromnetz und die Energie, die vorhanden sein muss, um einen Erfolg der Elektromobilität zu realisieren. Es ist daher nur ein Teil des Erfolgs der Elektromobilität ein attraktives Produkt zu entwickeln, dass im Marketing, Vertrieb und in der Kommunikation wirtschaftlich überzeugt. Die Infrastruktur ist grundlegend für den Erfolg, ebenso ist die Wahrnehmung des technischen Fortschritts des Fahrzeugs zentral, um die Umstellung auf Elektrofahrzeuge so angenehm wie möglich zu gestalten und die Kunden vom Produkt des Elektrofahrzeugs zu überzeugen. Zusätzlich wird der Erfolg von den gesetzgeberischen Rahmenbedingungen geleitet, deren Einfluss es zu untersuchen gilt. Besonders interessant erscheint es dabei die Wirkmechanismen bestehender Regelungen und Gesetze zu verstehen sowie deren zukünftige Ausrichtung und Wirkung auf den Erfolg der Elektromobilität zu antizipieren.
Alle Betrachtungen schließen, entsprechend der Untersuchungskriterien, den aus Sicht des Autors aktuellen Stand bis Frühjahr 2023 ein, neuere Entwicklungen dieses von zahlreichen Änderungen geprägten Themas wurden in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt.
20
Zentrum Wasserstoff.Bayern; S. 7ff.
21
Kairies, S. 10ff.
II. Forschungsstand und Forschungslücke
In der bestehenden Forschung zur Elektromobilität gibt es verschiedene Strömungen. Ein Teil befasst sich hauptsächlich mit dem technischen Aufbau und der Funktionsweise von Elektroautos. Sehr bekannt ist in diesem Bereich beispielsweise Kampker, der sowohl die Grundlagen der Funktionsweise22 als auch der Elektromobilproduktion23 liefert, ferner auch Karle24, der aktualisierte Auflagen seiner überwiegend technischen Übersicht publiziert. Zu diesem Bereich werden auch die generellen Werke zu Chancen alternativer Antriebe, den Einflussfaktoren, die deren Entwicklung vorantreiben, sowie die wirtschaftliche Bewertung der Möglichkeiten gezählt, beispielsweise von Bertram und Bongard.25 Die beiden Autoren versuchen mit Fallstudien und unterschiedlichen Szenarioanalysen eine Bewertung der Alternativen abzugeben und damit einen Zukunftsausblick zu skizzieren. Ebenso diesem Bereich angehörig ist Füßel, der in seinem Werk eine technische Potenzialanalyse vornimmt und BEVs stark mit der ICEV Technologie vergleicht und Möglichkeiten sowie Defizite beider Technologien mit einem elektromobilen Fokus aufzeigt. Hier finden auch Optimierungsmöglichkeiten alternativer Batteriezusammensetzungen Beachtung.26
Andere Forschungsansätze untersuchen die Genese der Elektromobilität und die Gründe des historischen Scheiterns. Exemplarisch kann hier Wolf27 genannt werden, der etwa eine Beschleunigung des Klimawandels durch die negativen Auswirkungen der Elektromobilität sieht. Jedoch gibt es auch Ergebnisse zu der bestehenden Nutzung von Elektrofahrzeugen und deren Analyse von Nutzergruppen sowie den Problemfeldern im Alltagsgebrauch.
Weitere Forschungsströmungen untersuchen die Akzeptanz der Elektromobilität, die mitunter bekannten Vertreter sind hier Fazel28 und Dudenhöffer29. Den Übergang zur Elektromobilität aus Managementperspektive der OEMs, wird insbesondere von Proff30 und Co-Autoren in den Fokus gestellt.
Einen ganzheitlicheren Überblick über die Möglichkeiten, den Stand sowie die Technik der Elektromobilität bieten Lienkamp31 oder Wallentowitz und Freialdenhoven.32 Hier wird sowohl ein Überblick über die chemischen Batteriezusammensetzungen als teilweise auch über die Alternativen der Elektromobilität gegeben. Daraus leiten sich elektromobile Charakteristika wie die Reichweite, Nutzen, Kundensicht und eine Zielgruppe ab. Ein breiter Ausblick über die damit verbundenen Herausforderungen für die Hersteller und mögliche Strategien schließt bei Lienkamp an. Darüber hinaus gibt er einen Überblick über die derzeitige Marktentwicklung der jeweiligen OEMs sowie den Autobauern konkrete Empfehlungen. In seinen früheren Forschungsergebnissen schneidet Lienkamp auch die Förderungspolitik der Elektromobilität an und betont deren Einsatz auf dem Weg zum Erfolg der Elektromobilität. Dennoch beziehen sich je nach Auflage alle Forschungsergebnisse auf einen Teilbereich und sind somit als partiell begrenzt anzusehen.
Darüber hinaus ist es charakteristisch für die Elektromobilität, dass sich aufgrund der technischen Agilität und Innovation ein Großteil der Informationsbeschaffung auf die aktuellen Pressemeldungen und fachlichen Nachrichtenportale stützt.33 Die Aktualität des Themas kann in der Wissenschaft bislang nur in Teilen dargestellt werden und gibt stets einen bestimmten, eingegrenzten Schwerpunkt wieder.
Da bislang in der Wissenschaft in Bezug auf die Elektromobilität einzelne Bereiche wie beispielsweise die Infrastruktur34 oder das Fahrzeug in Kombination mit der Batterie35 oder die angrenzenden Dienstleistungen36 behandelt wurden, wird in dieser Arbeit angestrebt eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen und die etablierten Themen zu kombinieren sowie um die Erfolgsfaktorenforschung zu ergänzen.
Dieser Anspruch des Verständnisses von Treibern der Entwicklung, Technik sowie Charakteristika von Elektrofahrzeugen, der Funktionsweise von Batterien und deren chemischer Zusammensetzung der Lithium-Ionen-Technologie, dem aktuellen Status quo und den Ursachen ist in dieser Form neuartig.
Eine Besonderheit dabei ist die juristische und die wirtschaftliche Betrachtung, eine Übersicht über die deutschen gesetzlichen Vorgaben sowie die Klärung der Legitimation des staatlichen Eingriffs.37 Die Kombination aus rechtlichen Einflussfaktoren und deren Wirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg der Produkte der Elektromobilität bildet den interdisziplinären Charakter der Arbeit. Dabei wird der Versuch unternommen die betriebswirtschaftliche Perspektive mit der juristischen Betrachtung zu vereinen, um eine wirtschaftliche Problemlösung zu erarbeiten.
Eine Symbiose aus Rechtsbetrachtung sowie deren Evaluation versprechen im Bereich der Erfolgsfaktorenforschung zielführend zu sein, da einerseits der Erfolg der Maßnahmen bestätigt und andererseits durch kreative rechtliche Lösungsvorschläge der Erfolg der Elektromobilität im wirtschaftlichen Sinne beeinflusst werden kann. Diesen Forschungsschwerpunkt der untersuchenden Evaluation haben in Ansätzen Santos et al.38 Die Zusammenfassung gesetzlicher Vorgaben wurde bislang ebenfalls nur in Teilen bearbeitet, exemplarisch durch die Gesetzgebung im Bereich der Ladeinfrastruktur und der Förderpolitik.39 Die wirtschaftliche Betrachtung mit einer Vorstellung der Auswirkungen für Verbraucher40 sowie die gesamte automobile Wertschöpfungskette von Hersteller bis Werkstätten41 und den Einfluss von Innovationen auf bestehende Geschäftsmodelle schließt daran an.42
Ein Überblick über die Erfolgsfaktorenforschung und die bestehenden Forschungsansätze ist ein großer Teil der Arbeit, mit deren Hilfe die Forschungsfrage der Erfolgsfaktoren der Elektromobilität beantwortet wird. Die Ansätze liefern die Grundlage für die vielschichtigen Ableitung der Faktoren für die Elektromobilität und damit eine Marktdurchdringung für die Masse der Bevölkerung und zeitgleich einen Erfolg der Elektromobilität zu erreichen. Das Ableiten von entscheidenden Komponenten für den Erfolg eines Produkts stellt daher ebenso ein Novum dar wie die zugrundeliegenden Erfolgsfaktoren der Elektromobilität selbst. Eine Übersicht in Konvergenz aus Wirtschaft und Recht sowie die Integration bestehender Forschung und der Prozess der Maßnahmenselektion für eine erfolgreiche Marktdurchdringung sind zentrale Aussage dieser Forschung.
Dabei werden die forschungsleitenden Teilfragen der wirtschaftlichen sowie der rechtlichen Gestaltung der Rahmenbedingungen auf Grundlage einer Analyse und Bewertung der bestehenden Situation beantwortet. Während der Bearbeitung der zentralen Forschungsfrage der Erfolgsfaktoren der Elektromobilität werden Untersuchungen zu den maßgeblichen Einflussfaktoren einer erfolgreichen Produktpositionierung berücksichtigt, die anhand der bestehenden Forschungsansätze abgeleitet werden.
22
Kampker et al. (2013).
23
Kampker.
24
Karle.
25
Bertram/Bongard.
26
Füßel.
27
Wolf.
28
Fazel.
29
Dudenhöffer, F. (Wirtschaftsdienst 1/2021).
30
Proff/Fojcik; Proff et al. (2016); Proff et al. (2014); Fojcik/Proff.
31
Lienkamp (2012); Lienkamp (2016); Lienkamp/Homm; Lienkamp et al. (2020).
32
Wallentowitz/Freialdenhoven.
33
Automobilwoche; mm; Edison; Schwarzer; Werwitzke; e.on.
34
Gehrlein/Schultes; Mayer/Klein (et 63/2013).
35
Müller et al.
36
Lamberth-Cocca/Friedrich; Ganz et al.
37
Schwedes; Rottmann et al.; Korthauer, Endres.
38
Santos et al. (Research in Transportation Economics 2010/1), Santos et al. (Research in Transportation Economics 2010/2).
39
Frankl-Templ; Dietrich; Tieben; Josipovic/Nagl; Josipovic.
40
Fazel; Keichel et al.; Schwedes; Detholff; Dudenhöffer, F. (Wirtschaftsdienst 1/2021); Proff et al.; Kampker; Rottmann et al.; Garaham-Rowe et al.; Lienkamp.
41
Strathmann; Seeberger; Müller-Stewens; Corsten et al; Wietschel; Kampker et al. (2013); Rottmann et al.; Lienkamp.
42
Strathmann; Müller-Stewens; Göcke; Gassmann/Friesike; Corsten et al; Kampker et al. (2013).
III. Methodisches Vorgehen der Erfolgsfaktorenforschung
Vor dem Hintergrund der Problemstellung sowie der aufgezeigten Forschungslücke und den forschungsleitenden Teilfragen ist die Wahl des methodologischen Vorgehens und der geeigneten Analysetools von großer Bedeutung. Für eine inhaltliche und konzeptionelle Verknüpfung der beiden Themenfelder der Elektromobilität sowie der Erfolgsfaktoren bedarf es im ersten Schritt eines allgemeinen Verständnisses zur Erfolgsfaktorenforschung und des Forschungsprozesses. Darauf aufbauend kann vor dem Hintergrund der zu beantwortenden Forschungsfrage ein arbeitsdefinitorischer Ansatz entwickelt und abschließend auf das Themenfeld der Elektromobilität dem Forschungsdesign entsprechend angewendet werden.
1. Theoretische Basis der Erfolgsfaktorenforschung
Die in der Betriebswirtschaftslehre bekannte empirische Erfolgsfaktorenforschung (EFF) beschäftigt sich als Gegenstand des strategischen Managements überwiegend mit der Erfassung der Schlüsselfaktoren, die zum positiven, übergeordneten Erfolg eines Unternehmens führen.43 Dadurch werden zentrale Einflussgrößen gesucht, die auf Unternehmen anzuwenden sind und zum erwünschten ökonomischen Durchbruch leiten.44 Synonym für den Begriff Erfolgsfaktor werden auch Einflussfaktoren der Umwelt bzw. Unternehmensumgebung, Erfolgsdeterminanten, Erfolgspositionen, Erfolgskomponenten, Wettbewerbsfaktoren oder sogar Kernkompetenzen genannt, die ein Unternehmen zum angestrebtem Erfolg führen.45
Dabei müssen Faktoren gefunden werden, mit denen der Erfolg eines Unternehmens quantifizierbar gemacht werden kann. Beispielsweise ist dies mittels der Kennzahlen Gewinn, Rentabilität, Umsatz oder Marktanteil zu bewerten und zu vergleichen. Damit ist eine Eruierung des Erfolgs sowohl aus unternehmensinterner Perspektive notwendig als auch mit der Analyse des externen Marktumfelds verbunden.46
Teilweise werden in einzelnen Unternehmensbereichen monoperspektivisch einzelne Aspekte fokussiert, die einen Teilbereich einer wirtschaftlichen Institution positiv beeinflussen,47 wie beispielsweise „Dokumentenlogistik als Erfolgsfaktor in deutschen Banken“.48 Diese Betrachtungsweise entspricht jedoch nicht der eigentlichen Bedeutung der Erfolgsfaktorenforschung, nämlich der Schlüsselfaktorenforschung für das gesamte Unternehmen.49
Die Krisenforschung ist der entgegengesetzte Ansatz der Erfolgsfaktorenforschung, denn sie untersucht, durch welche Gründe Unternehmen in eine Misslage gekommen sind. Jedoch zeichnet sich ein Unternehmen noch nicht als erfolgreich aus, wenn es die negativen Faktoren des Misserfolgs vermeidet.50 Allen Herangehensweisen der EFF gemeinsam ist daher, dass die Faktoren einen Erfolg des Unternehmens herbeizuführen versuchen.51 Sowohl Effektivität als auch Effizienz prägen dabei die EFF.52 Die allgemeingültigen Erfolgsfaktoren sind gezeichnet von einem signifikanten Zusammenhang zwischen Faktor- und Unternehmenserfolg, langfristiger Gültigkeit und der Möglichkeit der Gestaltung des Faktors durch die Unternehmensführung. Der Begriff der kritischen Erfolgsfaktoren ist dabei mit der Bedeutung des Erforschens der maßgeblichen Faktoren gleichzusetzen.53 Ziel der EFF ist es daher, die entscheidenden, kritischen Faktoren zu identifizieren und sie positiv zu beeinflussen, um Erfolgspotenziale zu schaffen und den Untersuchungsgegenstand und damit meist das Unternehmen, langfristig positiv zu entwickeln.54
Die Erfolgsfaktorenforschung spielt in der betriebswirtschaftlichen Forschung schon seit vielen Jahren eine große Rolle und ist aufgrund der verschiedenen Methoden und Forschungsergebnisse begrifflich sowie definitorisch nicht klar einzuordnen. Es gibt zahlreiche klassische Untersuchungsansätze, die sich bereits seit den 1960er Jahren55 mit auftretender Marktsättigung dieser Thematik annahmen und einen wertvollen Grundstein für die weitere Forschung gelegt haben.56 Bei der Übertragung der Faktoren auf andere Unternehmen lässt sich jedoch subsumieren, dass die entdeckten Faktoren entgegen des Anspruchs auf Allgemeingültigkeit stark von den Umwelteinflüssen sowie Marktbedingungen abhängen und damit flexibel sind sowie eine stetige Anpassung erforderlich machen.57
Eine Einordnung der bestehenden Forschung nach der jeweiligen Vorgehensweise der verschiedenen bestehenden Ansätze findet im Anschluss statt. Neben der gängigen Variante der thematischen Einordnung der Konzepte nach deren wissenschaftlicher Herangehensweise differenziert Trommsdorff die EFF nach deren Aussagegehalt.58
43
Steinle et al., S. 9; Mandorf, S. 4.
44
Trommsdorff (1990), S. 1.
45
Müller, S. 7; Mandorf, S. 4.
46
Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 166.
47
Steinle et al., S. 9.
48
Kaiser, S. 1.
49
Steinle et al., S. 9.
50
Mandorf, S. 6.
51
Müller, S. 7.
52
Schmeisser et al./
Steinhoff
, S. 4.
53
Thiem, S. 29.
54
Müller, S. 7.
55
Schmeisser et al./
Steinhoff
, S. 4; Daniel (Harvard Business Review 39/1961), S. 111.
56
Mandorf, S. 6.
57
Mandorf, S. 7.
58
Trommsdorff, S. 3f.
2. Einordnung etablierter Konzepte
Die übliche Systematisierung der EFF-Ansätze wird nach der verwendeten Herangehensweise vorgenommen. Der methodische Überblick (Abb. 1) zeigt die generische Differenzierung im Rahmen der Erfolgsfaktorenforschung. Ähnlich eines Entscheidungsbaums werden Methodik, Ansatz der Untersuchung, Datenerhebung sowie Vorgehen bei der Ermittlung und Einsatz von Erfolgsgrößen unterschieden.
Abbildung 1: Methodischer Überblick EFF59
Eine kurze definitorische Erläuterung der Entscheidungsstufen des methodischen Überblicks vermittelt Verständnis zum allgemeinen methodologischen Vorgehen.
Bei der Methodik werden die Ansätze direkt, qualitativ explorativ, quantitativ explorativ und quantitativ konfirmatorisch unterschieden.
Im quantitativ explorativen Bereich werden Faktoren ermittelt, die einen direkten Zusammenhang oder eine Struktur vermuten lassen, während bei quantitativ konfirmatorischen Methoden bereits Wirkzusammenhänge vorliegen, die mittels gebildeter Hypothesen bestätigt oder abgelehnt werden. Bei dieser Vorgehensweise werden Kausalzusammenhänge ermittelt. Im Vergleich werden also im quantitativ explorativen Bereich Faktoren ermittelt, während im quantitativ konfirmativen Bereich ihre relative Bedeutung gemessen wird.60
Je nach Ansatz der Untersuchung ergibt sich eine explorative oder konfirmatorische Aufteilung. Überwiegend ohne statistische Methoden ermitteln qualitative Untersuchungen weiche, nicht quantifizierbare Faktoren mit explorativem Charakter, hingegen werden in der quantitativen Forschung statistische Auswertungen vorgenommen, die Wirkungszusammenhänge ausfindig machen. Dem zugrunde gelegt ist ein Untersuchungsdatensatz, mit dem die Erfolgsfaktoren und deren jeweiliger Anteil am Unternehmenserfolg mathematisch ermittelt werden.61
Die Wahl der Methodik ist vom Forschungsstand abhängig, der entweder bereits das Bilden von Hypothesen zulässt oder erst grundsätzlich erforscht werden muss. Außerdem ist ein konfirmativer Ansatz nur möglich, wenn der Stichprobenumfang einen Umfang von mindestens 200 Datensätzen aufweist und damit die Aussagefähigkeit gewährleistet wird.62
Im Bereich der Datenerhebung wird zwischen einer qualitativen und quantitativen Erhebung differenziert,63 die Ermittlung kann direkt oder indirekt erfolgen. Während bei einer direkten Ermittlung beispielsweise Expertengespräche stattfinden, bei denen potenzielle Erfolgsfaktoren mittels methodischer und materieller Unterstützung im Gespräch erfragt werden, ist bei indirekten Erhebungen ein Zusammenhang zwischen möglichen Erfolgsfaktoren als unabhängige Variable und dem jeweiligen Erfolg als abhängige Variable zu untersuchen. Es wird also nicht alles auf deren direkte Ursache für den Erfolg untersucht, sondern anhand der Analyse unternehmensinterner und externer Variablen ein Bezug zum Erfolg hergestellt.64
Eine Einordnung kann zusätzlich innerhalb des Einsatzes von Erfolgsgrößen erfolgen, indem zwischen der Analyse von Erfolgen oder Kontrastgruppen, Misserfolgen und einer Gesamtanalyse differenziert wird. Die Analyse von Erfolgen umfasst lediglich eine Betrachtung der erfolgreichen Unternehmen, analog verhält es sich mit der Untersuchung von Misserfolgen. In der Analyse von Kontrastgruppen werden die erfolgreichen Untersuchungsobjekte mit den nicht erfolgreichen verglichen, um relevante Unterschiede und damit Erfolgsfaktoren abzuleiten, während die Gesamtanalyse keine Unterscheidung vornimmt und direkt abgeleitet werden.65
Nachdem ein kurzer methodischer Überblick der EFF gegeben wurde, sollen im Folgenden einzelne Konzepte im Kontext der EFF näher beschrieben werden.
a)HEFAP
Diesem Ansatz ähnelt das Hannoveraner Erfolgs-Faktoren-Projekt (HEFAP), das zwischen der empirischen und theoriegeprägten Herangehensweisen sowie dem Praktikeransatz unterscheidet.66 Kontrollierte Experimente entsprechen den empirischen Ansätzen, theoriegeprägte Analysen den Kausalanalysen und Praktiker finden die Erfolgsfaktoren meist nur durch Zusammenhänge, ohne theoretische Fundierung.67
Bei empirischen Ansätzen sollen allgemeingültige Erfolgsfaktoren ermittelt werden, die in ihrem Forschungsansatz einen Abgleich zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen enthalten.68 Die Untersuchung stellt die Ergebnisse des Vergleichs sowie die Attribute fest, die den Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen ausmachen und somit als Erfolgsfaktoren bezeichnet werden.69
Im Vergleich dazu werden die Erfolgsfaktoren bei theoriegeleiteten Ansätzen durch konzeptionelle Strategien entdeckt.70 Die sogenannten theoretisch-konzeptionellen Ansätze werden von theoretischen Überlegungen bestimmt und durch konzeptionelle Untersuchungen des Vorgehens geleitet.71 Durch das Bilden von Hypothesen, die den Unternehmenserfolg herbeiführen sollen, werden Strategien gebildet, die im Unternehmen angewandt und als Grundlage zur Ableitung von Erfolgsfaktoren dienen. Logisch und plausibel werden die Erfolgsfaktoren aus der Strategie gefiltert, jedoch muss das Wirkungsfeld beachtet werden. Neben der Einzelfallanalyse, in der die Erfolgsfaktoren nur für ein bestimmtes Unternehmen erforscht werden existiert die Normstrategiebildung, welche allgemeine Gesetzmäßigkeiten bei den Erfolgsfaktoren findet.72
Der dritte Ansatz der EFF des HEFAP ist von der Expertise wirtschaftlicher Praktiker geprägt, die aus ihren Erfahrungen Erfolgsfaktoren ableiten und daher auch Alltagstheorien genannt werden.73 Da die Praktiker meist aus der Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfung kommen, ist deren Erfahrung auf einen Bereich oder eine Branche begrenzt. Dennoch sind diese EFF-Ansätze aufgrund der mangelnden theoretischen Herleitung häufig starker Kritik ausgesetzt.74
b)Trommsdorff
Im Gegensatz dazu teilt Trommsdorff in seiner Vorgehensweise die Erfolgsfaktorenforschung nach Spezifität, Präzision und Kausalität ein. Die Spezifität gibt Aufschluss über die Reichweite der Gültigkeit der Faktoren und kann zwischen großer, mittlerer und kleiner Reichweite variieren.75 Diese Einteilung wird bestimmt durch die Wirkung der ermittelten Faktoren und reicht beispielsweise bei großer Reichweite allgemeingültig über alle Branchengrenzen hinweg, während bei mittlerer Reichweite die Allgemeingültigkeit nur auf Unternehmen mit gleichen Produkten und Ähnlichkeiten in der strategischen Ausrichtung beschränkt ist. Die Erfolgsfaktoren kleiner Reichweite dagegen sind auf Unternehmensspezifika limitiert, den konkreten Marktverhältnissen und den individuellen Stärken und Schwächen.76
Die Präzision der Erfolgsfaktoren wird unterschieden in qualitativ und quantitativ. Qualitativen Erhebungen werden meist weiche Erfolgsfaktorenaussagen zugeordnet, die mithilfe des Induktionsschlusses aus spezifischen Aussagen zu allgemein gültigen Zusammenhängen zusammengefasst werden.77 Quantitative Analysen werden zwischen einfach bis komplex-quantitativ unterschieden78 und statistisch ausgewertet. Damit sind Standarderhebungen und eine Normstrategie zugrunde gelegt, an denen mithilfe von Hypothesen Gesetzmäßigkeiten der Erfolgsfaktoren untersucht werden.79
Die Kausalität gibt als letztes Kriterium Trommsdorffs die Ursache-Wirkungszusammenhänge der Erfolgsfaktoren wieder, die im Bereich des Unternehmenserfolges nicht immer eindeutig zuzuordnen sind. Oftmals bestehen dadurch lediglich Vermutungen zur Kausalität, deren Erfolgswirkung mittels Kausalanalysen oder kontrollierter Experimente genauer untersucht werden soll.80
c)Bekannteste EFF-Konzepte für Unternehmen
Unabhängig von der aufgeführten Einteilung werden in diesem Kapitel drei der bekanntesten Forschungsansätze der Erfolgsfaktorenforschung vorgestellt, die zum Teil allgemeingültige Aussagen haben oder bisweilen ausschließlich unternehmensspezifisch sind. Dabei werden im Folgenden exemplarisch alle drei der Systematisierungsansätze der EFF nach HEFAP abgebildet.
aa)PIMS-Studie
Die beiden Autoren Buzzell und Gale werten in dem Langzeit-Datenbankprojekt „Profit Impact of Market Strategies“,81 im sogenannten PIMS-Ansatz durch markt- und wettbewerbsübergreifenden Abgleich unterschiedlicher Unternehmen aus, ob eine strategische Gesetzmäßigkeit bei erfolgreichen Unternehmen existiert.82 Dafür konnten mithilfe einer Regressionsanalyse die Erfolgsfaktoren der Datenbank des Strategic Planning Institute, die dort seit 1972 gesammelt werden ausgewertet und verglichen werden.83 Als Kernaussage lassen sich die Erfolgsfaktoren nach Buzzell/Gale mit einer erfolgreichen Interaktion zwischen Marktstruktur, Wettbewerbsposition und Strategie subsumieren.
Abbildung 2: Struktur des PIMS-Modell84
Konkret wurden 37 erfolgskritische Faktoren identifiziert, die zu sieben Haupteinflussgrößen verdichtet wurden. Dazu zählt die Attraktivität des Marktes, die Stärke der Wettbewerbsposition, die Investitionsintensität, die Produktivität, die Innovation als Abgrenzung zu Konkurrenten, die Produktqualität und die vertikale Integration.85 Untersuchungsgegenstand ist dabei unter anderem die Wirkung mittels verschiedener Einflussfaktoren wie beispielsweise den Marktanteil auf den ROI.86 Dieses Modell ist eindeutig den empirisch orientierten Forschungsansätzen zuzuordnen87 und liefert allgemeingültige Ergebnisse, da sich die Erfolgsfaktoren alle auf die Referenzgröße des Return on Investment (ROI) beziehen. Die Erfolgsfaktoren sind jedoch eher als Trends zu verstehen, denn sie variieren stark mit der Größe des Unternehmens, der Branche und dem jeweiligen Umfeld.88 Kritiker bemängeln neben fehlenden Ursache-Wirkungsstrukturen89 die Untersuchung ausschließlich harter Ergebnisfaktoren, die keinen Rückschluss auf weiche Einflüsse zulassen. Außerdem wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der amerikanischen Datenbank auf internationale Märkte angezweifelt und mangelnde Kausalzusammenhänge bei vorliegenden Korrelationen stehen in der Kritik.90 Dennoch ist diese Studie die meist zitierte im Zusammenhang mit der Erfolgsfaktorenforschung und hat den Weg zum Praxiseinsatz für Manager und Unternehmen geebnet.91
bb)Steinmann/Schreyögg
Der Forschungsansatz von Steinmann und Schreyögg ist in der Praxis der Unternehmensführung bekannt und beschäftigt sich mit der strategischen Ausrichtung von Unternehmen.92 Die beiden Autoren gehen mittels Prozessanalyse vor und ermitteln damit Erfolgsfaktoren.
Abbildung 3: Modell Steinmann/Schreyögg93
Dabei findet ähnlich einer SWOT-Analyse sowohl die Analyse der Umwelt als auch des Unternehmens statt.94 Die Umweltanalyse des Unternehmens im Bereich des Markts lehnt sich an die fünf Wettbewerbskräfte von Porter an, im globalen Umfeld werden sozio-kulturelle, rechtlich-politische, makroökonomische und technologische sowie ökologische Faktoren begutachtet.95 Daran schließt die Analyse des Unternehmens an: Zur Ermittlung bestehender Stärken und Schwächen wird unternehmensintern die Wertschöpfungskette als ressourcenzentrierte Perspektive herangezogen, die kundenzentrierte Perspektive erfolgt durch die Analyse des Preises, des Produkts, der Werbung und des Vertriebs.96 In einem dritten Schritt werden strategische Optionen erarbeitet. Dazu werden Szenarioanalysen herangezogen, welche Steinmann/Schreyögg als ein Merkmal junger Branchen, in Anlehnung an Porter97 empfehlen. Als ein Merkmal junger Branchen ist die Unternehmensanalyse in Verbindung mit der globalen Betrachtung teilweise nur sehr schwer vorhersehbar, was ein breites Spektrum an spekulativen Entwicklungsmöglichkeiten bietet.98 Damit ist deutlich, dass es sich bei der Vorgehensweise um eine Einzelfallanalyse handelt und keine allgemeingültige Normstrategie zugrunde gelegt wird.99
Nach einer Bewertung der Alternativen soll eine strategische Wahl getroffen werden, an die eine Strategieumsetzung anschließt. Die strategischen Maßnahmen werden in einem Programm konkretisiert, bevor sie in der Realität umgesetzt werden und eine Strategiekontrolle helfen soll, die Maßnahmen zu kontrollieren.100
Dieser abstrakte Erfolgsfaktorenansatz von Steinmann/Schreyögg ist auf Plausibilitätsüberlegungen gestützt und entbehrt empirische Elemente. Kritisiert werden beispielsweise Limitierungen im Bereich der strategischen Wahl sowie die eingeschränkte Praxistauglichkeit.101
cc)In Search of Excellence
Einige Ansätze wurden durch Versuche oder Beobachtung einiger Unternehmen einer Branche identifiziert, die dann auf ein allgemeines Schema von Erfolgsfaktoren für alle Unternehmen übertragen wurden. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Vorgehensweise sind Peters und Watermann mit „Search of Excellence“.102 Kritisiert wurde dieser Ansatz häufig für die populärwissenschaftliche Vorgehensweise, jedoch konnten hier erstmals Problemfelder von Unternehmen identifiziert werden.103 Die Spezifität des Modells ist nach Trommsdorff gering104: Während die harten Faktoren quantitativ zu ermitteln sind, existieren weiche Faktoren, die qualitative Merkmale abbilden und nur schwer messbar sind.105 Die harten Faktoren beinhalten die Beeinflussung der Umweltbedingungen mittels einer Strategie, die Struktur des Unternehmens und die Geschäftsprozesse sowie zugrundeliegenden Systeme. Die weichen Faktoren werden von der Unternehmenskultur, dem Personalwesen, den Kernkompetenzen und dem Werteselbstverständnis des Unternehmens gebildet.106
Die Kausalität der Untersuchung ist ebenfalls lediglich schwach ausgeprägt, da keine Kontrastgruppen gebildet, sondern nur erfolgreiche und erfolglose Fälle dargestellt wurden.107 Nach der mangelnden theoretischen Fundierung wird dieses Modell den Praktikeransätzen zugerechnet.108
d)EFF für Produkte nach Cooper
Im Vergleich zu den bislang vorgestellten Forschungsansätzen der Erfolgsfaktoren für Unternehmen beschäftigt sich der Kanadier Cooper, der einer der bekanntesten EFF-Forscher ist, überwiegend empirisch mit dem Erfolg von innovativen Produkten.109 In seinen Forschungsergebnissen aus den 70er und 80er Jahren beispielsweise sind zentrale Themen der Misserfolg innovativer Artikel,110 der Einfluss der Entwicklung neuer Konsumgüter und dessen Launch auf deren Erfolg111 oder die konkreten Erfolgsfaktoren für neue Produkte.112
Demnach entscheiden nach seiner NewProd Studie elf Faktoren über den Erfolg eines neuen Produktes, nämlich dessen Einzigartigkeit und Überlegenheit, große Marktkenntnis des einzuführenden Unternehmens113 und exzellentes Marketingwissen sowie Synergieeffekte in Produktion und Technik bei einer moderaten Marktdynamik mit möglichst wenig neuen Produkteinführungen. Erfolgreicher sind neue Produkte zudem bei einer hohen Marktnachfrage in einem wachsenden Markt. Daneben können Produkte wirksam eingeführt werden, wenn sie ausschließlich hochpreisig bei zeitgleich hohen Gewinnmargen eingeführt werden, gute firmeninterne Management- und Marketingunterstützung erfahren, kein Markteintritt bei Wettbewerbern mit zufriedenen Kunden stattfindet, eine starke Marketingkommunikation und eine gut geplante Markteinführung gelingt. Besonderes Erfolgspotenzial haben außerdem marktgetriebene Innovationen mit hohem Investitionsbedarf,114 wenn sie auf ein hohes Marketingbudget zurückgreifen können, einen hohen Nutzenvorteil generieren und zugleich produktions- sowie firmeneigene Produktsynergien bestehen.115 Die wichtigsten Erkenntnisse sind jedoch, dass ein einzigartiges Produkt mit für den Kunden unvergleichbarem Nutzenvorteil positiven Einfluss auf den Erfolg hat, ebenso wie gute Marktkenntnis und Marketingkompetenz sowie technologische und produktionstechnische Synergieeffekte.116 Keinen Einfluss hat gemäß dieser Untersuchung der strategische Vorteil, das Produkt als erster am Markt zu etablieren, die Vorbereitungsintensität für den Markteintritt, ein großer Mitbewerber sowie die Kenntnis neuer Produktionskompetenzen.117 Diese Studie war Grundlage für weitere Forschungsprojekte von Cooper, in denen die Erkenntnisse bestätigt wurden und insbesondere der Einfluss des Innovationsprozesses in seiner Bedeutung hervorgehoben wurde.118
Eine Zuordnung der elf Erfolgsfaktoren für Produkte nach Cooper wurde in dieser Arbeit nach Markt und Unternehmen vorgenommen.
Abbildung 4: Übersicht Erfolgsfaktoren für Produkte119
59
Schmalen et al., S. 4; Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 168; Wolff/Herrmann/Niggemann (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1+2/2004), S. 263.
60
Schmalen et al., S. 6; Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 168f.
61
Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 168; Schmalen et al., S. 5.
62
Schmalen et al., S. 6.
63
Wolff/Herrmann/Niggemann (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1+2/2004), S. 263.
64
Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 167; Schmalen et al., S. 5.
65
Schmalen et al, S. 4.
66
Steinle et al., S. 34.
67
Mandorf, S. 12; Steinle et al., S. 16f.
68
Steinle et al., S. 17; Mandorf, S. 13.
69
Steinle et al., S. 17.
70
Steinle et al., S. 17.
71
Böing, S. 20.
72
Mandorf, S. 15.
73
Thiem, S. 33; Mandorf, S. 18.
74
Mandorf, S. 18.
75
Trommsdorff (1990), S. 15; Mandorf, S. 8f.
76
Steinle et al., S. 16.
77
Mandorf, S. 8ff.
78
Trommsdorff (1990), S. 15f.
79
Mandorf, S. 10.
80
Mandorf, S. 10f; Trommsdorff (1990), S. 16f.
81
Trommsdorff, S. 11; Homburg/Krohmer, S. 431.
82
Steinle et al., S. 24; Buzzell/Gale, S. 3.
83
Buzzell/Gale, S. 3; Thiem, S. 18; Homburg/Krohmer, S. 431.
84
Buzzell/Gale, S. 25; Thiem, S. 56; Steinle et al.; S. 25.
85
Steinle et al., S. 25f; Thiem, S. 56.
86
Mandorf, S. 14.
87
Steinle et al., S. 17; Mandorf, S. 12f.
88
Mandorf, S. 9.
89
Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 167.
90
Steinle et al., S. 27.
91
Schmalen et al., S. 1.
92
Steinmann/Schreyögg, S. 167ff; Mandorf, S. 16.
93
Steinmann/Schreyögg, S. 172; Steinle et al., S. 22; Mandorf, S. 16f.
94
Mandorf, S. 16.
95
Steinmann/Schreyögg, S. 178; Steinle et al., S. 21; Mandorf, S. 16.
96
Steinle et al., S. 21f; Mandorf, S. 16.
97
Porter, S. 295f.
98
Steinmann/Schreyögg, S. 187.
99
Steinle et al., S. 22.
100
Steinle et al., S. 22ff; Steinmann/Schreyögg, S. 174f.
101
Steinle et al., S. 24.
102
Mandorf, S. 6; Peters/Watermann.
103
Mandorf, S. 6.
104
Mandorf, S. 9; 18f; Trommsdorff (1990), S. 16.
105
Thiems, S. 18f; Mandorf, S. 18f.
106
Mandorf, S. 18f.
107
Trommsdorff (1990), S. 16.
108
Mandorf, S. 12ff;
109
Dömötör, S. 32.
110
Trommsdorff, S. 6; Calantone/Cooper (Journal of the Academy of Marketing Science 1979); Calantone/Cooper (Journal of Marketing 1981/2), 48ff; Ernst, S. 20.
111
Trommsdorff, S. 6; Cooper (European Journal of Marketing 14/1980); Ernst, S. 20.
112
Cooper (Journal of Marketing 43/1979); Ernst, S. 20.
113
Cooper (1993), S. 75f.
114
Trommsdorff, S. 7; Cooper (Journal of Marketing 43/1979), S. 99; Dömötör, S. 33; Cooper (1993), S. 75ff.
115
Trommsdorff, S. 7.
116
Cooper (Journal of Marketing 43/1979), S. 100f; Dömötör, S. 33.
117
Cooper (Journal of Marketing 43/1979), S. 102; Trommsdorff, S. 8.
118
Cooper/Kleinschmidt (Journal of Product innovation Management 4/1987); Trommsdorff, S. 8.
119
Eigene Darstellung.
3. Ansatz zur Identifikation von Erfolgsfaktoren der Elektromobilität
Nachdem in den vorangegangenen Teilen ein Überblick zur methodischen Differenzierung im Rahmen der EFF gegeben sowie einzelne Konzepte im Detail beschrieben wurden, wird im Weiteren der dieser Arbeit zugrunde liegende Ansatz zur Identifikation von Erfolgsfaktoren der Elektromobilität erläutert.
Basis der Überlegungen ist der Überblick der vorgestellten EFF-Methoden. In der Arbeit besteht das Ziel in der Beantwortung der Forschungsfrage respektive der forschungsleitenden Teilfragen. Als zentral gilt die Frage nach den Erfolgsfaktoren der Elektromobilität zu beantworten, darüber hinaus sind die Teilfragen der rechtlichen und wirtschaftlichen Gestaltung der Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung.
Wendet man das Gerüst etablierter EFF-Methoden im Sinne eines Entscheidungsbaumes auf diesen Hintergrund an, kann der grundsätzliche Ansatz zur Identifikation von Erfolgsfaktoren in der Elektromobilität abgeleitet werden. Die angewandte Methodik der Erfolgsfaktorenforschung wird in Abbildung 5 durch die Kennzeichnung im Überblick der EFF dargestellt.
Abbildung 5: Identifikation der EF für die Elektromobilität120
Die angewandte Vorgehensweise der Ermittlung der Erfolgsfaktoren der Elektromobilität ist mittels direkter Methodik, einer qualitativen Datenerhebung und indirektem Vorgehen bei der Ermittlung durch theoretische Grundlagen vorgenommen worden. Der Einsatz der Erfolgsfaktoren ist darüber hinaus für eine Gesamtanalyse möglich.
Um den besonderen Herausforderungen der Thematik der Elektromobilität, respektive der Betrachtung der drei zentralen Dimensionen Technologie, Recht und Wirtschaft gerecht zu werden, wird ein integrativer Ansatz verfolgt, der die Ergebnisse der Erfolgsfaktoren nach Steinmann/Schreyögg um die Faktoren, die Cooper als entscheidend für den Erfolg von Produkten identifiziert hat, ergänzt. In der Arbeit wird der Forschungsansatz demnach für Produkte und nicht wie ursprünglich von Steinmann/Schreyögg initiiert auf Unternehmen angewandt, sondern es findet eine Integration der Forschungsergebnisse von Cooper statt.
Abbildung 6: Ergänzung Steinmann/Schreyögg durch Cooper121
Dabei werden in Abwandlung zu Steinmann/Schreyögg die strategischen Optionen nicht nur von der Umwelt und dem Unternehmen determiniert,122 sondern um die Betrachtung des Produkts ergänzt. In Abwandlung zum ursprünglichen Konzept wird weiterhin die Umweltbetrachtung in der Analyse insbesondere auf das Rechtssystem und dessen Einfluss auf die strategischen Optionen bezogen. Durch Einflussnahme der drei Komponenten auf die möglichen Ausrichtungen wird im nächsten Schritt die strategische Wahl vorgenommen, um dann in einem weiteren Prozessschritt die strategischen Programme vorzustellen. Eine quantitative Überprüfung wird in diesem Kontext nicht angestrebt, kann jedoch als Forschungsausblick für die weitere Untersuchung gewertet werden.
Der durchzuführende Prozess erfolgt vor dem Hintergrund des aktuellen Stands der Erfolgsfaktorenforschung einem klaren Vorgehen, das den Untersuchungsobjekten gemäß gängiger Kriterien angelehnt ist. Nach Mandorf ist der angewandte Ansatz der Erfolgsfaktorenforschung zwischen dem theoriegeprägten und dem Praktikeransatz einzuordnen. Die Theorieprägung basiert eindeutig auf dem Ansatz von Steinmann/Schreyögg, deren Umweltund Unternehmensanalyse durch die Betrachtung des Rechts- und Wirtschaftsraums bestätigt angewandt wurde. Zusätzlich betrachtet die Arbeit unternehmensintern die Wertschöpfungskette, eine unternehmensexterne Kundenorientierung wurde mittels der Marketingbetrachtung und spezifisch der Untersuchung von Preis, Produkt, Kommunikation und Vertrieb erfüllt. Eine Gewichtung der dargestellten Erfolgsfaktoren kann nicht vorgegeben werden, da das Ausmaß deren jeweiliger Wirkung in der vorliegenden Forschung nicht untersucht wird. Damit liegt auch eine subjektive Beurteilung der Faktoren vor, die den Praktikeransatz in der EFF kennzeichnet. Die ermittelten Faktoren unterliegen einem situativen Ansatz, sind damit nicht allgemeingültig und universell auf andere Branchen zu übertragen, sondern beziehen sich konkret auf die vorliegende Problemstellung der Marktdurchdringung der Elektromobilität mit den dargestellten Schwierigkeiten und Herausforderungen unter Berücksichtigung der aktuellen Technik und Marktlage. Der Zeitverlauf kann die Dringlichkeit einiger Faktoren bestärken oder andererseits in deren Bedeutung senken.123
Nachdem nun ein Grundverständnis durch das EFF-Grundgerüst in der Arbeit angewandt wurde, findet im Folgenden eine Einordnung in die ganzheitlich methodologische Vorgehensweise statt. Dies erfolgt im ersten Schritt in der Erläuterung des wissenschaftlichen Rahmenwerks sowie der daran anschließenden Entwicklung der konkreten methodologischen Anwendung.
120
Modifiziert Vgl. Schmalen et al., S. 4; Haenecke (Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2/2002), S. 168; Wolff/Herrmann/Niggemann (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1+2/2004), S. 263.
121
Eigene Darstellung.
122
Steinmann/Schreyögg, S. 172.
123
Mandorf, S. 21.
IV. Methodologische Vorgehensweise
Durch die Beschäftigung mit der bereits existierenden Erfolgsfaktorenforschung, die sich bislang primär am Erfolg eines Unternehmens und dem Launch neuer Produkte orientiert, wird ein Erfolgsfaktorenmodell für die Elektromobilität abgeleitet. Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit richtet sich darauf aus, welche Faktoren maßgeblich den nachhaltigen Erfolg der Elektromobilität beeinflussen. Das Ergebnis stellt eine Verbindung der wirtschaftlichen und juristischen Perspektive dar, mit der es gelingen soll, die Erfolgsfaktoren des juristischen Bereichs durch eine Bewertung der rechtlichen Faktoren und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie auf das Produkt bezogen zu identifizieren und in einem Katalog aufzulisten. Damit wird die Verbindung zum Erfolg der Elektromobilität, die als ein nachhaltiger Erfolg des Produkts betrachtet wird, hergestellt.
Durch die zuvor erlangten Erkenntnisse in der Betrachtung der Erfolgsfaktorenforschung vor dem besonderen Hintergrund der Elektromobilität wird ein qualitativer, theoriebildender Forschungsansatz in Anlehnung an die Grounded Theory gewählt. Mangels einschlägiger Publikationen zu Erfolgsfaktoren der Elektromobilität und zugleich breiter Literaturbasis zu einzelnen Teilbereichen, einer Vielfalt an Konzepten und weiteren Quellen zur Elektromobilität wird ein theoretischer Ansatz verfolgt.124 Dieser ermöglicht gemäß Bryman/Bell eine strukturierte Vorgehensweise, die im Weiteren aufgezeigt werden soll.
In der qualitativen Forschung werden Theorieaussagen generiert und entdeckt, während in der quantitativen Forschung bereits bestehende Thesen überprüft werden.125 Während also in der qualitativen Forschung auf Grundlage von Entdeckungen durch Beobachtung oder Literaturrecherche in Dokumenten neue Zusammenhänge erschlossen werden, sind in der quantitativen Forschung die Fallzahlen entscheidender. Dort werden bereits gebildete Hypothesen eines Themenfeldes anhand signifikant messbarer Mengen widerlegt oder bestätigt.126 Grundlage für die qualitative Forschung ist jedoch ebenfalls eine Anfangshypothese oder Theorie, die hingegen eher als Zugang zum Themenfeld erachtet wird und im weiteren Verlauf der Datensammlung induktiv eine größere Theorie entwickelt wird.127 Damit soll der Forschungsgegenstand konkretisiert werden, um das Feld der Theorien durch die neu gewonnene Erkenntnis erweitern zu können. Theorien bilden in der qualitativen Forschung somit die Grundlage sowie das Ergebnis des Forschungsprozesses, die aus der Forschung emergierten Befunde können im Anschluss deduktiv mittels quantitativer Forschung überprüft werden.128
Für die vorliegende Arbeit folgt somit im Kontext der aufgezeigten Erkenntnisse, dass vor dem Hintergrund der EFF und etablierter Ansätze ein qualitativer, theoriegeleiteter Ansatz zu wählen ist, welcher der Besonderheit des Themas gerecht wird. Dieser soll im Weiteren anhand der konkreten Schritte zur Untersuchung Rechnung getragen und im Detail erläutert werden.
124
Bryman/Bell, S. 459.
125
Brüsemeister, S. 19; Glaser/Strauss, S. 24.
126
Brüsemeister, S. 19.
127
Brüsemeister, S. 25.
128
Brüsemeister, S. 24f.
V. Gang der Untersuchung
Die Arbeit gibt einen Überblick über die Treiber der Elektromobilität sowie darüber welche ökologischen, politischen und sozioökonomischen Faktoren die Elektromobilität anstoßen und konkret fördern. Sowohl die Ressourcenknappheit als auch die Gesetze auf europäischer und nationaler Ebene vor dem Hintergrund des Umweltschutzes sind stark prägend und erzeugen Innovationsdruck. Die Bundesrepublik Deutschland hat dies schon früh erkannt und in ihren Zielen fest verankert. Nicht nur die Entwicklung einer erfolgreichen Elektromobilität steht im Vordergrund, Deutschland möchte leitender Anbieter und Markt in diesem automobilen Zukunftsfeld werden.129
Der Aufbau der weiteren Untersuchung gliedert sich dabei in drei Teile. Der erste Bereich gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, der die Definition eines Elektroautos umfasst, die Funktionsweise des BEVs sowie der Batterie in ihren Grundzügen darstellt. Auf die Charakteristika der Elektrofahrzeuge, die sich aus der Technologie ergeben wird besonders eingegangen. Dies ist notwendig, um ein Verständnis für die Eigenschaften der Elektromobilität zu entwickeln und die damit verbundenen akzeptanzrelevanten Aspekte und Erfolgsfaktoren zu behandeln. Im Anschluss wird der Status Quo des Marktanteils sowie der Marktdurchdringung in Deutschland untersucht und zeitgleich wird auf dafür mögliche Ursachen Bezug genommen. Ebenso enthält der erste Teilbereich eine wirtschaftswissenschaftliche Analyse der Elektromobilität, in welcher der Status quo betrachtet und die zugrundeliegenden Ursachen dafür untersucht werden. Dabei spielen die Unsicherheiten im Ausbau der Elektromobilität eine entscheidende Rolle. Eine Einordnung der Elektromobilität in die Innovationsforschung wird vorgenommen.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der juristischen Aufarbeitung des Status quo und der Ursachenforschung aus juristischer Perspektive in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei wird zunächst die Frage geklärt, was den Staat überhaupt dazu legitimiert, Gesetze im Sinne der Förderung der Elektromobilität zu erlassen. Diese Erörterung wird zunächst ordnungspolitisch sowie im nächsten Schritt juristisch ausgewertet und mittels der Rechtsgrundlage für die Erlassung der Normen geklärt. Es folgt eine Darstellung der rechtlichen Grundlagen im Bereich der Elektromobilität sowie eine grobe Skizzierung der sich daraus ergebenden Problemstellungen in der Praxis. Förderpolitische Maßnahmen werden ebenso vorgestellt. Eine Evaluierung der Gesetze und Überprüfung ihrer Wirkung runden dieses Kapitel ab.
Im dritten Teil findet eine wirtschaftswissenschaftliche Analyse statt, in welcher das Geschäftsmodell der Elektromobilität anhand der Wertschöpfungskette untersucht wird. Die einzelnen Wertschöpfungsstufen werden im Hinblick auf mögliche Einflussfaktoren und Auswirkungen der Elektromobilität betrachtet. Neben den Herstellern selbst und der Analyse der Stufen von F&E bis zum Aftersales Bereich, werden die Einflussfaktoren auf die Zulieferer analysiert. Der zentrale Fokus innerhalb der wirtschaftlichen Betrachtung gilt jedoch den Verbraucherinnen und Verbrauchern. In einem ersten Schritt werden dabei die Faktoren beim Autokauf, die Zielgruppensegmentierung und Einsatzmöglichkeiten der Elektrofahrzeuge betrachtet. Danach wird auf die Zielgruppenansprache im Detail eingegangen wobei die Untersuchung über die 4 Ps des Marketings vorgenommen wird und die Betrachtung das Produkt, den Preis, das Vertriebssystem sowie die Kommunikation umfasst. Eine Einordnung der bestehenden Verhältnisse sowie Lösungsmöglichkeiten schließen jeden der Bereiche ab.
Im Anschluss findet eine Einbettung in das theoretische Modell der Erfolgsfaktorenforschung nach Steinmann/Schreyögg in Symbiose mit Coopers EF für Produkte statt sowie eine Ableitung auf Produkt, Rechtssystem und Unternehmen.
Diese Überlegungen sind Grundlage für die Einbettung in die Erfolgsfaktorenforschung zur Elektromobilität, die anhand der Erkenntnisse der vorherigen Kapitel konkretisiert werden und das zentrale Ergebnis der Arbeit darstellen.
129
BRD 2011.
B. Elektromobilität – Treiber, Formen, Definition
Unter Elektromobilität versteht man die Nutzung unterschiedlicher, elektrisch angetriebener Verkehrsmittel, die sich jedoch in Verkehrsart und Verkehrsträger unterscheiden.130 Der Bereich der Elektromobilität, der in der Arbeit behandelt wird, beschränkt sich in der Verkehrsart auf den Personenverkehr und innerhalb dieser Gruppe auf den Individualverkehr sowie im Bereich des Verkehrsträgers auf die Straße. Die Untersuchung umfasst den Sektor der Personenkraftwagen, dessen Marktanteil von 90 Prozent aller in Deutschland zugelassener Kraftfahrzeuge sowie mit 87 Prozent der deutschen Gesamtfahrleistung den Ausschlag für diese Eingrenzung gibt.131 Die Arbeit bezieht sich auf das individuelle Umdenken und die Akzeptanz der Elektromobilität, welche ausschließlich aus diesem Blickwinkel untersucht wird.
Insgesamt nehmen die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge seit der Einführung der Kaufförderung stark zu und zeigen ein dynamisches Bild.132
130
Bertram/Bongard, S. 8.
131
Linssen/Danzer/Harker/Maas/Strunz/Weinmann (Energiewirtschaftliche Tagefragen 1–2/2013), S. 121.
132
BMDV, S. 8.
I. Treiber alternativer Antriebsformen
Es lassen sich grob drei Einflussgruppen identifizieren, die der Elektromobilität große Schubkraft verleihen. Treiber sind ökologische Rahmenbedingungen, politische Vorgaben sowie sozioökonomische Veränderungen. Die folgende Grafik gibt einen kurzen Überblick über die Treiber der Elektromobilität, bevor die jeweiligen Bereiche in den folgenden Kapiteln genauer untersucht werden.
Abbildung 7: Treiber der Elektromobilität133
133
Eigene Darstellung.
1. Ökologisch
Eine zentrale Herausforderung der Gegenwart ist der Klimawandel und die damit verbundene Bekämpfung der Ursachen und Eindämmung der Folgen für die Weltbevölkerung. Obwohl der CO2-Ausstoß immens und die Ursachen für diesen vielfältig sind, ist die Reduktion des Verbrauchs begrenzter Ressourcen und insbesondere des Verbrauchs von Erdöl ein großes Ziel, um die negativen Auswirkungen des CO2-Ausstoßes zu reduzieren.
Die Auswirkungen des Verkehrs für Gesundheit und Umwelt sind in vielerlei Hinsicht schädlich, so sind neben Lärm und Flächenverbrauch vor allen Dingen die Schadstoffemissionen erheblich, die zu einer Schädigung des Klimas führen.134
a)Klimawandel
Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist ein Sammelbegriff der Konsequenzen für die ursächlich in der Atmosphäre ansteigenden Treibhausgasemissionen. Zu den Treibhausgasen zählen Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid CO2, Methan CO4, Lachgas N2O und halogenierte Kohlenwasserstoffe HKW.135 Die hohe Menge an Treibhausgasen führt durch Reflexion der langwelligen Wärmestrahlung zur Erwärmung der Erde, was als Treibhauseffekt bezeichnet wird.136
Neben zahlreichen negativen Konsequenzen der Erderwärmung ist eine der schwerwiegendsten Folgen die Zerstörung der Ozonschicht, die in ihrem Wirkmechanismus einem UV-Filter gleicht. So nimmt die Strahlungsintensität der Sonne vermehrt zu.137 Dies ist ursächlich für geologisch tektonische Veränderungen, die das Verhältnis von Land und Wasser verändern und den Vulkanismus fördern.138
Bei einer weiteren Erderwärmung muss mit einer Häufung und Intensivierung extremer Wetterereignisse, dem Meeresspiegelanstieg und der Versauerung der Weltmeere gerechnet werden. Damit gehen ökonomische Effekte einher, die in den betroffenen Regionen zu einer massiven Verschlechterung der Lebensbedingungen und damit auch der Sicherheitslage führen können.
Diese Erkenntnisse wurden bereits 1988 publik, weswegen in der Konsequenz die überstaatliche Organisation IPPC, Intergovernmental Panel of Climate Change, gegründet wurde, die objektive Informationen zum Klimawandel zur Verfügung stellt und daraus Handlungsempfehlungen ableitet.139 Eine der bekanntesten Empfehlungen ist die Reduzierung der Emissionswerte bis 2050 um 80–95 Prozent, auf Basis der Werte aus dem Jahr 1990.140 Falls dies gelingen würde, könnte eine konstante Reduzierung der Erderwärmung und das Einpendeln einer Temperaturerhöhung von 2 Grad Celsius erreicht werden.141 Eine der aussichtsreichsten Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ist der Verzicht auf die Verbrennung fossiler Kraftstoffe.142
b) CO2-Ausstoß
Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Temperatur um ein Grad Celsius erwärmt. Hauptsächlich wird dafür der hohe Ausstoß an Kohlendioxid verantwortlich gemacht, der bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe entsteht.143 Das bei Verbrennungsmotoren im Erhitzungsprozess durchschnittlich pro km in Höhe von 152 g abgegebene CO2144 wirkt in der Atmosphäre wie ein Klimagas, das die Durchschnittstemperaturen steigen lässt.145 In Deutschland verursacht der Verkehr 18 Prozent der gesamten CO2-Emissionen und ist damit der drittgrößte Emittent nach dem Energie- und Industriesektor.146 Um dies einzudämmen und die negativen Folgen zu reduzieren, wurde ein Reduktionsziel von CO2 für das Jahr 2050 ausgerufen. Durch diese Einsparbestrebungen werden die Emissionswerte von IECVs immer stärker reduziert, jedoch entsprechen die rechtlichen Vorgaben oftmals nicht den Werten in der Realität.147
Vorreiter für das Umdenken im automobilen Bereich war unter anderem das von Kalifornien 1990 umgesetzte Zero-Emission-Programm, das die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in jüngerer Geschichte enorm angekurbelt hat.148 In der Elektromobilität wird durch den lokal emissionsfreien Betrieb ein größeres Einsparpotenzial gesehen, das oftmals als die Antwort auf den Klimawandel und die exogenen Umweltfaktoren gilt.149
c)Energieträger und fossile Ressourcen
Als wichtige Lebengrundlage für die Menschheit gilt Energie, die zum Beispiel zur Nahrungszubereitung, zur Klimatisierung des Wohnraums, zur Kommunikation oder zum Transport benötigt wird.150 Sie ist elementarer Bestandteil für den Antrieb von Transport- und Verkehrsmitteln sowie für Maschinen. Die Energieträger, mit deren Hilfe Energie hergestellt werden kann, werden in primäre und sekundäre Energieträger unterschieden. Der Unterschied zwischen den primären oder auch fossilen Energieträgern151 wie beispielsweise Erdöl, Erdgas, Kohle oder Uran ist, dass diese direkt zur Energieerzeugung verwendet werden, während die sekundären Energieträger erst durch Umwandlung zur Energiegewinnung geeignet sind. Beispielhaft für sekundäre Energieträger können Schweröl, Benzin, Kerosin oder Wasserstoff genannt werden.152
Fossile Energiestoffe haben sich über sehr lange Zeiträume unter besonderen geologischen Bedingungen beim Abbau von Pflanzen und Tieren gebildet.153 Die Nutzung primärer Energieträger ist aufgrund der im Vergleich zum Abbau viel langsameren Nachbildung von Ressourcen sowie dem Verbrennungsprozess während der Energieerzeugung umstritten.154 In der Rangfolge der verschiedenen Sektoren, die Primärenergieträger nutzen, ist die Industrie der größte Abnehmer, dicht gefolgt vom Verkehrssektor und den Haushalten.155
Daneben gibt es erneuerbare Energieträger, unter denen man Energiequellen zusammenfasst, die sich verhältnismäßig schnell regenerieren können. Dazu zählen Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme, Müll und nachwachsende Rohstoffe.156 Zu den ersten Energiequellen erneuerbarer Energie zählten in Deutschland Wasserkraftanlagen, mit der Einführung des EEG kamen vermehrt Windkraft, Photovoltaik und Geothermie hinzu.157 Vorteile der alternativen Antriebsformen sind neben dem Erhalt fossiler Ressourcen die gänzliche Einsparung von Treibhausgasemissionen und Schadstoffen.
Die große Abhängigkeit vom Rohstoff Erdöl und dessen teilweise intransparenten Preisschwankungen158 sowie die knappheitsbedingten hohen Rohstoffkosten waren der ursprüngliche Auslöser für die Forschung nach alternativen Mobilitätsformen.159
Im Verkehrssektor ist man von neuen Technologien und Alternativen für fossile Brennstoffe abhängig, um den Einsparungszielen gerecht zu werden.160 Im Bereich der bestehenden Technologie sind der effizientere Einsatz von fossilen Kraftstoffen oder alternative Kraftstoffe denkbar. Mittel- bis langfristig sind jedoch technische Alternativen zum bisherigen Verbrennungsmotor erforderlich, die ein größeres Einsparpotential aufweisen.161
Die Elektromobilität braucht zum Antrieb Strom und nicht wie Verbrennungsmotoren fossile Ressourcen. Eine besonders ökologische Alternative scheint die Elektromobilität außerdem zu sein, wenn der benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen kommt sowie keine fossilen Rohstoffe bei der Stromerzeugung eingesetzt werden und somit für die Mobilität komplett ersetzbar werden.162 Dadurch könnten rund 22 Prozent der derzeitigen CO2-Verschmutzung eingespart werden, die durch den weltweiten Verkehr verursacht werden.163 Das Zusammenspiel der lokal emissionsfreien Elektromobilität mit alternativ erzeugtem Strom gilt als großer Hoffnungsträger für die Zukunft.164
Damit leistet die Elektromobilität im Optimalfall aus ökologischen Aspekten einen Beitrag für eine nachhaltige Mobilität in Verbindung mit der Eindämmung des Klimawandels, der Einhaltung von Klimaschutzzielen sowie der Vermeidung der Nutzung fossiler Ressourcen.165
134
Koch et al./
Friedrich
, S. 39;
Salawitch/Canty/Hope/Tribett/Bennett
, S. 2ff.
135
Kreyenberg, S. 8.
136
Salawitch/Canty/Hope/Tribett/Bennett
, S. 2ff, 8.
137
Kreyenberg, S. 8f;
Salawitch/Canty/Hope/Tribett/Bennett
, S. 2.
138
Kreyenberg, S. 9;
Salawitch/Canty/Hope/Tribett/Bennett
, S. 4.
139
Kreyenberg, S. 9.
140
Boesche et al. (2013)/
Beyer
, S. 2; Europäische Kommission, S. 4.
141
Kreyenberg, S. 9;
Salawitch/Canty/Hope/Tribett/Bennett
, S. 2ff, 51f.
142
Dambeck; Podewils, S. 31f.
143
Dambeck.
144
Schuler, S. 14.
145
Dambeck.
146
WD 8 – 3000 – 009/18, S. 23.
147
Lienkamp/Homm, S. 6, 2.
148
Kampker et al. (2013)/
Hameyer/De Doncker/van Hoek/Hübner/Hennen/Kampker A./Deutskens/Ivanescu/Stolze/Vetter/Hagedorn
, S. 265.
149
Strathmann, S. 24; Ebel/Hofer/
Spiegelberg
, S. 58f; BMDV, S. 1.
150
Kreyenberg, S. 10; Podewils, S. 53.
151
Kreyenberg, S. 10; Podewils, S. 53ff.
152
Kreyenberg, S. 1; Neukirchen/Ries, S. 283.
153
Kreyenberg, S. 10; Neukirchen/Ries, S. 283f.
154
Kreyenberg, S. 1; Meadows/Meadows/Randers/Behrens, S. 57ff; Filho/Azul/Brandli/Lange Salvia/Wall/
Taslima/Kassim
, S. 34.
155
Kreyenberg, S. 11.
156
Kreyenberg, S. 10; Filho/Azul/Brandli/Lange Salvia/Wall/
Taslima/Kassim
, S. 32ff.
157
Kreyenberg, S. 10.
158
Lienkamp/Homm, S. 1.
159
Lienkamp/Homm, S. 1; Podewils, S. 19ff.
160
Rottmann et al., S. 8.
161
Rottmann et al., S. 9.
162
Ebel/Hofer/
Spiegelberg
, S. 58f; Podewils, S. 19ff.
163
Kreyenberg, S. 9.
164
Ebel/Hofer/
Spiegelberg
, S. 58f; Podewils, S. 19ff.
165
Korthauer/
von Monschaw
, S. 79.





























