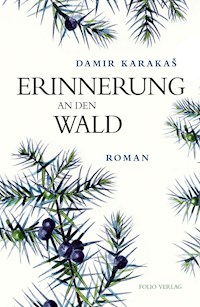
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Damir Karakaš erzählt die archaische Welt eines Bauernjungen. Es ist eine raue bäuerliche Welt, der ein Junge mit kindlichen Spielen und kleinen Fluchten trotzt. Von Geburt an schwer herzkrank, ist er nicht der Stammhalter, den sein Vater sich wünscht, und nicht die Arbeitskraft, die auf dem Hof, auf dem der Mangel regiert, benötigt wird. Die stumme Gewalt des rackernden und ständig hadernden Patriarchen ist allgegenwärtig, und weder die Mutter noch die Großmutter können den Jungen davor schützen. Aus der gottverlassenen kroatischen Provinz, die geprägt ist von Kühe-Hüten, von Aberglauben und Hexerei, von verdrehten Seelen und Tierärzten, die Menschen behandeln, sowie von schneelosen apokalyptischen Wintern, flüchtet sich der Junge in imaginierte Welten und unerfüllbare Berufsträume: Armeeoffzier, Basketballspieler, Bodybuilder, Bärentöter. Mit seinen Fantasien unterdrückt er zugleich alle Gefühle der Schwäche, bis sie aus ihm herausbrechen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAMIR KARAKAŠ
ERINNERUNG AN DEN WALD
ROMAN
Aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof
Inhalt
Der Weg
Ballspiele
Das Mittagessen
Etwas auf Rädern
Die Atombombe schläft
Kraut stampfende Frauen
Hier wohnt der Bär
Anweisung zum Schweineschlachten
Durst
Mein Freund, der Indianer
Die Soldaten
Kino
Die Jagd
Der Ausflug
Wohin das Wasser geht
Der Tod
Vor dem Regen
Kühe wie Ballons
Der Fernseher
Baba Vuna
In der großen Stadt
Das verstimmte Klavier
Legenden
Malaika, nakupenda, Malaika
Die …
Das Krankenhaus
Ein Blick aus dem Panzer
Der Spiegel
Wie ein Dreieck werden
Die Ernte
Beklemmung
Das Herz
Der Wald
Anmerkungen
Der Weg
Ich liege auf dem Bett und horche; die Wände des Holzhauses sind mit alten Zeitungen abgedichtet, aber der Wind findet immer neue Ritzen: er bläst und bewegt die Schatten im Zimmer. Später ist helles Klirren zu hören: da lässt mein Vater das Vieh von der Kette. Als ich mich auf die Schnelle anziehe und hinauslaufe, ist unsere Kuh Suza schon aus dem Hof: hinter ihr Šarava, Lozonja, Peronja; alle zusammen stapfen wir den schrägen Hang hinauf zum Wald. Suza kennt den Weg gut, und die anderen folgen ihr im gleichen Trott: über grünes Gras, hohes, niedriges, gemähtes; das Laub bleibt an ihren Hufen kleben. Da kommt Medo aus dem grünen Dickicht angerannt. Ich kraule ihn zwischen den Ohren, ziehe ihn glücklich am Schwanz und mache den Rindern nach lange Schritte; ich schreite aus und treffe wenig später auf der Wiese, die den Wald teilt, meine Freunde: der eine heißt Pejo, der andere Nenad. In der letzten Zeit geht auch Mali mit uns; er ist erst diesen Herbst in die Schule gekommen, er hat nur eine Kuh, deswegen müssen wir auch auf ihn und seine Kuh aufpassen. Manchmal kommt auch Biba mit ihren Schafen: sie legt sich in den Schatten, liest „geschriebene Romane“ und tut so, als würden wir nicht existieren; wir tun so, als würde sie nicht existieren. Wir haben unsere Sachen unter einen Busch gelegt, die Ärmel aufgekrempelt: wie gestern messen wir uns im Steinestoßen von der Schulter. Pejo und Nenad haben schon gestoßen, jetzt ist die Reihe an mir. Ich bücke mich, nehme einen Stein und sehe Bibas Opa Mile; er steht da mit dem Jagdgewehr auf der Schulter und sieht mit stierem Blick zu mir her: die Stille hat sich in den Lauf seines Gewehrs verkrochen. Ich atme tief ein, mache ein paar schnelle Schritte, und die Wut schlägt aus dem heftigen Zucken meines Arms; ich stoße den Stein und stelle mir vor, dass er direkt auf Opa Mile zufliegt: der Stein fliegt und nimmt die Blicke mit sich. Nenad ist schon bei ihm und ruft: „Ich Gold, Pejo Silber, du Bronze!“ Wütend, weil ich mir von diesem Stoß viel erwartet habe, denke ich, wenigstens bin ich besser als Opa Mile. Und als würde er meine Gedanken lesen, grinst er und sagt, dass ich noch viel Polenta essen muss.
Einmal, als wir erst angefangen hatten, das Vieh im Wald zu hüten, fragte er uns, ob wir Honig essen wollten. Wir antworteten einstimmig, ja gern, dann führte er uns zu einem ausgehöhlten Erdloch; darüber spannte sich eine weiße Membrane. Er sagte: „Greift zu und esst nach Herzenslust.“ Er ging in das nahe Gehölz und rief uns von dort noch zu: „Lasst noch was für morgen übrig!“ Wir knieten uns sofort ungeduldig um das Loch, beugten die Köpfe drüber und begannen mit beiden Händen die Membrane abzustreifen. Dann sprangen wir jäh auf; landeten auf den Füßen wie bei dem russischen Tanz. Im Wegrennen suchte unser Blick den Waldrand. Wir flüchteten im Zickzack. Fielen hin, standen auf; die Wespen sirrten hartnäckig hinter uns her. Schließlich erreichten wir den dichten Wald und waren gerettet, und Opa Mile hielt sich die ganze Zeit den Bauch vor Lachen. Mich hatten zwei Wespen gestochen: in den Nacken und ins Gesicht, aber ich fand rasch zwei kühle Steine, legte sie auf die geschwollenen Stellen; Nenad hatte eine gestochen, Pejo keine. Als ich das zu Hause Baka erzählte, ging sie sofort raus in den Hof. Sie rief: „Wenn er die Pest hätte, würde dieser Mensch von Haus zu Haus gehen und den Leuten auf die Klinke spucken!“ Sie sagte, dass ich mich nie mehr einem Wespennest nähern darf, denn wenn mich eine in die Zunge sticht, schwillt sie an, und ich muss ersticken.
Seither, wann immer wir im Wald auf so ein mit einer weißen Membrane bedecktes Loch stoßen, sammeln wir trockenes Gras, Laub, Heu, werfen es hinein und zünden es rasch an. Dann flüchten wir an den Waldrand. Wir legen uns auf die Erde und pressen die Ohren an unsichtbare Gleise. Es klingt, als würden tief unter der Erde schwere Lastwagen durchfahren.
Ballspiele
Fußball spielen wir auf der Straße; wir passen auf, dass mein Vater nicht in der Nähe ist: fünf Gummibälle hat er uns schon zerstochen. Vor ein paar Tagen ist er auf dem Feld mit der Mistgabel auf einen Kürbis losgegangen: er hatte ihn für einen Ball gehalten. Auch meine Mutter mag nicht, wenn ich dem Ball nachrenne, aber sie sagt nur leise zu mir: „Mach dich nicht sinnlos müde.“ Vater hasst auch Fußballübertragungen; wenn es ein wichtiges Spiel gibt, halte ich das Fieberthermometer über den glühend heißen Herd, stecke es schnell unter die Achsel, lege mich ins Bett und tue so, als hätte ich hohes Fieber.
Aber kaum treibt Vater wütend das Vieh in den Wald, laufe ich zu Opa Pave; er lebt in einem Häuschen am Ende des Dorfs. Er war ein guter Freund von meinem Opa; sie beide haben Karten gespielt, Spaziergänge gemacht, sich im Gespräch oft gegenseitig überschrien. Mein Opa hat das ganze Leben in Tunneln als Sprengmeister gearbeitet und ist von diesen Minen halb taub geworden: deshalb sprach er lauter, weil er glaubte, dass ihn niemand gut hört. An dem Tag, als ich aus dem Krankenhaus in Rijeka zurückkam, weil Vater mich nicht hatte operieren lassen, hat mich Opa weinend umarmt. Einmal, als er und Baka allein im Zimmer waren, sagte er: „Was soll der Arme machen, wenn er doch behindert ist.“ Wegen dieses Wortes behindert habe ich drei Tage lang nicht mit ihm gesprochen, er glaubte, ich wäre schlechter Laune, weil ich in der Schule eine schlechte Note gekriegt hätte; mein Großvater sah mir immer heimlich nach. Mit einem Gesichtsausdruck voller Schmerz. Seine Augen waren groß und blau, sein Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst, als würde er um mich und sich selbst Schmerzen leiden; einmal habe ich zu ihm gesagt, dass mir nichts wehtue; er sagte nichts darauf, dafür sagte Großmutter statt seiner: „Was sollte dir, liebes Kind, denn wehtun?“ Aber Großvater tat es sehr weh. Opa Pave sagt, dass niemand so viele Schmerzen ertragen habe wie Großvater. Dass er, als er gesehen habe, dass mein Großvater litt und der Tod ihn nicht wollte, alles gegeben hätte, dass er sich eines Tages nur ins Gras legte. Von ihm habe ich auch erfahren, dass Großvater jahrelang eine Schnur mit einer leeren Gulaschdose um die Mitte gebunden hatte; in diese Blechdose hielt er seinen Pischer, um nicht in die Unterhose zu pischen. Er und Großmutter hatten geheiratet, als sie fünfzehn und er siebzehn war, sie bekamen drei Kinder: meinen Vater und zwei Tanten, die schon lange in Slawonien leben, aber wegen Vater fast nie kommen. Opa Pave hat nie geheiratet: er hat keine Kinder, er hat keine Familie, er hat niemanden, er hat nur ein paar Hühner und ein Transistorgerät; wenn das Spiel beginnt, schaltet er es ein und zieht langsam eine lange Antenne heraus; nach dem Spiel erzählt er mir von berühmten Spielern von Dinamo: am meisten mochte er Dražan Jerković. Er mochte ihn, sagt er, weil er eine Torfabrik war und weil er nie geheiratet hat.
Eine Zeit lang wollte ich auch Fußballspieler werden. In der Schule habe ich gut gespielt, aber ich verzichtete darauf, als mir klar wurde, dass Schildkröte, der beste Spieler aus unserem Dorf, im Klub aus dem Städtchen nur Reserve ist. Das ist die unterste Liga, wo der Erste nicht aufsteigen kann, weil er kein Geld hat, und der Letzte nicht absteigt, weil es nichts zum Absteigen gibt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein ärztliches Attest bekäme: das ist für alle verpflichtend, Pioniere, Junioren, Senioren: ohne dieses Attest kann sich keiner in einen Klub einschreiben. Schildkröte hat dieses Attest schon lange, mein Vetter aus Senj, der für die Junioren von Nehaj spielt, hat es auch. Darin steht: tauglich. Ich würde dieses Attest gern haben, gesund sein wie Schildkröte, wie er im Klub aus dem Städtchen spielen; dort haben sie ihm auch den Namen Schildkröte verpasst: alle nennen ihn Schildkröte, deshalb nennen wir ihn auch so. Wenn er spielt, läuft er dem Ball an der Auslinie nach und hält dabei immer einen Arm hoch; die Leute rings um das Spielfeld rufen ihm dann zu: „Schildkröte, mach die Handbremse los!“ Aber Schildkröte hat einen starken Schuss. Er erzählt, wie er einmal bei einem Spiel den Ball so getroffen hat, dass er fünfmal von Torstange zu Torstange geprallt und erst dann ins Tor geflogen ist; wenn er nach dem Spiel oder dem Training auf seinem MZ-Motorrad in unser Dorf gebraust kommt, laufen wir, um seine Fußballstiefel sauber zu machen; er isst Kraut und Fleisch mit der Gabel aus dem Topf, liest einen Veliki-Blek-Comic und lacht laut, und wir streiten uns um seine lehmigen Fußballschuhe. Am Sonntag hat er mich, Pejo und Nenad auf dem Motorrad zu einem Auswärtsspiel mitgenommen: wir fuhren, in der Kurve neigten wir uns zur Seite; ich hielt mich an Nenad fest, er an Pejo, Pejo an Schildkröte: mehrere unserer Spieler konnten nicht spielen, weil sie sich am Vorabend betrunken hatten, deshalb war sich Schildkröte sicher, dass er von der ersten Minute an spielen würde. Das Spielfeld war klein, von dichtem Wald umgeben; die einheimischen Fans waren vom Feld gekommen, sie hatten Hacken in den Händen und sangen vereint: Nichts auf der Welt macht mir Angst, Messer und Pistole stecken im Strumpf. Für alle Fälle schob uns Schildkröte in die kleine Blechhütte für unsere Reservespieler, rückte die Schienbeinschützer in den Stutzen zurecht, schnürte die Fußballschuhe fester: dann begann das Spiel. Der Trainer unserer Mannschaft hatte schon eine halbe Schachtel Zigaretten weggeraucht; wir neben ihm kauten vor Nervosität ständig an den Nägeln. Wenn unsere Spieler aufschrien und sich vor Schmerzen im Gras wälzten, holte der Trainer schnell den Haarlack heraus, lief zu dem gefaulten Spieler und besprühte dessen schmerzendes Bein: der sprang auf und spielte sofort weiter; als das Spiel dem Ende entgegenging, griffen die gegnerischen Spieler immer stärker an, aber unsere schossen den Ball taktisch in den Wald, um sich ein wenig auszuruhen; dann suchten die Schiedsrichter lange nach dem Ball, wir hörten, wie sie sich im Gebüsch zuriefen: „Hier ist er nicht!“
Einmal, als der Ball zu Schildkröte kam, knallte der den Ball aus der Spielfeldmitte irgendwohin Richtung Wald, drehte sich um und ging langsam auf sein Tor zu, die Kappen seiner Fußballschuhe schleiften müde über das Gras; da hechteten die Mitspieler begeistert auf ihn drauf; Schildkröte aus unserem Dorf hatte ein Tor geschossen.
Das Mittagessen
Seit Großvater gestorben ist, habe ich seinen Platz am Tisch eingenommen und sitze Vater gegenüber; zu Mittag gibt es Schweinefleisch, Kartoffeln und grünen Salat. Vater kaut und achtet mit einem Auge darauf, dass mir die Gabel nicht aus der Hand fällt; er würde mir deswegen mit seiner Gabel auf die Finger schlagen; während er isst, sagt mir sein Auge ständig: „Pass auf!“ Meiner Schwester ist letztens die Gabel auf den Boden gefallen, aber da hat er nur zu ihr gesagt, dass sie langsamer essen soll. Ich esse langsam, ich kaue und sehe in den Teller vor mir; meine Schwester kriegt die Kartoffel einfach nicht auf die Gabel gespießt; ihre Zähne sind schadhaft; sie sind noch schwärzer, wenn die blitzende Gabel in ihre Nähe kommt. Vater hat das Stück Fleisch noch nicht ganz heruntergeschluckt und trinkt schon laut Wasser; am Rand seines Glases bleibt ein fettiger Abdruck zurück; Baka mümmelt vor sich hin und sieht tiefer in ihren Teller; wenn wir so alle am Tisch versammelt sind, sagt sie selten etwas. Sobald sie mit etwas anfängt, sagt Mutter: „Jetzt seid Ihr wenigstens still, solange wir essen.“ Sie rächt sich an ihr, denn das hat Baka mit meiner Mutter getan, als sie gerade Vater geheiratet hatte. Vater tut meistens so, als ob er das nicht hörte oder sähe, aber manchmal sagt er: „Genug!“ Gestern habe auch ich mich auf Bakas Seite gestellt, habe Mutter unterbrochen und zu ihr gesagt, dass meine Cordhose gewaschen gehört. Mutter hat sich unterbrochen, hat Baka angesehen und gesagt: „Ich habe nicht zehn Hände.“ Vater hat nichts gesagt, er hat nur zu den morschen Deckenbalken über dem Kopf hinaufgesehen. Aber dann hat er zwischen zwei Bissen gesagt: „Im neuen Haus wird uns der Staub nicht mehr in den Mund rieseln.“ Meiner Schwester ist wieder die Gabel aus der Hand gefallen, dieses Mal auf den Tisch; wir essen und schweigen; draußen bellt Medo. Er weiß, dass er nach dem Mittagessen seine Mahlzeit bekommt. Vater steht abrupt auf und ruft durch das geschlossene Fenster: „Soll ich rauskommen?!“ Das Bellen hört auf, Vater setzt sich wieder hin und sagt zu sich selbst in seinen fettigen Bart: „Ich werde dich schon lehren!“ Ich zucke zusammen, weil ich glaube, dass diese Worte auf mich gemünzt sind; ich nehme ein neues Stück Fleisch aus der Schüssel, versuche so viel wie möglich zu essen, um ein paar Kilo zuzunehmen; ich bin mager, ich wachse und bin jeden Tag noch magerer. Vater sagt: „Würdest du es hinter dich werfen, wärst du dicker.“ Baka sagt: „Er wird zulegen, wenn er zum Militär kommt, da werden alle kräftiger und voller.“ Mutter will etwas sagen, schluckt es aber hinunter, nimmt ein Küchentuch und wischt der Schwester grob den Mund ab. Die wehrt sich und sagt: „Lass mich, ich bin kein Baby mehr.“ Am Ende des Mittagessens ist alles Fleisch aus der Schüssel aufgegessen: nur noch das dicke Schweinefett ist übrig. Vater nimmt, wie immer, die Schüssel mit beiden Händen, steht auf, führt sie langsam zum Mund: er trinkt das ganze Fett in zwei Zügen aus; er wischt sich den Mund mit der Handkante ab und sagt zu mir, ich solle Medo die Knochen bringen, er hat wieder zu bellen angefangen. Ich nehme die Knochen vom Tisch, werfe sie Medo hin, der sie mit seinen starken Zähnen zermalmt, und gehe in mein Zimmerchen: ich habe noch genug Zeit, lege mich hin und schlafe ein. Ich träume nichts, auch besser so; gestern habe ich einen der hässlichsten Träume geträumt: dass ich eine Kuh verloren habe. Ich hatte Angst und stellte mir vor, was Vater mit mir machte, wenn ich ohne Kuh nach Hause käme: ich würde nicht zurückkommen. Mutter kommt herein, sieht mich, wie ich daliege, die Hände auf dem Gesicht, weil mir die Sonne in die Augen scheint, und fragt mich: „Tut dir was weh?“ Ich schüttle kurz den Kopf, stehe auf, gehe in die Küche und stopfe mir Speck, fünf, sechs Kartoffeln und ein Klappmesser in die Tasche. Nach wenigen Minuten habe ich mich zwischen die warmen Rinder gezwängt; ich nehme ihnen die Ketten ab, passe auf, dass sie mich nicht zerquetschen. Dann laufe ich zu Medo, der vor Freude hochspringt und an der Kette zieht; wegen dieses Ziehens kann ich ihn kaum losmachen. Ich hänge mir die schwerer gewordene Tasche richtig um, nehme die Gerte hinter der Stalltür und treibe das Vieh bergauf. Unterwegs pflücke ich saftige rote Erdbeeren; ich drehe mich nach jeder gegessenen Erdbeere um: ich schaue, ob Pejo und Nenad schon losgegangen sind. Mit der Hand erweitere ich noch ein wenig den Ausblick: durch einen Vorhang aus kleinem ledrigen Laub sehe ich nur Mali mit seiner einen Kuh und schlage mit der Gerte stärker nach Peronja; wir gehen zuerst über die Rodung, dann durch gelbe Blumen; als wir uns alle oben auf der Wiese versammelt und Feuer gemacht haben, überlegen wir laut, was wir heute spielen könnten. Mali sagt: „Cowboys und Indianer.“ Pejo sagt: „Du bist noch zu klein zum Klugscheißen.“ Nenad krempelt schon die Ärmel hoch, er will, dass wir wie gestern Steine von der Schulter stoßen, ich würde lieber Wespennester suchen und sie ausbrennen. „Stecken wir uns zuerst eine an“, sagt Pejo, bückt sich und zieht eine Schachtel Opatija aus dem Strumpf. Dann teilt er am Feuer langsam die Zigaretten an uns aus, nur an Mali nicht; wir rauchen und versuchen Ringe zu blasen; Pejo bläst den Rauch ins Feuer und reicht seine Zigarette Mali. Der zögert zuerst, nimmt sie dann, zieht stark und beginnt zu husten, aber so, als würde er ersticken, sodass wir alle ums Feuer herum laut lachen müssen.
Etwas auf Rädern
Vater sitzt auf dem Hackklotz vorm Haus; in der Hand den zusammenklappbaren gelben Zollstock, hinter dem Ohr den Zimmermannsbleistift. Er steht auf und geht um das Haus herum wie ein Schlafwandler; wie ich gehört habe, hat er den Plan, neben dem neuen Haus auch einen Stall zu bauen, und so wird das Vieh nicht mehr unter uns schlafen und scheißen. Baka gefällt das nicht, sie sagt: „Das Vieh unter den Menschen hat dieses Volk jahrhundertelang vor der Kälte bewahrt.“ Ich stehe auf, gehe zu meiner Schultasche, nehme Schreibheft und Bleistift heraus, kehre zu meinem Stuhl zurück. Baka steigt auf die Zehenspitzen, dreht mit der Hand die Glühbirne ein und macht Licht; wieder sitzt Vater auf dem einsamen Hackklotz vorm Haus: in den Händen schläft sein müder Kopf; rasch steht er auf und schüttelt erst das eine, dann das andere eingeschlafene Bein aus; seine Augen sind trübe Glühbirnen. Ich sehe auf das leere Schreibheft, wieder stelle ich mir das neue Haus vor: das Dach von roten Ziegeln und einen Blechhahn, der sich dreht, wie ihm der Wind gebietet; auf das neue Haus freue ich mich am meisten, denn dann wird das ewige Knarren aufhören; wegen dem ziehe ich mir nachts immer die Decke über den Kopf. Ich horche, dann stecke ich mir die Finger in die Ohren: die Geräusche rufen einander im Haus, da helfen auch keine Finger in den Ohren. Ich höre auch das Stöhnen, das schnellere Atmen, und das Haus schaukelt, es rüttelt, wie ein Schiff auf Rädern, das über bucklige Abhänge rast. Meine Baka steht dann jedes Mal wütend auf, bleibt mitten im Zimmer stehen und ruft gegen die Holzwände: „Was ist da los?“ Obwohl ich genau weiß, dass sie weiß, was da los ist, aber es nicht sagen darf. Nach ihrem Rumoren lässt es ein wenig nach, es wird leiser: irgendwelche flüsternde Stimmen. Dann ist noch einmal Vaters Stöhnen zu hören, ähnlich dem von Medo, wenn er gähnt. Im Haus herrscht Friedhofsstille, aber diese Geräusche bleiben mir noch lange im Kopf. Am Morgen, wie bei etwas Schändlichem erwischt, schiele ich heimlich auf Mutters Bauch, um zu sehen, ob er gewachsen ist. Jetzt frage ich sie: „Wann fangen die Arbeiten am neuen Haus an?“ Sie zuckt nur die Achseln. Ich frage noch einmal, sie sagt ganz ruhig: „Wenn sie anfangen.“
Wenige Tage später trägt Vater Betten, Schränke, Tische, Stühle, den Herd und alle anderen Dinge aus dem alten Haus und stellt sie auf der nahen Wiese ordentlich auf. Er führt das Vieh ins Freie, bindet es mit Ketten an die Pflaumenbäume. Fünf Mal schlingt er einen Strick um das Haus, so als wollte er es für immer gefangen nehmen. Danach führt er Lozonja und Peronja im Joch heran, ein Ende des Stricks schlingt er um das Joch. Eine Zeit lang steht er nachdenklich neben den Ochsen und prüft das alte Haus mit dem Blick. Dann klatscht er den Ochsen kräftig auf die Hinterbacken und wirft die Arme in die Luft. So als würde





























