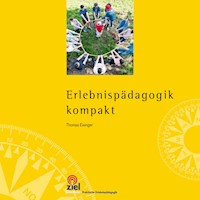
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ZIEL
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gelbe Reihe: Praktische Erlebnispädagogik
- Sprache: Deutsch
Erlebnispädagogik kompakt Kurz - bündig - kompakt Unter diesen Gesichtspunkten werden in diesem leicht und flüssig zu lesenden Buch die wichtigsten Themen für die Ausbildung von Erlebnispädagogen beleuchtet und erklärt. Nach einer Einführung in die Erlebnispädagogik behandelt es die Fragen nach dem Profil des Erlebnispädagogen ebenso wie die nach den Teamphasen, des Lernzonenmodells und der Wirkungsmodelle. Dabei bleiben die Ausführungen nicht in der Theorie stecken, sondern geben fundierte, praktische Einblicke in Didaktik, Reflexion und in den Bereich der Sicherheit im erlebnispädagogischen Kontext.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Titel ist auch als Printausgabe erhältlich
ISBN 978-3-944 708-38-6
Sie finden uns im Internet unter
www.ziel-verlag.de
Wichtiger Hinweis des Verlags: Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Bilder, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Leider gelang dies nicht in allen Fällen. Sollten wir jemanden übergangen haben, so bitten wir die Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Inhalt und Form des vorliegenden Bandes liegen in der Verantwortung des Autors.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
ISBN 978-3-944 708-45-4 (eBook)
Verlag
ZIEL – Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen GmbH Zeuggasse 7–9, 86150 Augsburg, www.ziel-verlag.de 2. überarbeitete Auflage 2016
Grafik undLayoutgestaltung
Friends Media Group GmbHZeuggasse 7, 86150 Augsburg
Illustrationen
Benjamin Wurster
Fotos
Benjamin Wurster außer: Jürgen Maier (S. 41), Michael Rehm (S. 61), Shutterstock/Dmytro Kosmenko (S. 75)
Gesamtherstellung
Friends Media Group GmbHwww.friends-media-group.de
eBook-Herstellung und Auslieferung
HEROLD Auslieferung Service GmbHwww.herold-va.de
© Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Dorothe, Donata, Tabea und Dorina – ohne euch wäre das Buch nicht entstanden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung in die Erlebnispädagogik
1. „Just for fun“ oder Erlebnispädagogik
2. Eine Definition der Erlebnispädagogik
3. Methodische Prinzipien der Erlebnispädagogik
4. Die pädagogische Zielrichtung
Der Erlebnispädagoge
1. Das Anforderungsprofil eines Erlebnispädagogen
2. Die Frage nach der Qualifikation des Erlebnispädagogen
Die Gruppe/Das Team
1. Faktoren, die das Gruppengeschehen beeinflussen
2. Teamphasen/Gruppenphasen
Das Lernzonenmodell
1. Vorbedingungen für einen Lern- und Veränderungsprozess
2. Das Lernzonenmodell
Kooperative Abenteuerübungen
1. Definition
2. Drei Einflussfaktoren auf Kooperative Abenteuerspiele
3. Verschiedene Aufgabenarten
Ablaufphasen einer Übung – Didaktik der Erlebnispädagogik
1. Vorbereitungs- oder Planungsphase
2. Anleitungs- oder Präsentationsphase
3. Durchführungs- oder Aktionsphase
4. Reflexionsphase
5. Evaluationsphase
6. Nachbereitungsphase
7. Programmplanung unter Beachtung der Gruppen- und Ablaufphasen (Matrix)
Wirkungsmodelle in der Erlebnispädagogik
1. Zur Frage der Alltagsrelevanz erlebnispädagogischer Maßnahmen
2. Möglichkeiten der Ergebnissicherung: Sechs Wirkungsmodelle im Überblick
3. Zur pädagogischen Effektivität der Modelle
Reflexion
1. Reflexion in der Erlebnispädagogik
2. Reflexion und Gruppenphase
3. Verschiedene Ebenen der Reflexion
4. Praktische Hilfen für die Reflexionsarbeit
5. Fallen in der Reflexionsarbeit
Sicherheit – Standards und Maßnahmen
1. Sicherheitsstandards
2. Seinen „Pflichten“ nachkommen
Literatur
Endnoten
Der Autor
Vorwort
Kurz – bündig – kompakt
Als Albert Einstein seine Dissertation abgab, umfasste sie ganze 17 Seiten. Die Gutachter waren beeindruckt vom Inhalt. Dennoch forderten sie ihn auf mehr zu schreiben. Er soll dann eine Woche lang darüber nachgedacht haben, um anschließend noch einen weiteren Satz hinzuzufügen und die Arbeit wieder abzugeben. Die Arbeit wurde angenommen.
Peter Drucker, den viele für das erste wahre Genie in der Managementforschung halten, hat den Zweck eines Unternehmens in weniger als 75 Worten zusammengefasst. Und dennoch bilden diese Wörter die Grundlage für einen großen Teil der Managementliteratur der letzten Jahrzehnte.1
Nun bin ich weder Einstein noch Drucker, aber mein Anliegen ist dasselbe: Die wichtigsten Themen zur Erlebnispädagogik sollen in einem einzigen Buch in kompakter und komprimierter Form klar verständlich beleuchtet werden und so einen Einstieg in diesen Bereich ermöglichen. Dabei werden die einzelnen Themen in ihren wichtigsten Aspekten dargestellt, für die weiterführende Diskussionen oder Informationen wird auf Literatur hingewiesen, die die einzelnen Themen differenzierter und tiefergehend darstellen.
In meiner Arbeit als Dozent und Ausbilder von Erlebnispädagogen2 habe ich immer wieder wertvolle Literatur zu Einzelthemen der Erlebnispädagogik gefunden. Aber was mir fehlte, war ein einziges Buch, in dem die wichtigsten Themen für die Ausbildung von Erlebnispädagogen in kompakter Form als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis dargestellt und erklärt werden. Deshalb ist dieses Buch entstanden.
Bad Liebenzell, Sommer 2016
Einführung in die Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik ist heutzutage zu einem schillernden und weitgefächerten Begriff geworden, unter dem sich eine Vielzahl von Aktivitäten und Programmen, vermehrt auch im kommerziellen Bereich, subsummiert.3 Gerade deshalb ist es notwendig, sich mit dem eigentlichen Kern der Erlebnispädagogik, sowie ihren Chancen und Grenzen auseinander zu setzen.4
1. „Just for fun“ oder Erlebnispädagogik
Die Zielrichtung bestimmen
Bei den vielfach angebotenen Programmen und Maßnahmen, die sich mit dem „Schwerpunkt Erlebnis“5 befassen, bedarf es einer genaueren Betrachtung, was Menschen darunter verstehen, wenn sie davon reden, dass sie – wie des Öfteren formuliert – „Erlebnispädagogik gemacht haben“. Schon die Formulierung lässt aufhorchen. Bei näherem Nachfragen stellt sich meist heraus, dass es sich um Freizeitaktivitäten handelt, die einen gewissen Event- und Erlebnischarakter haben, aber von einer erlebnispädagogischen Maßnahme noch weit entfernt sind. Solche Aktionen, die unbestritten schön sein können, interessant sind und Spaß machen und die keinesfalls abzulehnen sind, können allenfalls erlebnisorientiert, aber nicht erlebnispädagogisch genannt werden.
Damit ergeben sich zwei grundlegend verschiedene Programmtypen, die sich durch ihre inhaltliche Zielrichtung unterscheiden:
Zielrichtung „Just for fun“: Unterhaltung, Kick, Fun, Action
Zielrichtung „Bildung/Pädagogik“: Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsprozesse
Grafik 1: Erlebnis
Von dieser Zielrichtung herkommend, lassen sich Freizeitangebote, Incentives und Animationen dem Bereich „Just for fun“ zuordnen. Reine „Just-for-Fun“-Aktionen sind nicht oder nur indirekt pädagogisch einsetzbar. Wer bei einem Freizeitangebot oder im Anschluss an ein Incentive mit den Teilnehmern in eine Auswertungsrunde einsteigen will, um Transferpotentiale zu erarbeiten, wird wohl auf erstaunte Gesichter treffen. Das entspricht in diesem Fall nicht dem Handlungsmotiv der Teilnehmer (und auch nicht der des Veranstalters).6
Dagegen fallen Teamtraining, Erlebnistherapie und Erlebnispädagogik in den Bereich „Bildung/Pädagogik“. Daneben lassen sich in der Praxis erlebnisorientierte Maßnahmen und Outdoor-Maßnahmen nicht immer gleich einem dieser beiden Bereiche zuordnen.
Die Einordnung in einen der beiden Bereiche ist von der Zielrichtung – mehr „Just for fun“ oder mehr „bildend“ – abhängig. Diese wiederum wird maßgeblich davon beeinflusst, welchen Stellenwert die Prozessbegleitung und die Reflexion einnehmen.7
Program design nach Simon Priest
Simon Priest8 verfeinert diese Zielrichtung noch mehr und unterteilt in vier Programmtypen, „program designs“, wie er sie nennt, und grenzt sie durch Akzentsetzungen voneinander ab. Dabei ist zu beachten, dass Priest damit nicht ganzheitliche Lernerfahrungen zerstückeln will. Die Akzentuierung einer Zielkategorie heißt nicht, „dass die anderen Kategorien ausgeblendet werden. Das Schema ist als Modell, als Hilfestellung zu begreifen, um Konzepte mit definierten Zielrichtungen besser fassen und einordnen zu können.“9
Freizeit und Erholung: Mit dem Stichwort „change the way people feel“ setzt er in diesem program design den Schwerpunkt auf die affektiven Ziele. Die Maßnahme soll einer Entspannung und Erholung dienen, bei dem die Teilnehmer ihren Spaß haben und dieser auch im Vordergrund steht.
Bildung: Darunter subsumiert Priest all jene Maßnahmen, bei der im Vordergrund die Verfolgung kognitiver Ziele steht. Der Teilnehmer soll etwas erleben, soll aber darüber ins Nachdenken und reflektieren gebracht werden („change the way people think“).
Training: Bei diesem program design liegt der Akzent auf verhaltensbezogenen Zielen („change the way people behave“). Der Teilnehmer wird angeregt neues Verhalten nicht nur kognitiv zu erkennen, sondern auch gleich konkret in einer Aktion umzusetzen.
Therapie: Der Akzent liegt hier auf den therapeutischen Zielen. Teilnehmer sollen lernen, falsche Verhaltensweisen ab- und neue fördernde oder hilfreiche Verhaltensweisen aufzubauen und zu lernen („change the way people misbehave“).
Damit reiht Priest auch den Aspekt „Freizeit und Erholung“ in den Bereich der Pädagogik mit ein, weil er unter diesem Aspekt, auch wenn von den Teilnehmern unreflektiert, ein (zugegebenermaßen minimales) pädagogisches Ziel („change the way people feel“) verfolgt. Meine eigenen Erfahrungen zeigen, dass selbst dann, wenn eine Maßnahme im Sinne von „just for fun“ konzipiert und durchgeführt wurde, sie oftmals auch ohne Reflexion Auswirkungen auf die Gruppendynamik hatte.
2. Eine Definition der Erlebnispädagogik
Ein unmögliches Unterfangen
Eine exakte Definition von Erlebnispädagogik zu formulieren ist nicht möglich.10 Zu groß ist die Bandbreite und das Gesamtspektrum11, das mit „Erlebnispädagogik“ etikettiert wird (Abenteuerpädagogik, Wildnispädagogik, City Bound, Outdoorpädagogik, Zirkuspädagogik, um nur einige zu nennen). Paffrath bringt es plastisch auf den Punkt:
„Die Absicht, eine eindeutige Definition der Erlebnispädagogik zu finden, ähnelt dem Vorhaben, einen Pudding an die Wand zu nageln. Es bleiben nur schwache Konturen zurück. “12
Durch diese Heterogenität ist es in der Vergangenheit noch nicht richtig gelungen, diese unterschiedlichen Entwicklungslinien richtig miteinander zu verknüpfen. Es „fällt auf, dass die Fäden meist aneinander vorbeilaufen, ohne sich zu berühren. Es fehlen Verknüpfungen, die theoriebildend sein könnten“.13
Dennoch ist Paffrath14 zuzustimmen, wenn er deutlich macht, dass, „wenngleich eine Definition die Wirklichkeit in ihrer Vielfalt nicht abbilden kann, abstrakt bleiben muss, […] es dennoch sinnvoll [ist], das Grundprinzip möglichst prägnant zu formulieren“. In diesem Sinn sind Definitionen zwar nicht wertneutral und objektiv, aber dennoch Hilfsmittel und Verständigungsgrundlage, um die jeweilige Position oder den jeweiligen Schwerpunkt zu verdeutlichen.
Es ist deutlich geworden, dass Erlebnispädagogik nicht in erster Linie mit einem erhöhten Adrenalinspiegel gleichzusetzen ist. Sie ist auch nicht Schulung in speziellen Sportarten, wie sie von kommerziellen Sportorganisationen angeboten werden. Sie ist außerdem nicht gleichzusetzen mit Extremsportarten oder einem Überlebenstraining, sondern hat mit einer pädagogischen Zielsetzung und auch mit pädagogischer Betreuung zu tun.
„Abenteuer finden nicht ohne pädagogische (Vor-/Während-/Nach-)Betreuung statt.“15
Der Fokus liegt in erster Linie nicht auf dem Erlebnis, sondern auf der Pädagogik, auf dem, was durch dieses Erlebnis erreicht bzw. ausgelöst werden soll. Um es mit Priest in kompakter Form zu sagen: „Change the way people feel, think, behave and misbehave.“ Ähnlich betonen auch Heckmair/Michl in ihrer Definition von Erlebnispädagogik, dass durch „exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen gestellt werden“, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert und befähigt werden sollen „ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“16.
Hier sind für die hier behandelte Fragestellung die Begriffe „Lernprozesse“, „Herausforderungen“, „Persönlichkeitsentwicklung fördern“ und „befähigen“ wichtig. Sie machen deutlich: Im Mittelpunkt stehen (herausfordernde) Lernprozesse, die auf Entwicklung zielen. In erlebnispädagogischen Aktionen sollen Menschen – im Gegensatz zu Heckmair/Michl sollte das nicht nur auf junge Menschen beschränkt sein17 – etwas lernen, herausgefordert werden, ihre Persönlichkeit gefördert und sie für die Gestaltung ihrer Lebenswelt befähigt werden.
Auch Senninger betont diesen pädagogischen Impetus:
„Der Bewusstseinsprozess wird dabei [bei erlebnispädagogischen Maßnahmen] gezielt gefördert, um zu eigenständigen Entscheidungen gelangen zu können.“18
Erlebnispädagogik ist nach Senninger zielorientiertes Arbeiten, das sich aller Sinne bedient und einen Bewusstseinsprozess fördern will und somit den Teilnehmer zu einem eigenständigen Entscheiden und damit auch Handeln führen will.
Rutkowski betont noch einen weiteren Aspekt:
„Erlebnispädagogik ist eine auf Ziele hin ausgerichtete, aber prozessorientierte pädagogische Intervention mit Medien, welche Ereignisse ermöglichen, die sich stark vom Alltag der Adressaten unterscheiden. “19
Ihm geht es bei Erlebnispädagogik um eine an den Prozess des Gruppengeschehens angepasste ganzheitliche Intervention, um ein Ziel zu erreichen. Dabei spielt das Medium eine untergeordnete Rolle. Er fragt zunächst nach dem Ziel und erst anschließend mit welcher Intervention, durch welches Medium (Kajak, Klettern, Kooperationsübungen etc.) dieses erreicht werden kann.
Von Erlebnispädagogik lässt sich aus diesen Definitionen folgernd nur dann reden, wenn das Konzept und die Maßnahme primär ein pädagogisches Ziel verfolgen, das sich aber nur nach vorangegangener Analyse der Gruppe oder des Teams erstellen lässt,20 wobei Lernprozesse angestoßen und begleitet werden und die Persönlichkeit des Einzelnen gefördert wird. Wenn dabei die Erlebnisintensität steigt, ist das in Ordnung, sollte aber nicht im Vordergrund stehen.
Fazit einer Definition
Erlebnispädagogik darf nicht nur als Methode oder Aktion, als „Kick“ und „Nervenkitzel“, verstanden werden. Es geht auch nicht primär nur um Ausbildung und Training von Soft Skills, noch sind die Aktivitäten nur auf den Naturraum und Natursportarten begrenzt. Vielmehr ist Erlebnispädagogik als ein Gesamtkonzept zu verstehen. Es fokussiert ein ganzheitliches Lernen mit Kopf, Herz und Hand durch unterschiedlich herausfordernde Aktivitäten und will dadurch Zustands- und Entwicklungsprozesse anstoßen und den Teilnehmer in seiner Entwicklung fördern und fordern. Dabei steht nicht das Erlebnis im Mittelpunkt, es geht „nicht um das Erlebnis selbst, vielmehr um seine bildende, entwicklungsfördernde Funktion“.21
Dieser Ansatz führt zu der folgenden Definition:
„Erlebnispädagogik ist ein handlungs- und erfahrungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. Physisch, psychisch und/oder sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive und von einem Pädagogen moderierte undmit den Teilnehmern reflektierte Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zu einer verantwortlichen Gestaltung ihrer Lebenswelt zu befähigen.“
In Erweiterung zu Paffrath ist der Aspekt der Moderation durch einen Pädagogen (wobei dieser Begriff hier sehr weit gefasst wird) und die ausdrückliche Erwähnung der Reflexion mit den Teilnehmern dazugekommen. Außerdem wurde Paffraths „verantwortliche Mitwirkung in der Gesellschaft“ erweitert in „verantwortliche Gestaltung ihrer Lebenswelt“, um die weiteren sozialen Bezüge des Teilnehmers aufzugreifen.
Lernen mit Kopf, Herz und Hand
Erlebnispädagogik erhebt den Anspruch, dass Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse in Teilnehmern initiiert und angestoßen werden. So ist in der Pädagogik seit Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) der pädagogische Grundsatz „Lernen mit Kopf, Herz und Hand ist effektiver“ geläufig. Es gilt den Menschen in seiner Ganzheit zu sehen und nicht nur in seiner Kognition. Es ist unbestritten: Je mehr Sinne in Anspruch genommen werden, desto besser werden Inhalte behalten und verinnerlicht. Es ist allgemein anerkannt (Behaltenskoeffizient), dass wir nur 10 % von dem behalten, was wir lesen, immerhin 20 % von dem, was wir hören, 30 % von dem, was wir sehen, aber 50 % von dem, was wir hören und sehen, 70 % von dem, was wir sehen, hören und selbst sagen und 90 % von dem, was wir danach auch selbst tun. Nicht umsonst heißt es, dass jemand etwas „begriffen” hat. Von Konfuzius stammt die Aussage: „Sage es mir, und ich vergesse es; zeige es mir, und ich erinnere mich; lass es mich tun, und ich behalte es.“
Grafik 2: Behaltenskoeffizient
Die „E-Kette“: Ereignis – Erlebnis/Erleben – Erfahrung – Erkenntnis/Einsicht
Mittels der „E-Kette“22 lässt sich dieser Prozess des erlebnispädagogischen Lernens beschreiben: Ein Mensch durchlebt seinen Alltag ohne besondere Vorkommnisse.
Im Gegensatz zu „leben“ – so Zielke23 – setzt das „Erleben aber Bewusstsein“ voraus, d. h. ein nicht alltägliches Ereignis oder eine nicht alltägliche Handlung, denn alltägliche Handlungen werden automatisch erledigt, sie benötigen kein bewusstes Nachdenken.24 Aus diesem nicht alltäglichen Ereignis (z. B. einer erlebnispädagogischen Aktion) kann mit Hilfe von Emotionen ein Erlebnis werden, anders ausgedrückt: die Person kommt ins Erleben, sie ist mit allen Sinnen dabei und gefesselt, weil es sie persönlich berührt. Mit solch einem Erlebnis ist ein Vorgang verbunden, der auf die beteiligte Person wirkt und so werden Ereignisse individuell bearbeitet und verarbeitet.
„Dies bedeutet, dass ein bestimmtes Ereignis nicht einfach ein Erlebnis ist, sondern es für den Einzelnen zum Erlebnis wird, wenn es sich von seinen bisherigen Erfahrungen unterscheidet.“25
Aus diesen Erlebnissen können dann Erfahrungen werden, wenn sie durch Reflexion, oftmals von außen angestoßen und adäquat unterstützt, verarbeitet werden, die zu einer „Zustandsveränderung in der Struktur des Systems“ führt. Aus diesen Erfahrungen erwachsen „schließlich Erkenntnisse, aus diesen können möglicherweise Einsichten resultieren, die als die höchste Stufe menschlicher Weisheit zu bezeichnen sind“.26
Damit wird auch deutlich, dass sich „Erlebnisse per se nicht kreieren und steuern lassen“27





























