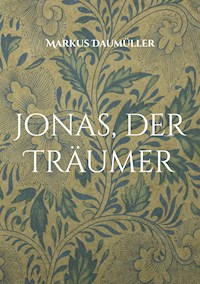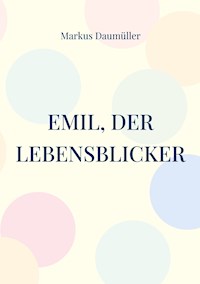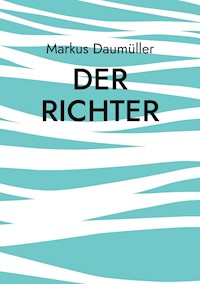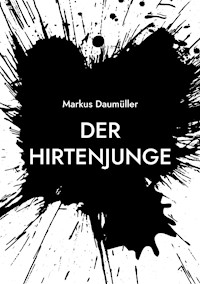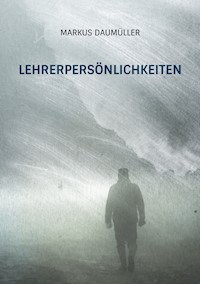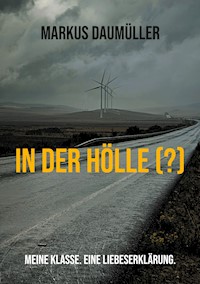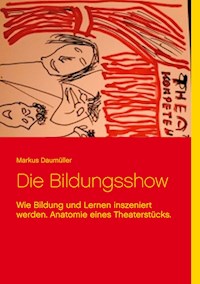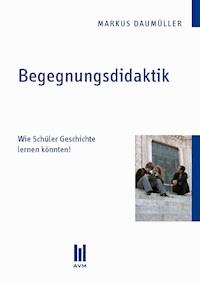Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die 'Neue Lernkultur' ist der größte Bildungs-Bluff, den sich die Schulpolitik in den letzten Jahrzehnten erlaubt hat. Sie hält nicht, was sie verspricht. Und sie hat Chaos in den Schulen angerichtet. Es wird Zeit für eine schonungslose Analyse!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erledigung
Die Erledigung des Lernens
Verzwergung
Die Verzwergung des Denkens
Banalisierung
Die Banalität der Zwergenbildung
Seelenlosigkeit
Die Seelenlosigkeit der Bildungszwerge
Kampfesunlust
Wer rettet die Bildung?
De-Demokratie
Wer rettet die Demokratie?
Bildungs-Alles
Alles ist Bildung statt Bildung ist alles.
Vorwort
Dennis muss heute sein Lernpaket bearbeiten. Da sind allerlei Aufgaben drin, aus zahlreichen Fächern. Mal soll er eine Seite im Geschichtsbuch lesen und wesentliche Ereignisse notieren, mal soll er im Englisch-Workbook drei Seiten lang die Zeitformen in Lückentexte einfügen; in Mathematik muss er bei unterschiedlichen Dreiecken die Pythagoras-Gleichung richtig lösen. Weder geht es darum, wie die Narration des historischen Ereignisses konstruiert ist, noch geht es um die Bedeutung der Zeitverwendung in einer Erzählkonstellation. Der Pythagoras schließlich bleibt ein Thema; als Heuristik in einem Problemlösekontext wird Dennis ihn in diesem Lernpaket nicht kennen lernen. Ob seine Arbeit ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ ist, wird an einer klaren Sachstruktur bemessen, die aber eine Lerninsel bleibt. Wissen begegnet ihm als unveränderbares Netz, das man sich Stück für Stück anzueignen hat, wenn man vorwärts kommen will. Was Wissen ist, wird nicht gefragt. Die Qualität von Lernen verharrt in der reinen Phänomenologie der Dinge und läuft nicht Gefahr, dem intellektuellen Durst zum Opfer zum Fallen, der nach so etwas wie Wahrheit fragt. Denn die addierte Sachstruktur scheint teflonklar und ewig gültig. Aneignen ist das Zauberwort dieses neuen Lernens. Erledigen belangloser Sachbearbeitungs- Aufgaben ist sein Werkzeug.
Im Erledigungsarbeiten denken wir nicht selbst, sondern das Denken hat sich in der Struktur des Arbeitsablaufs materialisiert. Das bedeutet: Wir interpretieren nicht mehr, wir werten nicht mehr, wir bilden uns keine Meinung, wir beziehen keine Stellung, wir wechseln nicht die Betrachtungsperspektive und diskutieren nicht mehr mit den Mitlernenden über die Bedeutung eines Ereignisses oder Sachverhalts, z.B. darüber, was ein angemessener Umgang mit Geschichte ist. Wir probieren nicht mehr, Probleme zu lösen (Was ist Gerechtigkeit?), und wir sind nicht mehr das, was die Protagonisten des selbstgesteuerten Arbeitens immerfort als wichtigstes Argument ihrer Pamphlete anführen: Mündig. Eine selbstgesteuerte Interaktion ist im Erledigungsablauf nicht vorgesehen. Stattdessen werden Lernende wie Arbeiterinnen in Billigtextilfabriken vor Aufgaben gesetzt, deren Lösungsschemata schnell Routine werden. Aber dann, wenn die Aufgaben ‚erledigt‘ sind, hört dieses Lernen schon auf, an seiner problematischsten Stelle. Jetzt hat man vielleicht alle Pronomen und Wortkonstellationen aus einem Text herausgearbeitet. Aber über Literatur hat man noch immer nicht diskutiert. Diese erbärmliche Reduktion von Lernen auf einen operationalisierbaren Output entmündigt Menschen und macht sie zu Sklaven der Reproduktion einer vorgegebenen und scheinbar objektivierbaren Sachstruktur. So bringt die neue Lernkultur permanent etwas hervor, das sie zu überwinden vorgibt: Einen Funktionärscharakter – Menschen, die eine Aufgabe in einem System erledigen, ohne über dieselbe oder dasselbe nachdenken zu dürfen, weil sie oder es bereits positiv etikettiert wurde(n). Aber Menschen, die sich sicher in einem System bewegen – die also Konformisten geworden sind – haben ihre Seele an das System abgetreten, sie konstruieren keine Beziehung mehr zu dem, was sie stundenlang tun, weil ihnen abtrainiert worden ist, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen. Das ist in der Sachbearbeitung nicht erwünscht. Das ist aber auch das Gegenteil von Bildung. Man redet von Individualisierung des Lernens, entindividualisiert aber den Bildungsbegriff. Es ist noch nicht einmal Lexikon-Wissen, mit dem man sich beschäftigt; es blendet alle interdependenten und dialektischen Prozesse aus und reduziert Wissen auf die bloße Kumulation von Spiegelstrichen. Es ist das reinste Nichts. Sozusagen die blanke Simulation von Lernen und Wissen. Denn es vergewaltigt die komplexe Struktur von Wissen und reduziert Lernen auf die Aneignung von Aufzählungen.
Lehrer sind dabei nicht länger die Fachleute für Lernen, und auch die Wissenschaft hat nicht mehr viel zu sagen. Wie Lernen abläuft, bestimmt jetzt der sozialpolitische Zeitgeist. Steht er für ‚Chancengleichheit‘ und ‚soziale Gerechtigkeit‘, so wird diese politisch korrekt übersetzt mit ‚Individualisierung des Lernens‘. Diese individualisiert aber nicht das Lernen, da Lernen immer bereits ein individueller Vorgang ist. Sie schafft vielmehr uniformierte Abläufe einer Lernorganisation, deren künstliche Differenzierung (lassen sich Verstehensprozesse in Niveaus unterteilen?) dann für Individualisierung steht. Die Wertigkeit von Lernen liegt also in der Lernorganisation; diese steht für politisch oder gesellschaftlich erwünschte Werte; sie liegt nicht mehr in dem Willen von Bildungsbeteiligten, dass aus Schülern gebildete Menschen werden. Dass die lernenden Menschen, anders, als es uns die individualisierte Lernorganisation vorgaukelt, nicht mehr im Mittelpunkt von Bildungsprozessen stehen, sondern für einen (z.B. sozialpolitischen) Zweck instrumentalisiert werden, ist eigentlich ein Skandal. Aber niemanden interessiert das, weil die meisterhafte Rhetorik der ‚Bildungsreformer‘ mit ihrer selbstimmunisierenden Sprache eine Konnotation im Bewusstsein der Eltern und der Öffentlichkeit geschaffen hat: Reform ist gleich Fortschritt, und wir gestalten ihn so, dass er allen hilft. Diesen Zusammenhang darf man getrost Gerechtigkeitsfalle nennen. Denn der vermeintliche Fortschritt besteht nur aus Schlagwörtern, die synonym für Pädagogik und Bildung verwendet werden. Er suggeriert, dass die Lernorganisation und nicht mehr Wille oder Haltung von Lernenden Voraussetzung für Lernerfolg seien. Die Gleichschaltung des Denkens in der Lernstruktur avanciert dabei zu einem Qualitätsbegriff von Bildung. Das ist mehr als nur das Gegenteil von Individualisierung. Die chinesische Führung, so vermelden es mehrere Online- Portale, möchte bis 2020 ein Punktekonto für das Sozialverhalten ihrer Bürger einrichten. „Der Zentralcomputer sammelt Daten von 50 Behörden. Er vergibt Pluspunkte für gewolltes Verhalten. Und er zieht Punkte ab, wenn Menschen irgendwie abweichen und gegen Regeln verstoßen.“ Dann bekommt man Probleme, wenn man eine Wohnung sucht oder studieren möchte. „Wie Big Brother in George Orwells Roman ‚1984‘ greift die Kommunistische Partei unter Staatsund Parteichef Xi Jinping damit tief in die Privatsphäre der Menschen ein.“ Das Ziel: "Die Vertrauenswürdigen sollen frei unter dem Himmel umherziehen können, während es den in Verruf Geratenen schwer gemacht wird, einen einzigen Schritt zu tun. So steht es im Regierungsplan für die Einführung des Sozialregisters.“1
Die neu geschaffene Lernkultur mit ihren Fortschrittsfloskeln bedeutet in Wahrheit wie das chinesische Punktesystem eine unfassbare Entwertung der Menschen, die nun der Macht anonymer Abläufe und Prozesse ausgesetzt werden, denen sie zu gehorchen haben. Die politisch korrekte Übersetzung der Bekämpfung sozialer Ungleichheit in eine Lerntechnokratie, die jedem gerecht werden soll, folgt keinem humanistischen oder philosophischen Menschenbild; sie kennt nur noch Abläufe, in deren Erscheinungsbild der vermeintliche Klassenkampf der Gesellschaft harmonisch aufgelöst erscheint. Wir sehen jedoch am Beispiel Chinas, wie schnell eine solche Struktur pervertieren und einem Zweck unterworfen werden kann, dem sie zu dienen hat.
Weitaus naheliegender ist, dass mit der ‚individualisierten‘ Bearbeitung von Lernpaketen alles zertrampelt wurde, was Lernen zu einem intimen Vorgang macht: Die individuelle Beziehung eines Lernenden zum Lerngegenstand, die Anstrengungsbereitschaft und der Wille, ein Experte auf einem Fachgebiet zu werden, die Erweiterung des biographischen Horizonts. Für was steht der Begriff Lernen dann noch? Für die Erledigung belangloser Übungsaufgaben, die sich messen lässt; für eine Sachbearbeitung, die ohne Erkenntnisse bleibt. Die tiefergehende Beschäftigung mit einem Problem oder Sachverhalt wird von einer oberflächlichen Eventkultur – der ‚guten‘ Präsentation von ‚Wissen‘ bzw. dem, was man glaubt, dass es sei, abgelöst. Die Intimität von ‚Lernen‘ wird zertrampelt; wer wie und auf welchem ‚Niveau‘ lernt, das bestimmt die ‚Neue Lernkultur‘. Sie schreibt vor, in welchen Denkräumen sich jemand zu bewegen hat. Eine deutlichere Stigmatisierung des Denkens mag man sich kaum mehr vorstellen; die Menschenverachtung dahinter ist uferlos. Die Erziehung bzw. Diskriminierung des Denkens steht in einem auffälligen Widerspruch zu der politischen Korrektheit, die in der Technokratie der Lernabläufe abgebildet werden sollte. Es ist festzuhalten: In der neuen Lernkultur geht es nicht um das Wesen von Lernen. In ihr beschäftigen sich alle nur noch damit, Lernen zu simulieren. Und es geht auch nicht um die Menschen, die lernen und sich bilden sollen. Es geht um die politische Deutung von Werten, der sich das ganze Bildungssystem zu unterwerfen hat. Wenn keiner mehr selber denkt, dann ist das bekanntermaßen das Ende der Bildung. Es bleibt nur noch eine Hülle, die in den Farben der Gesellschaftspolitik leuchtet. Der leuchtende Bildungsball, innen heiße Luft, außen oho, steigt in die Höhe, ein Event des Fortschritts, der alle glücklich macht.