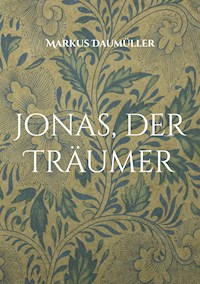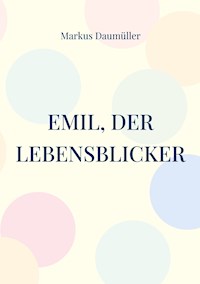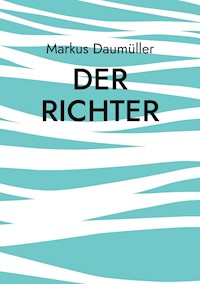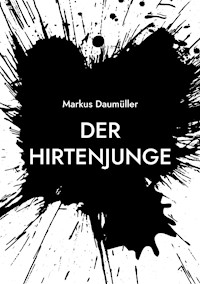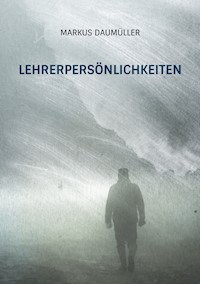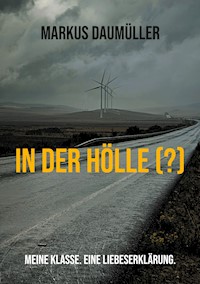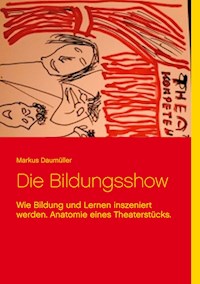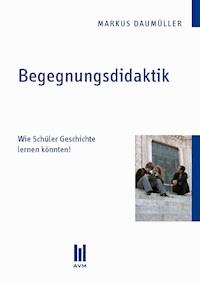3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Geschichtsunterricht ist in der Schule oftmals nicht sehr innovativ. Hier erhalten Sie Anregungen, das zu ändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 35
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Geschichte denken
Begriffe
Begriffe sezieren
Denkstile
Denkstile für unerklärbare Phänomene entwickeln und vergleichen
Geschichte entsteht
Geschichte entsteht. Handlungsdilemmata: Entscheidungen durchlaufen
Metakognitionen
Ideengeschichte diskursiv
Sinnkonstruktionen
Sinnkonstruktionen von Personen rekonstruieren: Hermeneutisch arbeiten mit Schülern
Abstrakta
Vom Fall abstrahieren und Handlungsmaxime abstrahieren, meistens Werte`
Erfahrungen
Erfahrungen der Schüler einbinden in die Diskussion fallbezogener Handlungen
1. Begriffe
Geschichte unterrichten bedeutet, dass nichts klar ist - besonders nicht die Begriffe. Held, Täter, Nazi, Revolutionär – alle Bedeutung hängt von der Erzählabsicht und den Erzählumständen ab. Wenn der Judenrat Murmelstein die Vergrößerung des Ghettos Theresienstadt mit vereinbarte, aber sein Ziel die Verzögerung der Deportationen war, ist er von der Funktion im System her ein Täter. Von seiner Absicht und seinem Thema her nicht. Der Begriff oszilliert zwischen juristischer Tat, moralischer Absicht, dem verfolgten Ziel und dem Charakter des Handelnden. Welcher Aspekt trifft die Wahrheit am besten? Das hängt von der Interpretation und dem Wertsystem des Betrachters ab. Und von den Kategorien, mit denen er Täterschaft assoziiert.
Ein anderer schillernder Begriff ist Nazi: Wann kann man davon sprechen, dass jemand ein Nazi ist? Macht man es an der Gesinnung einer Person fest? Oder an ihrer Funktion in einem System? Reicht eine formale Mitgliedschaft aus? Was unterscheidet die Person von jemandem, der sich verstrickt hat, weil er sich Unannehmlichkeiten ersparen wollte? Emil Nolde denunzierte Kollegen. Er war überzeugt, obwohl die Nazis hunderte seiner Bilder beschlagnahmt haben. Warum eigentlich bewahren Intelligenz und die Fähigkeit zu symbolischem Denken nicht davor, sich in ein menschenverachtendes System mit einer plumpen Ideologie zu verstricken?
Auch das Phänomen der Revolution ist ein solches Beispiel: Montesquieu stand auf der Gehaltsliste des Königs. Sein Ziel war, einige revolutionäre Ideen durch Kollaboration zu realisieren. Robespierre wollte einen radikalen Bruch mit dem Alten und alle Zöpfe des Ancien Regime abschneiden, damit die neuen Ideen Wirkung entfalten können. Wer ist der bessere Revolutionär? Der Stratege oder der Babar?
Reflexionen, die das Drehen, Wenden und Herumreiten von Begriffen zum eigentlichen Thema des Diskurses machen, verbinden Pädagogik und Fachlichkeit. Der Unterricht wird zu einem Denkraum für die Schüler. Diese entwerfen Wertmaßstäbe für das Beurteilen von Handeln, konstruieren Kategorien für die Bedeutung von Phänomenen und Begriffen und kommen ins Gespräch darüber. In den Mittelpunkt des Unterrichts gerät der Umgang mit Geschichte, nicht das Geschehen selbst. Keine erklärenden Kausalitäten werden aufgezählt, die Verstehen nur simulieren. Im besten Sinn gelten Diltheys Worte: Phänomene der Natur erklären wir, soziale Phänomene verstehen wir.
Das Handeln von Figuren ist deshalb ein idealer Reflexionsansatz, weil Schüler in der Reflexion von Werten ausgehen können, die ihnen in ihrer Erfahrung wichtig erschienen: Mut, Aufrichtigkeit, Treue, Freundschaft, Idealismus: Ihre Erfahrungen werden Teil des Wissens, das in der multiperspektivischen Diskussion entsteht. Es ist nicht nur ein didaktischer Trick der Veranschaulichung, sondern es geht um die ontologische Einbindung der Lernenden in die Entstehung von Wissen. Sie sind Akteure eines hermeneutischen Prozesses der Rekonstruktion von Sinnkonstruktionen. Das geht mit Verstehen einher. Die historischen Umstände fließen als Korrelat in diese Rekonstuktionen ein. So entfalten sie die Urstruktur historischen Verstehens: Die Dialektik zwischen Einzelnem und Allgemeinem, wie Droysens sie in seiner Historik beschrieb.
Über Wertediskussionen ist es möglich, auch schwächere Schüler zur Beteiligung zu bringen. Begriffsreflexionen setzen an Erfahrungen an, führen dann in abstrakte Ebene des Verstehens. Ihre Auslegungen enthalten metaphorisches und philosophisches Denken. Sie haben eine hohe Varianz von Verstehensebenen.
Im Geschichtsunterricht entwickeln Schüler ethisches Bewusstsein. Die Geschichte ist das Vehikel für diese Persönlichkeitsentwicklung. Begriffe zu reflektieren ist also nicht nur ein historisches Verstehen. Die Schüler sind eingebunden in die Entstehung von Wissen, das immer vorläufig ist, sie werden ein Teil dieses Wissens. Perspektivität charakterisiert fluides Wissen; dieses besteht sozusagen aus ihr. Wissen ist in einem solchen Unterricht nicht faktengebunden. Denn auch Fakten geraten in Erzählungen zu Konstruktionen. Wissen besteht darin, wie man historisches Geschehen, Figuren und deren Handeln verstehen kann. Es artikuliert sich im Verhandeln von Denkstilen.
Nach dieser Einleitung werden das Sezieren und Durchdenken von Begriffen sowie das Verhandel über ihre Denkmöglichkeiten fachdidaktisch und lerntheoretisch präziser erörtert.