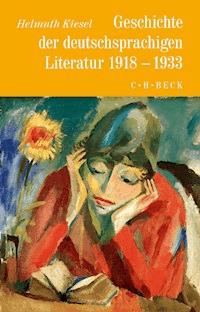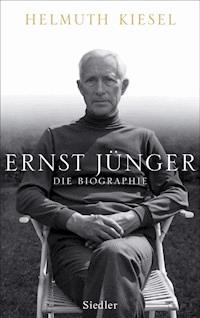
8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ernst Jünger – der umstrittenste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts
Der Schriftsteller Ernst Jünger war eine Jahrhundertgestalt. Geboren im Kaiserreich und gestorben erst nach der Wiedervereinigung , spiegelt sein Leben wie kaum ein zweites die zentralen Wendungen und Widersprüche der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zehn Jahre nach Jüngers Tod schildert Helmuth Kiesel lebendig und kenntnisreich Jüngers Leben und Werk im Kontext seiner Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1147
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,4 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
ERSTER TEIL - Geborgenheit und Abenteuerlust
1895
Familienchronik
Copyright
EINLEITUNG
Zwei Mal Halleyoder Die Verdüsterung der Welt
April 1986. Ernst Jünger hat am 29. März seinen einundneunzigsten Geburtstag gefeiert und ist wenige Tage später, begleitet von seiner Frau, zu einer Reise nach Malaysia aufgebrochen. Er will seine Käfersammlung komplettieren, und er hofft, in der klaren Luft des malaiischen Berglands einen besonders guten Blick auf den Halleyschen Kometen zu haben. Dieser zieht nach sechsundsiebzig Jahren wieder einmal an der Erde vorüber: zum zweiten Mal in Jüngers Leben. Wie immer wird Tagebuch geführt, werden die Stationen der Reise festgehalten, allerlei Beobachtungen notiert und mit manchmal weit ausgreifenden Reflexionen verbunden. Am 8. April trifft Jünger in Kuala Lumpur ein und wird von Wolfram Dufner, dem deutschen Botschafter, mit dem Jünger seit 1954 bekannt ist, in Empfang genommen. Am 11. April fahren die Ehepaare Dufner und Jünger nach Frazer’s Hill. Dort liegt - auf 1600 Meter Höhe über dem mehr als hundert Millionen Jahre alten malaiischen Urwald - die ehemalige Bergresidenz des englischen Gouverneurs, die nun als Erholungs- und Gästehaus der Regierung dient. Täglich klingelt der Wecker um fünf Uhr, weil der Komet kurz danach über den Baumwipfeln auftauchen müßte. In den ersten drei Nächten ist jedoch der Himmel bedeckt, und die Hoffnung, den Kometen ein zweites Mal sehen zu können, schmilzt, weil die Rückreise schon für den 15. April geplant ist. Aber dann kommt es doch zu einem »Wiedersehen«. Unter dem Datum des 15. April vermerkt das Reisetagebuch, das 1987 unter dem Titel Zwei Mal Halley als Monographie erscheint und 1995 die Tagebuchfolge Siebzig verweht IV eröffnet:
Wolfram Dufner klopfte an - um, wie ich dachte, uns zur Abfahrt zu wecken, aber es war noch dunkel, und er rief: »Der Komet ist da!« Das war kaum zu glauben - wir stürzten in sein Zimmer, ich mit dem Feldstecher in der Hand. In der Tat - Halley stand ebenso deutlich am Himmel wie damals zu Rehburg vor sechsundsiebzig Jahren, als ich ihn mit Eltern und Geschwistern gesehn hatte. (21, 41)
»Damals zu Rehburg«: Das dürfte um den 18. Mai 1910 gewesen sein, als der Halleysche Komet der Erde am nächsten kam und viele Menschen von Untergangsängsten ergriffen wurden; Jakob van Hoddis hat damals sein epochal wirkendes Gedicht Weltende geschrieben. Die Familie Jünger, durch die Apothekertätigkeit des Vaters und eine Beteiligung am Kalibergbau wohlhabend, bewohnte in Bad Rehburg, einem kleinen Kurort am Steinhuder Meer nordwestlich von Hannover, eine schöne Villa. In einer der Nächte, in denen der Komet zu sehen war, muß der Vater die Familie vors Haus gerufen haben, um ihr die Erscheinung zu zeigen. Daran erinnert sich nun der Tagebuchschreiber in Kuala Lumpur, und er verbindet mit dieser Erinnerung eine Reflexion auf die geschichtliche Erfahrung, die ihm seitdem zuteil wurde, und auf die epochale Differenz zwischen der Zeit um 1910 und der Gegenwart von 1986:
Ich glaube, es war Ranke, der sagte, als Historiker müsse man alt werden, denn nur, wenn man große Veränderungen persönlich erlebt habe, könne man solche wirklich verstehen. Er wird damit wohl weniger den einzelnen Vorgang als den Gewinn an Erfahrung gemeint haben. Das Verhältnis ähnelt dem des Soldaten, der nur auf dem Exerzierplatz geübt, zu jenem, der auch im Gefecht gestanden hat.
Wieviel Zeit muß verfließen, ehe man den eigenen Vater versteht. Wenn ich an ihn zurückdenke, um den wir damals vor unserem Hause standen - die Mutter, vier Söhne und die Tochter -, will es mir scheinen, daß er einerseits typisch die Epoche vertrat, in der er lebte, sich andererseits von ihr kritisch distanzierte und zudem archaische Züge besaß.
Typisch für die Epoche war schon das Bild, das wir boten: der Vater inmitten seiner großen Familie. So hielt es der Kaiser, hielten es die meisten unserer Bekannten und die Bauern ringsum. In gewissen Abständen mußten wir, was mir nicht angenehm war, mit ihm nach Hannover fahren - erst zum Friseur, dann zum Photographen, möglichst an einem Tag, an dem im Theater eine Mozartoper gespielt wurde.
Das Bild ist zugleich archaisch: die Familie bei der Betrachtung eines ungewöhnlichen Zeichens am Himmel; ein Rest von Ehrfurcht läßt sich nicht abweisen. […]
Was einer glaubt oder nicht glaubt, ist nicht belanglos, doch nebensächlich - es gehört zu den zeitlichen Umständen. Der Vater hielt nicht viel vom Jenseits, und doch habe ich ihn in der Glorie gesehen. Er meinte, daß man in seinen Kindern weiterlebt. Sie würden sich an ihn erinnern, so wie er selbst sich an seine Großeltern, besonders die westfälischen, erinnerte. Es war wohl in dieser Stimmung, in der er sagte, als wir damals beisammenstanden: »Von euch allen wird Wolfgang vielleicht den Kometen noch einmal sehen.«
Wolfgang war unser Jüngster, doch auch der erste von uns Geschwistern, der starb. So trete ich für ihn ein.
Wir betrachteten das Gestirn lange; der Himmel über dem Urwald blieb klar. Wenn etwas bei der Begegnung fehlte, so der Enkel, dem ich den Erinnerungsgruß an Halley hätte weitergeben können - die nächste Wiederkehr wird, wenn ich richtig gezählt habe, im Jahr 2062 stattfinden. Und wenn sich etwas geändert hat, so die Stimmung - vom Optimismus, mit dem der Vater seine Prophezeiung aussprach, blieb keine Spur zurück. (21, 42 und 44)
In der Tat: Von dem Optimismus, der das Lebensgefühl der Menschen um 1910 - wenn auch nicht unangefochten - bestimmte, war um 1986 nichts mehr zu spüren. Zwei Weltkriege und der Holocaust, die Ost-West-Konfrontation und die atomare Hochrüstung, eine Reihe von Wirtschaftskrisen und die immer deutlicher werdende Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt durch das rapide Wachstum der Industriegesellschaft hatten dazu geführt, daß man in der Erwartung von militärisch herbeigeführten oder zivilisatorisch verursachten Katastrophen globalen Ausmaßes lebte. 1986 erschien mit der Rättin von Günter Grass ein Roman, der die »Erziehung des Menschengeschlechts«, die von Lessing einst voll aufklärerischer Zuversicht imaginiert und beschworen worden war, in den alles durchdringenden Lichtblitzen einer zufällig ausgelösten atomaren Katastrophe enden sah. Und das war weder das einzige noch das erste Buch dieser Art: Drei Jahre zuvor hatte Christa Wolf mit ihrer Erzählung Kassandra und den dazugehörigen Vorlesungen eine ähnliche Prophetie ausgesprochen. Und noch ein paar Jahre früher, 1978, hatte Hans Magnus Enzensberger mit seinem Pasticcio Der Untergang der Titanic und den gleichzeitig erschienenen Randbemerkungen zum Weltuntergang das Ende aller Fortschrittsideologien konstatiert und eine soziale und zivilisatorische Dauerkatastrophe in Aussicht gestellt.
Auch Jünger stand solch düsteren Erwartungen nicht fern; ja, er war einer der ersten, der ihnen Ausdruck verlieh: Sein Roman Eumeswil, der 1977 erschien und somit die Reihe der apokalyptischen Bücher jener Jahre anführt, handelt von einer Zeit jenseits der großen »Feuerschläge« und sieht die Erben des »Letzten Menschen« in einer Welt leben, die den Charakter einer »Deponie« hat. Eumeswil ist die Summe einer von Katastrophen geprägten Geschichtserfahrung, die bald nach 1910 einsetzte und Jünger zunächst zum Aktivisten der zivilisatorischen Modernisierung machte, dann aber zum entschiedenen Zivilisationskritiker werden ließ. Sein Werk ist eine erfahrungsgesättigte dichterische Chronik der vielfältigen Verfehlungen und Destruktionen des 20. Jahrhunderts und zugleich ein Versuch, sie geschichtsphilosophisch zu deuten und zu verkraften. Mit einer kühnen, aber nicht ganz unberechtigten Formulierung hat der Philosoph Peter Koslowski gesagt, die Reihe der von 1920 bis 1990 erschienenen Schriften Ernst Jüngers lasse sich zu einem »Epos der Moderne« zusammenschließen und enthalte eine sukzessiv entfaltete und dichterisch gestaltete Philosophie der Moderne (einschließlich ihrer als »postmodern« bezeichneten Modulationen im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts).
Ernst Jünger im »deutschen Jahrhundert«
Mit einer kleinen und merkwürdig symmetrisch anmutenden Abweichung von jeweils vier Jahren umschließt die Halleysche Periode das »kurze« 20. Jahrhundert. Dieses offenbarte in der »Urkatastrophe« des 1914 entfesselten Krieges ein brutales Antlitz und stieß sich auf dramatische Weise vom gelasseneren und friedlicheren Gang des »langen« 19. Jahrhunderts ab. Und es endete, geschichtsmorphologisch gesehen, 1990 etwas vorzeitig mit der überraschenden Beseitigung der politischen Folgen, die sich aus jener »Urkatastrophe« ergeben hatten: mit dem Zusammenbruch des Ostblocks, der Beseitigung des Eisernen Vorhangs, der Wiedervereinigung Deutschlands und der Reintegration der slawischen Länder nach Europa.
Dieses Jahrhundert hätte, wie der französische Soziologe Raymond Aron und der aus Breslau stammende amerikanische Historiker Fritz Stern 1979 gesprächsweise darlegten, »Deutschlands Jahrhundert werden können«, weil Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts das modernste Land Europas war und aufgrund seiner ökonomischen Leistungen wie seiner technischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Innovationen das Potential besaß, die ökonomische und kulturelle Führungsmacht Europas zu werden. Und tatsächlich wurde das 20. Jahrhundert, wie der Historiker Eberhard Jäckel in seiner 1996 erschienenen »Bilanz« ausführte, das »deutsche Jahrhundert«, wenn auch in einem ganz anderen Sinn: »Kein anderes Land hat Europa und der Welt im 20. Jahrhundert so tief seinen Stempel eingebrannt wie Deutschland, schon im Ersten Weltkrieg, als es im Mittelpunkt aller Leidenschaften stand, dann natürlich unter Hitler und im Zweiten Weltkrieg, zumal mit dem Verbrechen des Jahrhunderts, dem Mord an den europäischen Juden, und in mancher Hinsicht gilt es kaum weniger für die Zeit nach 1945.«
Zweifellos erfährt dieser Befund eine gewisse Relativierung, wenn man den Blick über Europa hinausschweifen läßt und - wie der britische Historiker Eric Hobsbawm in seiner Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts - in Rechnung stellt, daß sich die drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund eines außergewöhnlichen Wirtschaftswachstums als »eine Art von Goldenem Zeitalter« gestalteten, in dem die Folgen der destruktiven deutschen Eingriffe in die Geschichte überspielt wurden. Und dennoch ist nicht zu vergessen, daß Deutschland im »kurzen« und zunächst einmal katastrophalen 20. Jahrhundert eine fatale Rolle gespielt und eine außerordentliche historische Schuld auf sich geladen hat. Von daher aber fällt ein Schatten auf fast jedes deutsche Leben, das mit dem beginnenden 20. Jahrhundert zu seiner verantwortlichen Entfaltung kam.
Dies gilt in besonderer Weise für den 1895 geborenen Ernst Jünger, der mit dem »Großen Krieg« nicht nur mündig, sondern auch gleich prominent wurde und in der Nachkriegszeit, die - nach Jüngers Ansicht - nur eine neue Vorkriegszeit sein konnte, ein entschiedenes und bestimmendes Wort mitreden wollte. Was er dann in seinen Kriegsbüchern und in seinen zahlreichen politischen Artikeln publik machte, hat Aufsehen erregt und ihm eine beträchtliche Lesergemeinde verschafft, hat ihn aber auch bei vielen Zeitgenossen wie Nachgeborenen in Mißkredit gebracht und ihm schroffste Verurteilungen eingetragen. So betrachtet ihn Hans-Ulrich Wehler im vierten Band seiner Deutschen Gesellschaftsgeschichte, der die Zeit von 1918 bis 1949 behandelt und im folgenden immer wieder dankbar herangezogen wird, als einen der »intellektuellen Totengräber der Weimarer Republik«, und bei anderen Gelegenheiten wertete er ihn mit nachgerade biblisch klingenden Formulierungen als »eine der Unheilsfiguren der neueren deutschen Geschichte«, speziell als einen »der großen Verderber der neueren deutschen Geistesgeschichte«.
Die vorliegende Biographie hätte nicht geschrieben werden können, wenn der Verfasser der Meinung wäre, daß derartige Verdikte der historischen Weisheit letzter Schluß seien. Man wird sie relativieren dürfen. Die Weimarer Republik ist nicht an Ernst Jünger zugrunde gegangen, und der Anteil, den er als Repräsentant der antiparlamentarischen Rechten an ihrem Untergang gehabt haben mag, wird nicht größer sein als der Anteil, den die zahlreichen prominenten Vertreter der antiparlamentarischen Linken gehabt haben dürften (nur daß diese erst neuerdings, 2005, durch eine umsichtige und nicht abwiegelnde Studie von Riccardo Bavaj in den Blick gerückt wurden). Man sollte Jüngers Einfluß auf den Gang der deutschen Geschichte nicht überschätzen; es gab andere Wirkungspotenzen. Von den Stahlgewittern, die 1920 erstmals publiziert wurden, dürften bis 1930 etwa sechsunddreißigtausend Exemplare verkauft worden sein; von Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues wurden nach dem Erscheinen als Buch im Januar 1929 innerhalb weniger Wochen zweihunderttausend Exemplare abgesetzt. Zudem sollte man nicht übersehen, daß Jünger mit der »Bewegung«, von der Deutschland vollends ins Unheil und zu beispiellosen Verbrechen getrieben wurde, keineswegs konform ging. Und schließlich sollte man, bevor man Acht und Bann über ihn verhängt, Jüngers anhaltende Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte in ihrer ganzen Breite und Tiefe zur Kenntnis nehmen: in ihrer diagnostischen Reichhaltigkeit, ihrer ästhetischen Eindringlichkeit und ihrer allzu oft verleugneten humanen Qualität.
Es müßte denjenigen, die etwa Jüngers Bücher über den Ersten Weltkrieg nur als Dokumente einer bellizistischen Verblendung, einer barbarischen Roheit und einer verführerischen Kriegsverherrlichung betrachten, zu denken geben, daß Remarque, als er 1928 an seinem Roman arbeitete, die Stahlgewitter und das Wäldchen 125 mit größtem Lob bedachte: Diese Bücher seien, so schrieb Remarque, »von einer wohltuenden Sachlichkeit, präzise, ernst, stark und gewaltig«. Und wer meint, in Ernst Jünger eine Unheilsfigur schlechthin sehen zu müssen, möge doch bedenken, wie sehr und beharrlich Carl Zuckmayer, der seit seinem Fröhlichen Weinberg (1925) unter Nationalisten und Nationalsozialisten zu leiden hatte, Jünger trotz mancher Differenzen über Jahrzehnte hinweg schätzte. Als ihm Annemarie Suhrkamp, die Frau des Verlegers Peter Suhrkamp, die zweite, 1938 erschienene Fassung von Jüngers Abenteuerlichem Herzen zukommen ließ, schrieb Zuckmayer aus dem schweizerischen Chardonne, wohin er emigriert war, an sie:
Liebste Mirl,/es ist gar kein Zufall, dass wir uns bei Ernst Jünger begegnen: seit vielen Jahren, lang schon bevor man ihn in »unsren Kreisen« kannte, […], lese ich seine Bücher, die mich - bei aller Gegensätzlichkeit - immer wieder stilistisch, inhaltlich, gedanklich, entzücken. […] So fern mir in vieler Hinsicht die »Stahlgewitter« sind und so fremd der »Arbeiter«, den ich auch für ein ganz verfehltes Buch halte, - so nah und verwandt und geradezu hinreissend empfinde ich einige Kapitel aus »Blätter und Steine«, »Afrikanische Spiele«, und jetzt scheint mir dies neue vielleicht am schönsten. Qualität, Persönlichkeit, Sprache: es gibt nur noch ein paar Findlinge, wenigstens in unsrer Altersklasse, die das noch haben.
Diese Wertschätzung setzt sich in der Beurteilung Jüngers fort, die Zuckmayer 1943 für den amerikanischen Geheimdienst schrieb und die 2002 unter dem Titel Geheimreport publiziert wurde:
Ernst Jünger halte ich für den weitaus begabtesten und bedeutendsten der in Deutschland verbliebenen Autoren. Ich glaube, dass sowohl seine wie seines jüngeren Bruders Opposition gegen das Naziregime echt ist und mit jener nur sehr bedingten Opposition aus anderen konservativen oder Offizierskreisen nicht identisch ist. Bei den Jünger’s kommt sie aus tiefren Quellen. Es handelt sich nicht um militärisch-politische Taktiken, in denen sie etwa mit Hitler differieren, sondern um den Geist. Ernst Jüngers Kriegsverherrlichung hat nichts mit Aggression und Weltbeherrschungsplänen zu tun - sein Herren-Ideal nichts mit demagogischem Unsinn à la Herren-»Rasse«. Ohne Pazifist oder Demokrat zu sein, ist es ihm bestimmt ernst mit der Vorstellung einer Weltgestaltung vom Geist her und durch das Medium der höchstentwickelten und höchstdisziplinierten Persönlichkeit. [...].
Nach der Rückkehr aus dem Exil bemühte sich Zuckmayer um eine Begegnung mit Jünger. Sie kam nicht zustande, was Zuckmayer sehr bedauerte. Am 14. November 1967 schrieb er an Jünger: »Ihnen bisher nicht begegnet zu sein, empfinde ich als einen der größten Mängel in meinem Leben.« Das mag eine geflissentliche Übertreibung gewesen sein, aber an Zuckmayers außerordentlicher Wertschätzung für Jünger ist nicht zu zweifeln. 1970, als Jünger aus historisch-politischen wie literarischen Gründen mannigfacher Kritik ausgesetzt war, schlug Zuckmayer ihn für den Goethepreis der Stadt Frankfurt vor. Zur Begründung schrieb er unter anderem, es gebe »kaum ein anderes Gesamtwerk eines lebenden deutschen Schriftstellers«, das nach »literarischem und intellektuellem Rang« dem von Ernst Jünger voranzustellen sei.
Mit diesen Hinweisen auf eine anerkennende Rezeption durch Zeitgenossen, denen man ein Urteil wohl zutrauen darf, sollen Jüngers Leben und sein Werk nicht für sakrosankt erklärt werden. Sie müssen sich selbstverständlich eine kritische Musterung und eine Beurteilung auch nach heutigen Maßstäben gefallen lassen. Doch verlangt die Gerechtigkeit auch die Berücksichtigung der geschichtlichen Umstände, und das Interesse an einer möglichst breiten und eindringlichen historischen Erkenntnis sollte von einer Tabuisierung bestimmter Gegenstände abhalten. Im übrigen ist komplexen Sachverhalten - und der Gegenstand dieses Buches darf wohl als ein solcher bezeichnet werden - nicht mit einfachen Formeln beizukommen.
ERSTER TEIL
Geborgenheit und Abenteuerlust
Ernst Jünger in der Fremdenlegion, Herbst 1913
Die Die Jünger-Geschwister um 1912: Friedrich Georg, Johanna Hermine, Wolfgang, Ernst und Hans Otto: herausgeputzt, aufgeweckt, selbstbewußt. Der Vater hat im Kali-Bergbau reichlich Geld verdient, die Währung ist stabil, die Wirtschaftfloriert, Deutschland ist eine Großmacht. Die junge Generation spürt die »Sekurität«und blickt erwartungsvoll in die Zukunft.
1895
1895, Jüngers Geburtsjahr. Die Fertilitäts- oder Geburtenrate ist um 1895 in Deutschland so hoch wie nie zuvor und nie wieder danach. Das hat seinen Grund: Mehrheitlich blicken die Deutschen in diesen Jahren mit Stolz auf ihr Land, mit Zufriedenheit auf ihre Situation und mit Optimismus in die Zukunft. Der siegreiche Krieg gegen Frankreich, der zur nationalen Einigung und Gründung des Deutschen Reichs geführt hat, liegt ein Vierteljahrhundert zurück, und seither lebt man - trotz einiger konjunktureller Einbrüche und sozialer Spannungen - in einer Zeit der Prosperität und der Modernität, der Neurasthenie und der Vitalität, des national(istisch)en Größenbewußtseins und der imperialistischen Aspirationen, des Fortschrittsdenkens und der Sekurität.
Prosperität und Modernität, Neurasthenie und Vitalität, Nationalismus und Imperialismus, Fortschrittsdenken und Sekurität -: Diese acht Begriffe markieren, was man in Anlehnung an die Astrologie, die aus der Konstellation der Gestirne bei der Geburt eines Menschen auf dessen Charakter und Lebensgang schließen will, als die soziale Nativität oder Geburtskonstellation Ernst Jüngers bezeichnen kann: als das Ensemble der sozialen - und das heißt allemal auch: kulturellen, politischen, ökonomischen - Gegebenheiten oder Umstände, die für den Lebensweg des 1895 Geborenen von weitreichender Bedeutung sein sollten. Die geschichtlichen Sachverhalte, die mit diesen acht »Merkworten« (Herder/Hofmannsthal) jener Epoche aufgerufen werden, haben Jünger ursprünglich geprägt und auf eine Bahn gelenkt, die ihn zunächst einmal zum Aktivisten der deutschen Katastrophe werden ließ. Sich ihr zu entwinden, war nicht leicht.
Prosperität: Die Gründung des Deutschen Reiches fiel mit einer konjunkturellen Aufwärtsbewegung zusammen und intensivierte diese noch einmal beträchtlich. 1873 aber kam es zu einer Weltwirtschaftskrise, die auch in Deutschland - trotz eines kontinuierlichen Wachstums - zu wiederholten Konjunkturkrisen und einer anhaltenden Deflation führte. Die Folgen waren ein markanter Verfall von Preisen, Gewinnen und Renditen sowie Lohnsenkungen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Diese »Große Deflation« hielt bis in die neunziger Jahre an. 1895 aber ist sie überwunden. Es beginnt ein furioser wirtschaftlicher Aufschwung. Die Wachstumsrate schnellt empor, erreicht 4,5 Prozent und bleibt trotz einiger Depressionsjahre bis 1913 auf diesem Niveau. Die Auswanderung geht stark zurück, die Einwanderung nimmt zu. Einkommen und Löhne steigen deutlich und kontinuierlich an und erlauben die Entwicklung eines höheren Lebensstandards auf breiter Ebene, auch wenn klassenspezifische Differenzen groß bleiben und manifeste Armut noch weit verbreitet ist. Aber: Die wirtschaftliche Entwicklung, die sich um 1894/95 abzuzeichnen beginnt, weckt Hoffnungen und erlaubt einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Deutschland wird nach den Vereinigten Staaten von Amerika und neben Großbritannien die zweit- oder drittgrößte Wirtschaftsmacht und zum »Workshop of the World«. Dies schmeichelt dem Nationalismus und läßt imperialistische Begehrlichkeiten entstehen.
Modernität: Zum Jahreswechsel 1886/87 publizierte eine Gruppe junger Berliner Autoren, zu der auch Gerhart Hauptmann zählte, zehn Thesen zur Bedeutung und Zukunft einer gegenwärtigen, wirklichkeitsorientierten und wissenschaftlich grundierten Literatur. Die fünfte dieser Thesen lautet: »Unser höchstes Kunstideal ist nicht mehr die Antike, sondern die Moderne.« Damit wurde nicht nur eine kulturell wichtige Bewegung proklamiert: die Abwendung von ästhetischen Normen, die sich aus der Antike herleiteten, und die Hinwendung zu gegenwärtigen Vorstellungen und Werten; es wurde auch ein neues Wort in Umlauf gebracht: das Substantiv »die Moderne«, das es bis dahin nicht gegeben hatte. 1894 wird dieses Wort in den Großen Brockhaus aufgenommen, 1896 in Meyer’s Konversationslexikon, und als Bezeichnung für die zeitgenössische soziale und kulturelle Konfiguration indiziert oder, anders gesagt, als Bezeichnung für die gegenwärtige, als durchaus neuartig empfundene Epoche.
Und in der Tat, Deutschland ist sichtbar in die Moderne eingetreten, gewinnt zügig jene Modernität, die bis heute unsere Vorstellung von »Moderne« primär bestimmt: Die Industrialisierung greift mit neuer Dynamik um sich und prägt mit ihren Fabrikanlagen und Arbeitersiedlungen zahlreiche Städte und ganze Regionen. Viele Städte wachsen zu veritablen Großstädten an. Der Eisenbahnverkehr wird ausgebaut und technisch optimiert: 1892 wird die preußische Schnellzuglokomotive eingeführt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreicht (1907: 154,5), während die Züge um 1875 kaum halb so schnell waren. 1895 gibt es die ersten Autos mit luftgefüllten Gummireifen, beginnt die Serienproduktion von Motorrädern, erhalten die elektrischen Straßenbahnen die bis heute gebräuchlichen Bügelstromabnehmer, bekommt Graf Zeppelin das Patent auf sein Luftschiff, wird (in Frankreich) der Cinematograph entwickelt und damit das Kino auf den Weg gebracht, entdeckt Wilhelm Röntgen die nach ihm benannten elektromagnetischen Strahlen. Die naturwissenschaftliche Erkundung und Erklärung der Welt ist so weit fortgeschritten, daß der Zoologe und Popularphilosoph Ernst Haeckel 1899 glaubt behaupten zu können, die sogenannten »Welträtsel«, also die Fragen nach den letzten Gründen und Bedingungen der Welt und des Lebens, seien gelöst. Kurzum: Die Technik gibt der Welt und dem Leben jenes Aussehen, das bis heute als »modern« gilt; die Wissenschaft vermittelt den Zeitgenossen das Bewußtsein oder Gefühl, in einer weitestgehend erforschten und wissenschaftlich-technisch beherrschbaren Welt zu leben; die Künste reflektieren diese Entwicklung und nehmen darüber ein Aussehen an, das sie ebenfalls als dezidiert »modern« erscheinen läßt, auch dann, wenn sie, wie dies häufig der Fall ist, die forcierte technische und soziale Modernisierung kritisieren und beklagen.
Neurasthenie: Die Moderne bringt ihre eigene Krankheit hervor: die Neurasthenie oder reizbare Nervenschwäche, von der sich viele Zeitgenossen, Männer wie Frauen, plötzlich befallen fühlen. Man weiß nicht so recht, woher die Neurasthenie rührt und was es mit ihr auf sich hat. Einige medizinische Experten führen sie auf die natürliche Dekadenz zurück; die meisten Beobachter aber verweisen auf die notorisch gewordene Überforderung der Menschen durch die Moderne: durch das wirbelnde Leben in den Großstädten; durch die Reizungen des Konsums in einer Welt der beginnenden Massenproduktion und der Verfügbarkeit exotischer Waren; durch das entfaltete kapitalistische Wirtschaftssystem mit seinem Konkurrenzprinzip, mit seiner Verbindung von Chance und Risiko, mit seinem undurchschaubaren Auf und Ab der Konjunktur; durch den daraus sich ergebenden Leistungsdruck im persönlichen Leben, in dem die Arbeit ein immer größeres Gewicht bekommt und zugleich das Gefühl entsteht, daß es kein Fertigwerden gebe und daß man stets in der Gefahr schwebe, im Lebenskampf gegen die harte Konkurrenz zu unterliegen. In einem Kommersbuch aus Jüngers Geburtsjahr 1895 findet sich ein Lied mit dem Titel Nervöses Zeitalter, in dem es heißt:
Überall ein Rennen, Jagen nur nach Mammon, schnödem Geld; jeder möcht die erste Geige gerne spielen in der Welt. Hastges Treiben, hastge Miene, wildes Wogen und Getös! Und der Mensch wird zur Maschine, und der zweite wird nervös.
Joachim Radkau, der dieses Syndrom in einer aufschlußreichen Studie dokumentiert und analysiert hat, schreibt der Nervosität jener Zeit zu Recht einen doppelten Charakter zu: Sie war »echte Leidenserfahrung« und »kulturelles Konstrukt«, also Bewußtmachung und Profilierung dieser Leidenserfahrung, zum Teil aber auch Induzierung und Stimulus. Und Radkau macht weiterhin deutlich, daß diese moderne Nervosität zu einer Art von Zeitstil wurde, den Habitus der wilhelminischen Gesellschaft prägte und sich nicht nur im privaten und beruflichen Leben zeigte, sondern auch in der Sphäre der Politik, die ja nach dem Amtsantritt Wilhelms II. in der Tat »nervös« wurde: gereizt, lamentierend, unzufrieden, ungeduldig, sprunghaft, aggressiv.
Eng verwandt mit der Vorstellung der Neurasthenie ist die der modernen Degeneration, die 1892/93 von dem jüdischen Arzt und Schriftsteller Max Nordau in einem zweibändigen Werk unter dem Titel Entartung als epochales Phänomen profiliert und attackiert wurde. Unter »Entartung« verstand Nordau - im Anschluß an medizinische Schriften - eine »krankhafte« und erbliche »Abweichung« von einem »ursprünglichen« und gesunden Typus; sie mindere - so Nordau - die physische wie die psychische Integrität der Betroffenen, mache sie für sittliche Perversionen aller Art anfällig und verhindere, daß sie ihre »Aufgabe in der Menschheit« erfüllen (I, 27). Den Grund für diese um sich greifende »Degeneration« oder »Entartung« sah Nordau in der Überforderung der Zeitgenossen durch die Moderne: »Gleichsam von einem Tag auf den andern, ohne Vorbereitung, mit mörderischer Plötzlichkeit mußten sie den behaglichen Schleichschritt des frühern Daseins mit dem Sturmlauf des modernen Lebens vertauschen und das hielten ihr Herz und ihre Lunge nicht aus« (I, 64). Die Folgen dieser überfordernden Modernisierung sah Nordau in der modernen Kunst und Literatur: im Ästhetizismus eines Baudelaire wie im Naturalismus eines Zola, in Wagners Musik wie in Nietzsches Philosophie. Nordau war sowohl ein gründlicher Kenner der modernen Kunst als auch ein entschiedener Vertreter der rationalistischen Moderne, und als solcher mißverstand er die transrationale moderne Kunst in einem fatalen Kurzschlußverfahren als Symptom für »Degeneration« und denunzierte sie als »Entartung«. In Nordaus Buch betrachtet die Moderne sozusagen ihr künstlerisches und philosophisches Selbstporträt - und erschrickt so sehr darüber, daß sie es verwerfen muß. Das Erschrecken der Moderne über sich selbst gehört zur Moderne und wird zu reaktionären Rebellionen gegen die Moderne und zu Vernichtungsaktionen gegen ihre avantgardistischen Vertreter und Werke führen.
Vitalität: Neurasthenie erscheint nicht nur als Schwäche, die sich den Herausforderungen und Zumutungen des Lebens nicht gewachsen fühlt. Sie zeigt sich auch - wie bei Wilhelm II. - als Agilität und »kinetische Energie« (Radkau), die alle Schwächegefühle verdrängt und voller Ungeduld auf Möglichkeiten zur erfolgreichen Betätigung wartet. Schwächegefühl und Kraftmeierei, Lebensangst und Lebensgier gehören eng zusammen. Gleichzeitig mit der Mode der Neurasthenie greift der Vitalismus um sich: der Kult des »gesunden«, kräftigen und schwungvollen Lebens, das Dekadenz und Schwächezustände nur als Übergangserscheinungen kennt und sich im übrigen rational weder erklären noch bändigen läßt; das Leben gilt als etwas zutiefst Irrationales, das nur intuitiv zu erfassen ist. Die ersten Ansätze dieser Philosophie oder Ideologie des »Lebens«, von dem man nun mit geradezu religiöser Emphase spricht, finden sich in der Zeit des Sturm und Drang; der große Anreger und wichtigste Exponent aber ist Friedrich Nietzsche. Für ihn bedeutet Leben ständiges Werden, ständiges Wachstum, ständige Steigerung, was allerdings auch von Destruktionen begleitet ist: »Zeugen, Leben und Morden ist eins«, heißt es in der dritten von Nietzsches Fünf Vorreden. Die Verherrlichung des Lebens verbindet sich mit dem Bekenntnis zur Tat, zur Aggressivität, zum Kampf, zum Krieg, auch zu einer »neuen Barbarei« als Übergang zu einem »neuen Menschen«. Von den 1880er bis in die 1920er Jahre spielt dieser Vitalismus eine große Rolle.
Nationalismus: Nationalismus ist um 1895 weder etwas Neues noch etwas spezifisch Deutsches. Er entstand aus den politischen Revolutionen der Neuzeit, angefangen vom niederländischen Unabhängigkeitskampf gegen Spanien bis zur Französischen Revolution und zu den anschließenden deutschen Freiheitskriegen. In dieser Phase war der Nationalismus im wesentlichen eine Form der politischen Selbstverständigung und Selbstbestimmung, der inneren und äußeren Nationsbildung; er wirkte integrierend und mobilisierend - und zeigte allerdings gleich auch die Fratze der nationalen Überheblichkeit, des Hasses auf andere Nationen und der tendenziell totalitären Feindseligkeit gegenüber »unangepaßten« Gruppen im Inneren. Im 19. Jahrhundert wuchsen dem Nationalismus neue, nämlich wirtschaftliche und soziale Funktionen zu: Er lieferte die Begleitmusik für den großen Prozeß der Modernisierung, spornte zu den Leistungen der Industrialisierung wie der Handelsexpansion an - und ließ darüber hinwegsehen, mit welchen Zumutungen an Mobilisierung und Disziplinierung, Ausbeutung und Entfremdung dies für die Menschen verbunden war.
Das zersplitterte Deutschland gehörte in politischer wie ökonomischer Hinsicht nicht zu den »Pionierländern« und Gewinnern dieses Prozesses, sondern zu den »Nachzüglern« und Verlierern - bis sich mit der Reichsgründung von 1871 eine Wende abzeichnete. Diesen Umständen verdankt der Nationalismus die außerordentliche Wirkungskraft, die er in Deutschland im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erreicht: Er wird zum ideologischen Rüstzeug für den Aufstieg zur politischen und ökonomischen Großmacht. Er artikuliert und nährt als »Reichsnationalismus« das Bewußtsein, ebenfalls einer großen Nation anzugehören, die aufgrund ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen Anspruch auf eine Führungsposition in der Welt hat. Er greift von der hauptsächlich bürgerlichen und protestantischen Trägerschicht der früheren Jahrzehnte auf fast alle sozialen Gruppen über und erfaßt nach dem »Kulturkampf« die zunächst ausgegrenzten Katholiken ebenso wie nach dem Ende der »Sozialistenverfolgung« die sozialdemokratische Arbeiterschaft, desgleichen die Juden (»deutsche Staatsbürger mosaischen Glaubens«), auch wenn der Antisemitismus, der in eben diesen Jahren eine biologistisch-nationalistische Radikalisierung erfährt, ihnen permanent vorhält, daß sie als Angehörige einer fremden »Rasse« zu vollgültigen und willkommenen Mitgliedern der deutschen Nation nicht werden könnten. Nationalismus gewinnt den Charakter einer »politischen Religion« und wird in dieser Form für viele Menschen zum existentiellen Sinnhorizont und globalen Heilsversprechen: »Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!«
Imperialismus: Imperialismus ist die Fortsetzung des Nationalismus in internationalem und tendenziell globalem Rahmen: Die nationalen Interessen und Ansprüche sollen durch eine Schaffung von Einflußsphären oder eine Eroberung von Kolonien befriedigt und gesichert werden. So wenig wie der Nationalismus ist der Imperialismus ein spezifisch deutsches Phänomen; vielmehr ist das deutsche Expansionsstreben der Wilhelminischen Ära integraler Bestandteil des westeuropäischen Imperialismus. Dieser hat mehrere Motive: die Dynamik des Industriekapitalismus, die ständig neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte verlangt; die sozialdarwinistische Vorstellung, daß auch die Nationen einem natürlichen Kampf ums Überleben unterworfen und deswegen gezwungen seien, ihre nationalen Interessen gegenüber anderen Nationen kämpferisch und expansiv durchzusetzen; die durch den Nationalismus genährte Vorstellung, daß die je eigene Nation dazu berufen sei, die Welt zu ordnen und ihr die eigentliche »Zivilisation« oder »Kultur« zu bringen. Und er erscheint den Zeitgenossen als unentrinnbare Notwendigkeit: Wer die Schaffung eines Imperiums oder wenigstens von großen merkantilen und politischen Einflußsphären versäumte, war nach Meinung der Zeitgenossen dazu verurteilt, ökonomisch zurückzufallen und politisch ausgeschaltet zu werden - zum Nachteil aller Angehörigen einer Nation, die dann in der Heimat von der Verarmung bedroht waren und in der Fremde als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Das doppelte Elend von Emigranten, die Not in der Heimat und die Deklassierung in der Fremde, ist eine von zahllosen Deutschen erlittene Erfahrung und wird in der Literatur jener Zeit vielfach reproduziert - bis hin zu Hans Grimms voluminösem Roman Volk ohne Raum (1926), der zum Bestseller nur werden konnte, weil er auf diesen Erfahrungen aufbaute und die Ängste, die damit verbunden waren, aufrief. Um 1895 steht für die meisten Deutschen fest: Deutschland muß, wenn es einen »Platz an der Sonne« erringen und behalten will, »Welt(macht)politik« treiben, und es braucht dafür ein starkes Heer und eine starke Flotte. Der Imperialismus fordert und fördert den Militarismus.
Fortschrittsdenken: »Evolution« und »Entwicklung« sind Zentralbegriffe des Weltverständnisses im ausgehenden 19. Jahrhundert. Selbstverständlich denkt man sie sich als Fortschritt zu immer höheren Organisationsformen und immer besseren Zuständen des Lebens. Die Aufklärung und der Idealismus hatten die Idee der »Perfektibilität« oder Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen und der menschlichen Gesellschaft in die Welt gebracht. Im 19. Jahrhundert warteten wirkungsreiche Philosophen - Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer - mit Theorien auf, welche die Geschichte als gesetzmäßige und stufenweise Aufwärtsentwicklung erscheinen ließen. Darwins biologische Abstammungs- und Entwicklungslehre wirkte beglaubigend und inspirierend; sie gab dem Fortschrittsglauben naturwissenschaftliche Evidenz und ließ im sogenannten Sozialdarwinismus gleichsam ein Fortschrittssicherungsprogramm für menschliche Gesellschaften entstehen. Die Errungenschaften von Wissenschaften und Technik taten ein übriges, um den Glauben an den Fortschritt unabweisbar und allgemein zu machen. Um 1895 sind vor allem die Gebildeten davon überzeugt, daß die Wissenschaft die Welt in Bälde vollständig erklärt haben wird und daß sie im Verein mit der Technik das menschliche Leben in allen Bereichen erleichtern und sichern wird.
Sekurität: Das Jahr 1895 bezeichnet ungefähr die Mitte jener Zeit, die der österreichisch-jüdische Romancier und Essayist Stefan Zweig in seiner aufschlußreichen Autobiographie Die Welt von gestern (postum 1943/44) als »das goldene Zeitalter der Sicherheit« oder, wie man damals auch gerne sagte, der »Sekurität« beschrieben hat. Der letzte Krieg liegt über zwanzig Jahre zurück, und ein neuer ist nicht abzusehen, obwohl ihn einige Politiker und Zeitanalytiker vorhersagen und zum Teil auch herbeiwünschen. Aber das europäische Staatensystem wirkt stabil, und es wird ja noch zwanzig Jahre dauern, bis es mutwillig zur Disposition gestellt wird. Die Wirtschaft floriert, der Wohlstand der bürgerlichen Schichten nimmt beträchtlich zu, und die Lage der deutschen Arbeiterschaft hat sich durch steigende Reallöhne und die weltweit als vorbildlich betrachtete Sozialgesetzgebung verbessert (1878: Arbeiter-, Jugend- und Mütterschutz; 1883: Krankenversicherung; 1884: Unfallversicherung; 1889: Invaliditäts- und Altersversicherung).
Gewiß ist das Leben nicht frei von Spannungen und Niederlagen. Es gibt soziale Konflikte und Zusammenbrüche von Firmen, die das Sekuritätsgefühl unterminieren und Niedergangsängste aufkommen lassen. Nicht grundlos schreibt der Lübecker Patriziersproß Thomas Mann von 1897 bis 1900 mit der kleinen Rente, die er nach der Liquidation der väterlichen Getreidefirma erhält, die Geschichte des »Verfalls einer Familie« (so der Untertitel der 1901 erschienenen Buddenbrooks); und nicht von ungefähr entstehen um 1910 Gedichte wie Georg Heyms Umbra vitae und Der Krieg, die von der Erwartung einer baldigen Katastrophe diktiert sind. Aber das Beispiel von Jüngers Vater, der 1913 im Alter von 45 Jahren glaubt, für den Rest seines Lebens vorgesorgt zu haben, zeigt, daß man sich von derartigen Prognosen nicht allzusehr beeindrucken läßt. Man lebt, um noch einmal mit Stefan Zweig zu reden, in dieser »Welt der Sicherheit wie in einem steinernen Haus« - und ahnt nicht, daß die nächsten drei Jahrzehnte mit geschichtlichen Stößen aufwarten werden, die auch das Haus der Sekurität gründlich erschüttern und den Bewohnern die Sicherheit des Auskommens und des bloßen Überlebens weitgehend entziehen. Ein halbes Jahrhundert später, 1958, wird Bundeskanzler Konrad Adenauer in seiner Weihnachtsansprache sagen: »Ist es nicht traurig, daß die Mehrzahl der jetzt Lebenden Ruhe, Frieden und Sicherheit, ein Leben frei von Angst, niemals gekannt hat?«
Familienchronik
Heidelberger Geburtsgeheimnisse
29. März 1895: Ernst Jünger wird als das erste Kind von Ernst Georg Jünger und Karoline Lampl in Heidelberg geboren. Die Nativität, also die Konstellation der Gestirne im Zeichen des Widder, wird von Astrologen als günstig beurteilt, und Jünger bezieht daraus zeitlebens eine gewisse Zuversicht. Ansonsten gibt es, was die Umstände der Geburt angeht, einige Unklarheiten. Die Eltern sind, wie die Eintragungen im Standesamt Heidelberg anzeigen, noch nicht verheiratet, und doch wird das Kind nicht, wie damals üblich, unter dem Namen der Mutter, also Lampl, sondern unter dem Namen Jünger registriert. Als Geburtshaus wird »Ziegelgasse 3« genannt, doch beruht dies, wie der Heidelberger Stadthistoriker Michael Buselmeier vermutet, auf einer Verwechslung: »Ziegelgasse 3« ist ein »Arme-Leute-Haus«, in dem die Hebamme wohnt, die dem Kind ans Licht der Welt verhilft. Der Vater hat sich im ersten Stockwerk des viel vornehmeren Hauses »Sophienstraße 15« eingemietet, doch ist nicht dokumentiert, ob die Mutter bei ihm oder im Haus »Ziegelgasse 3« wohnt. Beide sind sie jedenfalls kurz zuvor von München, wo sie sich kennengelernt haben, nach Heidelberg übergesiedelt, wo Ernst Georg Jünger als Assistent des Chemikers Victor Meyer arbeitet. Daß die Lebens- und Familienverhältnisse etwas irregulär sind, scheint im akademischen Milieu, zumindest im naturwissenschaftlichen Sektor, belanglos zu sein. Die Ehe zwischen Ernst Georg Jünger und Karoline Lampl wird - laut einer Randbemerkung auf Ernst Jüngers Geburtsurkunde - erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1897 auf Helgoland geschlossen.
Woher stammen Ernst Georg Jünger und Karoline Lampl? Und was bringen sie an möglicherweise prägenden Anlagen mit? Einiges hat ihr Sohn in einer 1914 verfaßten Familienchronik festgehalten und später an verschiedenen Stellen seines Werks mitgeteilt. Süddeutsches und Norddeutsches flossen zusammen, naturwissenschaftliche Orientierung und künstlerische Neigungen verbanden sich.
Vorfahren
Jüngers Urgroßvater Georg Christian Jünger wurde 1810 im württembergischen Neckargartach geboren, einem damals selbständigen Dorf, das nur durch den Neckar von Heilbronn getrennt war. Georg Christian Jünger wurde Schuster und lebte später als Schuhmachermeister in Osnabrück. Seine Frau Gertrud Wilhelmine geb. Niemann entstammte einer bäuerlichen Familie, die in Ösede bei Osnabrück einen Hof besaß. Fleiß, Akkuratheit und Bescheidenheit wurden geschätzt, aber doch ging des Urgroßvaters Leben nicht im Beruf allein auf. Er liebte es, mit seinem Sohn zusammen »einen starken Kaffee zu brauen, die lange Pfeife zu rauchen und die Gartenlaube zu lesen« (so die Familienchronik). Die Gartenlaube war eine Vorläuferin der modernen Illustrierten und das erste große deutsche Massenblatt. 1852/53 von einem liberal und progressiv denkenden Verleger gegründet, war sie ein wichtiges bürgerliches Aufklärungsblatt, »die eigentliche Trägerin des demokratischen Gedankens« und »das freiheitliche Gewissen Deutschlands«, wie der naturalistische Dramatiker Hermann Sudermann in seiner Autobiographie bemerkt. Zudem war sie ein Blatt, das mit einem breiten Spektrum von Artikeln über Kunst wie über soziale Probleme, über technische Errungenschaften wie medizinische Themen informierte und durchaus auch respektable Literatur druckte. Diese Gartenlaube, nicht das harmlose Familienblatt, zu dem sie nach der Reichsgründung allmählich wurde, hat der auf der überlieferten Porträtaufnahme nachdenklich aussehende Mann um 1860 mit seinem Sohn gelesen: ein Medium der bürgerlichen Aufklärung und der kulturellen Modernisierung.
Der Sohn, Ernst Jüngers Großvater, wurde 1840 in Osnabrück geboren und auf den Namen Christian Jakob Friedrich Clamor Jünger getauft, bald aber nur »Fritz« gerufen. Er besuchte das Lehrerseminar in Osnabrück und unterrichtete anschließend im benachbarten Bramsche, wo er seine spätere Frau kennenlernte, die 1839 geborene Wirtstochter Hermine Wolters. In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wechselte er an eine private Mädchenschule in Vegesack, dann an das neugegründete Lyzeum II (später Goethe-Gymnasium) in Hannover, wo er in den Vorklassen Mathematik und Biologie unterrichtete. Von 1872 bis 1896 bewohnte er mit seiner Familie ein großes Haus in der Weinstraße (16a), das zugleich als Pensionat für eine kleine Zahl von Schülern aus der Umgebung, aber auch aus England und Spanien diente. Die überlieferten Photos zeigen wohlhabende und selbstbewußte Bürgerlichkeit, die auch Ernst Jünger noch kennenlernte, als er 1903 bei den Großeltern einzog, um das Gymnasium besuchen zu können (die Eltern waren inzwischen nach Schwarzenberg im Erzgebirge gezogen). Einiges von der Atmosphäre und dem Ethos dieses bürgerlichen Haushalts hat er später in der Schülergeschichte Die Zwille (1973) festgehalten. Besonders bemerkenswert ist, was dort in dem Kapitel »Die Einrichtung« über die Haltung des Pensionsleiters gegenüber dem zivilisatorischen Fortschritt gesagt wird: Er hält in vielen »Modernisierungsgesprächen« (18, 95) an allem fest, was die Autonomie und Autarkie seines Hauses bewahren hilft, am Handpumpenbrunnen auf dem eigenen Grundstück wie an Öllampen, weil in beiden Fällen keine Leitungen nach außen nötig sind, das Haus nicht »angezapft« wird und keine »Abhängigkeit von anonymen Maschinisten« entsteht (94). Möglicherweise ist hinter dem Pensionsleiter der Zwille der Großvater zu sehen, und jedenfalls verweist diese Figur auf eine Bürgerlichkeit, die auf ein auskömmliches und möglichst autonomes Leben Wert legte und den Modernisierungsimperativen der Zeit, die diese Selbständigkeit und Selbstgenügsamkeit gefährdeten, mit Mißtrauen begegnete. Auch dieses Bürgertum gehört zu Jüngers Erfahrungshorizont und ist vielleicht mit ursächlich für seine später deutlich werdende Neigung zu einem möglichst unabhängigen Leben eher am Rand der urbanen Moderne. Im übrigen bekam Jünger von diesem Großvater 1905 ein für ihn bedeutungsvolles Buch geschenkt: Alexander von Humboldts Reisen in die Aequinoctialgegenden, und zeit seines Lebens blieb er von dem Mut dieses Reisenden und von seiner präzisen Beobachtung fasziniert (vgl. 20, 57 und 60).
Der Vater
Der Ehe von Fritz und Hermine Jünger entsproß 1868 als erster Sohn Ernst Georg Jünger, der Vater Ernst Jüngers. Er begeisterte sich früh für die Naturwissenschaften, speziell für die Chemie, und richtete sich bereits als Schüler unter dem Dach des elterlichen Hauses ein Laboratorium ein. So verwundert es nicht, daß er Chemie studierte, auf Geheiß des Vaters, der die Chemie als brotlose Kunst betrachtete, allerdings auch soviel Pharmazie, daß er sich später als selbständiger Apotheker niederlassen konnte; seine pharmazeutischen Famulaturen führten ihn 1888 für ein Jahr nach Berlin, danach für ein Jahr nach London. Mit dem Chemiestudium begann Ernst Georg Jünger in Marburg, wechselte dann aber nach München und schließlich nach Heidelberg, wo er 1895 von dem renommierten Chemiker Victor Meyer aufgrund einer Arbeit über »Synthesen in der m-Terpenreihe« zum »Dr. phil.« promoviert wurde. Meyers jüngste Tochter hat ihn später als einen »charmanten Gesellschafter« beschrieben (14, 65). Bis zum Jahresende 1896, möglicherweise bis zum Sommer 1897, arbeitete Ernst Georg Jünger als Assistent von Meyer. Wie Ernst Jünger in den Subtilen Jagden mitteilt, gelang es seinem Vater, aus dem Waldmeister das Cumarin zu isolieren, das in der Parfümerie zur Erzeugung von Heu- und Lavendeldüften gebraucht wird (10, 11). Ob eine akademische Laufbahn nicht geplant war oder daran scheiterte, daß sein Lehrer Meyer Anfang August 1897 Selbstmord beging, ist nicht mehr auszumachen; Friedrich Georg Jünger bemerkt in seinem Erinnerungsbuch Grüne Zweige, dem Vater sei der Gedanke, daß er als Privatdozent Jahre hindurch in einer abhängigen Stellung hätte leben müssen, so zuwider gewesen, daß er sich entschloß, der Universität den Rücken zu kehren. Jedenfalls zog die junge Familie - die Eltern waren jetzt wohl auch getraut - im Sommer 1897 nach Hannover, wo Ernst Georg Jünger ein Laboratorium einrichtete, um als Gerichts- und Handelschemiker tätig werden zu können. Offensichtlich war damit aber nicht ausreichend Geld zu verdienen, denn 1901 übersiedelte die Familie nach Schwarzenberg im Erzgebirge, wo der Vater die Adlerapotheke erworben hatte. Ganz zufrieden scheint er dort nicht gewesen zu sein, denn bereits vier Jahre später, 1905, wurde die Apotheke wieder verkauft. Es ging zurück nach Hannover, und Ernst Georg Jünger beteiligte sich nun - erfolgreich - am Kalibergbau.
Der Vater Ernst Georg (1868 - 1943)
1907 übersiedelte die Familie nach Rehburg am Steinhuder Meer und bezog eine geräumige Villa, die von Parkbäumen umgeben war und im weitläufigen Garten ein zweistöckiges Wirtschaftsgebäude hatte. Ebenfalls in den Subtilen Jagden teilt Jünger mit, daß sich sein Vater »schon vor dem fünfundvierzigsten Jahr [also vor 1913] zur Ruhe« setzte, weil er glaubte, für den Rest seines Lebens mit dem bis dahin erworbenen Vermögen gut auskommen zu können, und weil er der Meinung war, daß nach dem Fünfundvierzigsten »eigentlich niemand mehr arbeiten und jeder sich seinen Neigungen widmen« solle (10, 12). - Nach dem Krieg sah Ernst Georg Jünger sich freilich gezwungen, mit dem Rest seines durch die Inflation dezimierten Kapitals die Löwenapotheke im sächsischen Leisnig zu kaufen und wieder zu arbeiten. Zeitlebens aber frönte er seinen Liebhabereien: dem Klavierspiel, dem Schachspiel, dem Studium historischer und juristischer Literatur, der Astronomie usw. Seine Bibliothek war überaus reichhaltig; seine astronomischen Instrumente waren exquisit und hätten einer kleinen Sternwarte Ehre gemacht.
In den »Rehburger Reminiszenzen« der Subtilen Jagden (1967) erscheint Ernst Georg Jünger als ein etwas exzentrischer Mann, der sich mit Leidenschaft seinen Neigungen hingab, seien es geschichtlichen Studien oder Schachspiel, und sein Haus für die meist nicht weniger exzentrischen Koryphäen der gerade gepflegten Gebiete offenhielt. An Vorbildern für ein außergewöhnliches und gewagtes Leben im wissenschaftlich-künstlerischen Bereich hat es dem jungen Ernst Jünger also nicht gefehlt, und der Devise seines Vaters, daß man nach dem Fünfundvierzigsten nicht mehr arbeiten solle, stimmte er »von Herzen« zu und »übertrumpfte« sie noch, indem er sich sagte, »besser finge man mit dem Arbeiten gar nicht erst an« (10, 12).
In den eingangs zitierten Notaten aus Zwei Mal Halley (1987) oder Siebzig verweht IV (1995) bekommt das Bild des Vaters aber noch einen deutlich anderen Valeur. Da wird er zum »pater familias« in einem archaischen und zugleich epochentypischen Sinn (21, 42ff.): Archaisch, daß er mit den Seinen den Sternenhimmel betrachtet und in »schwierigen Situationen« die Führung übernimmt. Typisch, daß er sie zum Porträtphotographen und in die Oper führt. Typisch auch seine rationalistische und positivistische Grundeinstellung, die sich während der Heidelberger Studienzeit herausgebildet hatte und ihn beispielsweise bemerken ließ: »Gedanken werden durch Kombination und Zerfall von Eiweißmolekülen produziert.« Typisch ferner das Interesse an der Geschichte, einer Leitwissenschaft des 19. Jahrhunderts, und zwar in jener Spielart, die vor allem die »großen Einzelnen« exponierte; selten, so erinnert sich Jünger 1966, »verging bei uns ein Tischgespräch, bei dem nicht von Napoleon und Alexander die Rede war« (4, 271). Typisch schließlich auch die Vorliebe für ein diszipliniertes Leben ohne Exzesse und Berauschungen. Die Porträtaufnahmen zeigen einen schlanken Mann mit einem ebenmäßig geformten, klar und modern wirkenden Antlitz, fern allem Wilhelminisch-Teutonischen, das in den männlichen Gesichtern jener Zeit so häufig anzutreffen war. Im übrigen scheint er ein von Natur aus heiterer und agiler Mann gewesen zu sein. In den Annäherungen hielt Jünger fest: »Früh hörte man ihn auf der Treppe, nicht als Sarastro, sondern als Papageno, wie es seiner Stimme und Stimmung entsprach. Er sang oder pfiff, wenn er herunterkam; aufwärts nahm er die Stufen im Sprung« (11, 251).
Diesem vielseitig tätigen und zugleich disziplinierten, zielstrebigen und erfolgreichen Mann konnte es nicht gefallen, daß sein ältester Sohn ein miserabler Schüler war und nach dem Kriegseinsatz Gefahr lief, wahlweise ein kümmerlich lebender Garnisonsoffizier oder ein »verbummelter« Student zu werden. Es scheint zu Spannungen gekommen zu sein, die zeitweilig zu einer sehr negativen wechselseitigen Wahrnehmung führten. Aber mehr und mehr stellte sich bei Ernst Jünger das Bewußtsein ein, daß er seinem Vater viel verdankte. Und in der Tat: Ernst Georg Jünger hat seinem Sohn die Welt auf nachhaltige Weise erschlossen. Er hat ihn, indem er ihm zu Weihnachten 1908 einen Käferkasten samt Fangausrüstung und Bestimmungsbuch schenkte, nicht nur zum Entomologen werden lassen, sondern auch zum genauen Beobachter mit einem Blick für das Detail wie für die systematischen Zusammenhänge. Er hat ihm neben dem Interesse an der Natur und am Kosmos auch das Interesse an der Geschichte und an der Literatur vermittelt. Und er hat ihn, wie Jünger am 8. April 1969, am hundertsten Geburtstag des Vaters notierte, »herausgerissen«, »wo immer die Dinge schwierig« oder gar »katastrophal« wurden (4, 565): 1913 zum Beispiel, als er den Achtzehnjährigen aus dem leichtfertigen Gang in die Fremdenlegion zurückholte, und 1919, als er dem perspektivlosen Kriegsheimkehrer riet, seine Notizen aus dem Krieg in eine breitere Darstellung zu überführen.
Daß sich in Jünger das lebenslang anhaltende Gefühl einstellte, »geleitet zu sein« (4, 487 und 576f.), dürfte nicht zuletzt auf die Fürsorge zurückzuführen sein, die ihm der Vater fortwährend, insbesondere aber in prekären Situationen, angedeihen ließ. Dem entspricht, daß der Vater für Jünger bis zu seinem Tod im Januar 1943 eine Person von großer Autorität war. Und dies galt nicht nur für lebenspraktische Entscheidungen, bei denen sein Rat beachtet sein wollte; es galt auch für die Reflexion der politischen Entwicklung, bei der Jünger immer wieder auch auf die Ansichten des Vaters zurückkam.
Möglicherweise hatte der Vater auch prägenden Einfluß auf Jüngers Stil. Kurz nach Ernst Georg Jüngers Tod charakterisierte ihn sein Sohn Friedrich Georg in seinen Erinnerungen an die Eltern folgendermaßen:
Sein Drang nach Unabhängigkeit machte sich heftig, schroff, auch verletzend geltend, wo immer die Vermutung einer Gefährdung auftauchte. Er war dann kalt und zugleich wach. Welche Kälte in der Ironie steckt, habe ich durch ihn begriffen. Doch war er nicht eigentlich ironisch, sondern sarkastisch und beißend. Seine Repliken waren so kurz wie entwaffnend; sie verschlugen dem Betroffenen den Atem. [...] Seine Sätze waren so kurz und genau, wie ein scharfer Wille, gepaart mit einem geübten wissenschaftlichen Denken, sie hervorzubringen vermag. Seine Kürze hatte etwas Willensmäßiges; in ihr steckte ein Befehlston. Dieser hatte nichts Militärisches, sondern war reine, schneidende Verständigkeit. Auch schätzte er das Ungemütliche und war der Ansicht, daß ein einziger ungemütlicher Mensch mehr in Bewegung bringe als ein Dutzend gemütliche. […] Als Kind und auch später noch verletzte er mich manchmal mit der Kälte seiner Urteile, die wie auf Eis gebettet waren.
Willensmäßigkeit, Kürze, Sarkasmus, Befehlston, schneidende Verständigkeit, Kälte -: Das sind Vokabeln, die schon oft auf Jüngers Stil angewandt wurden, ohne daß ein Bezug zum Vater hergestellt worden wäre. Friedrich Georg Jüngers Ausführungen legen es aber nahe, anzunehmen, daß der apodiktische Gestus, der Jüngers Schreiben von Anfang an bestimmt, auf das Vorbild des Vaters zurückgeht (und durch das Studium Nietzsches und anderer Meister der Entschiedenheit nur ausgebaut und verfeinert wurde). Zugleich ist festzustellen, daß sich in diesem Gestus mehr als ein nur individueller Zug manifestiert; vielmehr zeigen sich in der scharf profilierten Ausdrucksweise von Jüngers Vater auch das Selbstbewußtsein des Besitz- und Bildungsbürgertums auf dem Höhepunkt des bürgerlichen Zeitalters sowie der offensive Geist der Wilhelminischen Epoche. In mancher Hinsicht war Jünger deren Erbe, auch wenn er in den zwanziger und dreißiger Jahren die bürgerliche Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts wegen ihrer rationalistischen und utilitaristischen Ausrichtung als Quelle der modernen Verflachung des Lebens scharf kritisierte.
Von dieser Kritik wurde der Vater nicht ausgenommen. Zwar gibt es in Jüngers Werk keinen direkten Angriff auf den Vater, aber doch die eine oder andere Wendung, die sich auch auf ihn beziehen läßt. So etwa in der ersten Fassung des Abenteuerlichen Herzens (1929), wo Jünger - unter der Überschrift »Neapel« - nicht nur seiner zoologischen Studien im Aquarium von Neapel gedenkt, sondern auch an den unbekümmerten und schneidigen Rationalismus erinnert, dem die Generation des Vaters gehuldigt hatte. Diese alles durchdringen wollende Geisteshaltung wird nun als »Anarchie des Verstandes« bezeichnet und mit dafür verantwortlich gemacht, daß diese Generation jede »Bindung« abzustreifen suchte und folglich auch von der erzieherischen Vermittlung der tradierten humanistischen Werte abrückte (9, 105). Damit korrespondieren - neben einigen Passagen der Afrikanischen Spiele und einschlägigen Bemerkungen der Tagebücher - jene Ausführungen von Zwei Mal Halley oder Siebzig verweht IV, in denen die rationalistische Einstellung des Vaters durch einige seiner schroff positivistischen Aussprüche exemplifiziert und in die Nähe jenes arroganten Nihilismus gerückt wird, den Iwan Turgenjew in seinem Roman Väter und Söhne dargestellt hat (21, 43). Alles in allem ist das Bild des Vaters, das Jünger in seinen Schriften entwickelt, ambivalent: ein Dokument der Hochachtung, die vor allem dem archaisch wirkenden »pater familias« zukommt, aber auch der Kritik, die insbesondere dem Repräsentanten einer rein rationalistischen und tendenziell nihilistischen Geisteshaltung gilt. Auf seine heranwachsenden Söhne hat dieser Mann, wie aus den Aufzeichnungen Friedrich Georg Jüngers noch deutlicher als aus den Schriften Ernst Jüngers hervorgeht, faszinierend und abstoßend zugleich gewirkt. Liebe scheint er nicht viel ausgestrahlt zu haben; das blieb der Mutter überlassen.
Die Mutter
Jüngers Mutter Karoline, genannt Lily, wurde 1873 geboren. Ihr Vater stammte aus einer Familie, die in Dießen am Ammersee einen Bauernhof bewirtschaftete; gelegentlich verbrachte Karoline mit ihren kleinen Kindern dort einige Ferientage. Ihre Mutter kam aus Eichstätt. Zeitweilig lebten die Eltern von Jüngers Mutter in München, wo die Tochter von den Englischen Fräulein erzogen wurde. In München lernte sie auch den Chemiestudenten Ernst Georg Jünger kennen, dem sie - ohne Erlaubnis der Eltern - nach Heidelberg folgte. Die bayerischen Großeltern scheinen für Jünger keine größere Bedeutung gewonnen zu haben. Über den Großvater erfährt man nichts. Die »Münchner Großmutter« kam hin und wieder zu Besuch, vorzugsweise aus Anlaß der »Kindbetten«, und waltete dann, fast unablässig betend, im Haus. Dem über siebzigjährigen Verfasser der Annäherungen ist sie fast nur schemenhaft in Erinnerung: als »kleine Graue, die lautlos die Lippen bewegt« (11, 250f.); immerhin weiß er auch noch, daß die Imitatio Christi des Thomas a Kempis ihr »Brevier« war (21, 281). Daß ihre Tochter einen norddeutschen »Ketzer« genommen hatte, war für die Münchner Großmutter ein »Unglück«, entspricht aber dem emanzipatorischen Geist, der in Jüngers Mutter - wie auch immer - rege wurde und der ihr den Mut gab, aus ihrem Milieu hinauszutreten. In den Annäherungen berichtet Jünger über die Reisen, die er nach 1925 mit der Mutter machte, kommt auf einen Besuch in Santa Maria Maggiore in Rom zu sprechen und fügt dem eine aufschlußreiche Charakterisierung der Mutter an:
Die Mutter Lily (1873 - 1950)
Übrigens hörte ich die Mutter das Wort Maria nur einmal aussprechen, in einem mir fremden Gebet, als der kleine Bruder Felix gestorben war. Das mußte aus der frühen Kindheit kommen, denn schon als junges Mädchen hatte sie, wenn die Großeltern sonntags von Kirche zu Kirche zogen, dagegen revoltiert. Sie las damals Ibsen, hatte auch einmal mit dem Bruder zusammen den Dichter angesprochen, als er vor dem Café Luitpold in der Sonne saß. Revoltierende Frauen dieser Generation waren nach ihrem Herzen; gern las sie in späteren Jahren Lily Brauns »Memoiren einer Sozialistin« und die Tagebücher der Reventlow. Als sie hörte, daß eine der ersten Suffragetten, ich glaube, Lady Pankhurst, im Britischen Museum ein Meisterwerk demoliert hatte, war das eine frohe Botschaft für sie. Es gab ein Bild, auf dem diese Dame durch einen Polizisten abgeschleppt wurde; sie trug einen Rock, der bis über die Fußspitzen hing. (11, 250)
An anderen Stellen hat Jünger die Liste der Autoren, die von seiner Mutter in ihrer Jugend gelesen wurden, erweitert; sogar der Skandalautor der Jahrhundertwende, Wedekind, gehörte dazu. Auch in der Ehe blieb Lily Jünger - von der häuslichen Arbeit durch Dienstboten einigermaßen entlastet - eine passionierte Leserin, die in ihrer »Lesewut« (Friedrich Georg Jünger) große Bestände älterer wie zeitgenössischer Literatur rezipierte, speziell auch »Schriften gebildeter Ärzte«: Jung-Stilling, Carus, Hufeland, Schleich (4, 556). Literatur stand - neben der Sorge um das Wohlergehen ihrer Kinder - anscheinend im Zentrum ihres Lebens. Den Faust kannte sie auswendig, und ihre Reisen führten sie regelmäßig nach Weimar, wo sie dann Goethes Lieblingsplätze besuchte. In den Annäherungen erwähnt Jünger ausdrücklich auch ihre Freude an heiterer Geselligkeit, zumal beim Wein und im Süden; aber was er an ihr geradezu rühmt, ist, daß »Verlaß« (11, 249 und 263) auf sie war, wenn eines der Kinder in der Bredouille steckte. Es scheint, daß er diese nachsichtige Verläßlichkeit über die Schulzeit hinaus häufig nötig hatte. Freilich hatte ihr Verständnis auch Grenzen: Auf die »ersten erotischen Wallungen« des ältesten Sohnes reagierte sie mit Befremden, obwohl sie, wie Jünger eigens anmerkt, Rousseaus Emile gelesen hatte, »um nichts zu versäumen« (21, 60); und auch von seinem gelegentlichen Konsum von Rauschgiften durfte sie nichts erfahren (11, 254ff.). Bemerkenswert ist, wie Jünger in einem Brief, den er am 31. August 1927 an seinen Bruder Friedrich Georg schrieb, die Bedeutung des mütterlichen Naturells kennzeichnete: »Das mütterliche Erbteil verlieh uns eine wunderliche Mischung von starkem Leben und mimosenhafter Empfindlichkeit, auch Neigung zum Phlegma dazu. Es kommt nun immer darauf an, daß das erste dieser beiden ›Gene‹, wie der Zoologe sagen würde, die beiden anderen dominiert.«
Ernst Georg Jünger starb am 9. Januar 1943 in Leisnig. Seine Apotheke wurde nach dem Krieg in einen »volkseigenen Betrieb« überführt; das Haus aber diente Jüngers Mutter und ihrem dritten Sohn Hans Otto, der sie in ihren letzten Jahren pflegte, als Wohnung. Karoline Jünger starb am 20. Dezember 1950.
Bald nach dem Tod der Mutter hat Friedrich Georg sein Bild der Eltern schriftlich fixiert und es unter dem Titel Erinnerung an die Eltern zunächst der Festschrift zum sechzigsten Geburtstag Jüngers beigetragen, später ans Ende seines Spiegels der Jahre gestellt. Von Jünger gibt es kein vergleichbares Porträt. Die Erinnerung an die Eltern war für ihn wohl stärker belastet als für den Bruder. Was er über die Eltern schrieb, entstand in großer zeitlicher Distanz und blieb bruchstückhaft. Die meisten dieser Erinnerungssplitter, die sich in den Tagebüchern oder in autobiographischen Passagen anderer Schriften finden, gelten dem Vater, der in der damaligen Zeit selbstverständlich die dominierende Bezugsperson war; er bot offensichtlich vielerlei Anlaß für eine geistige Auseinandersetzung lange über seinen Tod hinaus. Aber auch die »gute Mutter« (21, 60) gewinnt in den entsprechenden Notizen Kontur und erscheint als eine den Charakter des Sohnes nachhaltig prägende Kraft. Die Erinnerung an den Vater war durch Respekt getragen, der in Verehrung überging, aber Kritik nicht ausschloß, die Erinnerung an die Mutter durch Liebe. Das Grab der Eltern konnte Jünger fast fünfzig Jahre lang nicht besuchen, da ihm die Einreise in die DDR verwehrt war. Erst nach dem Fall der Mauer wurde dies möglich, und im Mai 1992 unternahm er im Alter von siebenundneunzig Jahren die erste Reise ans Elterngrab (22, 75 - 77).
Die Geschwister
Nach dem erstgeborenen Ernst hatten Ernst Georg und Karoline Jünger noch sechs weitere Kinder: den zweiten Sohn Friedrich Georg (1898 - 1977); die einzige Tochter Johanna (Hanna) Hermine (1899 - 1984); die weiteren Söhne Hans Otto (1905 - 1976) und Wolfgang (1908 - 1975) sowie Hermann und Felix, die allerdings schon im frühen Kindesalter starben. Hanna heiratete in den zwanziger Jahren nach München. Friedrich Georg wurde im Ersten Weltkrieg schwer verwundet, studierte danach Jura und wurde Schriftsteller. Hans Otto war musikalisch sehr begabt und mathematisch geradezu ein Wunderkind; er wurde Physiker, berechnete im Zweiten Weltkrieg die Flugbahnen der für London bestimmten Raketen und machte als Primzahlenforscher auf sich aufmerksam. Wolfgang wurde Geograph und trat in den vierziger Jahren als Sachbuchautor hervor; bei Goldmann erschien von ihm 1940 Kampf um Kautschuk und erreichte bis 1942 vier Auflagen. Um 1930 lebten die vier Brüder vorübergehend allesamt in Berlin und trafen sich gelegentlich mit Bekannten zu abendlichen Gesprächen über Politik und Kultur. Dann führten die Lebenswege auseinander und wurden Kontakte selten. Nur mit Friedrich Georg blieb Ernst Jünger zeitlebens in enger Verbindung. Er korrespondierte durchgehend mit ihm, besuchte ihn häufig, unternahm Reisen mit ihm, erhielt wichtige Anregungen von ihm und erörterte mit ihm häufig Probleme, die sich bei der Arbeit stellten. Der Zeichner A. Paul Weber hat Ernst und Friedrich Georg Jünger in den dreißiger Jahren beim Schachspiel porträtiert -: ein Bild, das die agonale Atmosphäre, die zwischen den beiden Brüdern herrschte, sichtbar werden läßt. Sie waren sich nicht nur Stütze, sondern auch Herausforderung.
Verlagsgruppe Random House
Erste Auflage
Lektorat: Matthias Weichelt, Berlin Reproduktionen: Mega-Satz-Service, Berlin
eISBN : 978-3-641-02348-5
www.siedler-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de