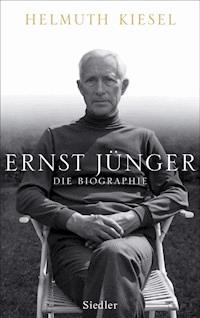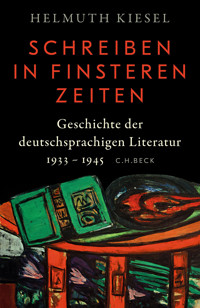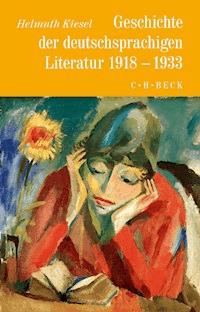
Geschichte der deutschen Literatur Bd. 10: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933 E-Book
Helmuth Kiesel
46,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die krisengeschüttelten Jahre zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der NS-Herrschaft in Deutschland wurden zu einer Glanzzeit der deutschsprachigen Literatur. Ihre Entwicklung erschließt Helmuth Kiesel in dieser großen Literaturgeschichte in drei Durchgängen: zunächst epochengeschichtlich, dann politik- und gesellschaftsgeschichtlich und schließlich gattungsgeschichtlich. Deutsche, österreichische und deutschschweizerische Verhältnisse werden gleichermaßen berücksichtigt.
Krieg und Novemberrevolution erzwangen nicht nur große politische und soziale Veränderungen. Sie bewirkten auch eine Politisierung der Literatur, die diese Umgestaltung, die mit ihr verbundenen Auseinandersetzungen und die rasante Modernisierung der Lebensverhältnisse zeitnah abzubilden und kämpferisch zu beeinflussen versuchte. Diese sogenannte Zeitliteratur brachte eine Fülle von Gedichten, Dramen, Romanen, Reportagen und Essays hervor. Zugleich entstanden in dieser Epoche Meisterwerke wie Thomas Manns Zauberberg, Hugo von Hofmannsthals Turm und Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, in denen traditionelle Darstellungsformen mit avantgardistischen und medialen Techniken auf eine bis heute mustergültige und anregende Weise miteinander verbunden wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 1933
vonHelmuth Kiesel
C.H.Beck
ZUM BUCH
Die krisengeschüttelten Jahre zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der NS-Herrschaft in Deutschland wurden zu einer Glanzzeit der deutschsprachigen Literatur. Ihre Entwicklung erschließt Helmuth Kiesel in dieser großen Literaturgeschichte in drei Durchgängen: zunächst epochengeschichtlich, dann politik- und gesellschaftsgeschichtlich und schließlich gattungsgeschichtlich. Deutsche, österreichische und deutschschweizerische Verhältnisse werden gleichermaßen berücksichtigt.
Krieg und Novemberrevolution erzwangen nicht nur große politische und soziale Veränderungen. Sie bewirkten auch eine Politisierung der Literatur, die diese Umgestaltung, die mit ihr verbundenen Auseinandersetzungen und die rasante Modernisierung der Lebensverhältnisse zeitnah abzubilden und kämpferisch zu beeinflussen versuchte. Diese sogenannte Zeitliteratur brachte eine Fülle von Gedichten, Dramen, Romanen, Reportagen und Essays hervor.
Zugleich entstanden in dieser Epoche Meisterwerke wie Thomas Manns Zauberberg, Hugo von Hofmannsthals Turm, Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, Marieluise Fleißers Mehlreisende Frieda Geier und Bertold Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe, in denen traditionelle Darstellungsformen mit avantgardistischen und medialen Techniken auf eine bis heute mustergültige und anregende Weise miteinander verbunden wurden. Es sind diese Exponenten der reflektierten Moderne, die bis heute in erster Linie angeführt werden, wenn nach den künstlerisch bedeutendsten und repräsentativsten Werken der Epoche gefragt wird.
ÜBER DEN AUTOR
Helmuth Kiesel lehrt Geschichte der neueren deutschsprachigen Literatur am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg. Bei C.H.Beck liegt von ihm vor: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert (2004).
INHALT
EINLEITUNG
ERSTER TEIL: EPOCHENPROFIL UND HISTORISCHE RAHMUNGEN
I. POLITIKGESCHICHTLICHE ASPEKTE
1. 1918–1933 als Beobachtungszeitraum
2. Geschichtliche Rahmungen, auch im Spiegel der Literatur
3. Internationale Beziehungen
4. Literarische Vermittlungen
5. Europäische Hoffnungen und Enttäuschungen: Yvan Goll
II. GESELLSCHAFTSGESCHICHTLICHE UND LITERATURSOZIOLOGISCHE ASPEKTE
1. Grundlinien der gesellschaftlichen und literarischen Entwicklung
1.1. Deutschland
1.2. Österreich
1.3. Schweiz
1.4. Deutsche Literatur in den verlorenen Gebieten und «auslandsdeutsche Literatur»
2. Literatursoziologische Umstände
2.1. Zur Frage der Eigenständigkeit der «Weimarer Kultur»
2.2. Im Prozeß der Modernisierung
2.3. Aspekte der Moderne
Krise der «klassischen» Moderne?
«Heroische» Moderne?
«Reflektierte» oder «synthetische» Moderne
2.4. «Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen»
2.5. «Übergangszeit»: Soziale Bedingungen und kulturelle Tendenzen
Demographischer Wandel und Gegensatz der Generationen
Wandel der Klassenstruktur und Ansätze zu einer «nivellierten Massenkultur»
III. GEISTIGE KOORDINATEN
1. Geistes- und kulturgeschichtliche Koordinaten
1.1. Wertewandel
1.2. Kulturelle Reduktion und «neue Barbarei»
1.3. Experimentalismus: Der «unbändige Wille zum Neuen»
1.4. Überwindung des modernen Fragmentarismus
2. Ideologische Koordinaten und politische Einstellungen
2.1. Brüchiges Verhältnis zur Republik
2.2. Ideologien, aber keine Staatsideologie
2.3. Verlust der Mitte und Flucht in den Radikalismus
2.4. Antibürgerlichkeit
2.5. Entfaltung von sozialem Haß und Propagierung von Gewalt
2.6. Charismatische Situation und Verlangen nach Führerschaft
3. Streit um die kulturelle Orientierung: Metropole und Provinz
3.1. Anfänge und Grundpositionen der Stadt-Land-Debatte
3.2. Berlin im Fokus
3.3. Metropole und Provinz: Wechselseitige Ressentiments
3.4. Keine Flucht vom «Kriegsschauplatz» Berlin!
3.5. Wien und Salzburg
4. ‹Asphaltliteratur› oder ‹Dichtung der Landschaft›?
4.1. Der Richtungsstreit in der Berliner Dichterakademie
4.2. Literatur der ‹Landschaft› in der Diskussion
4.3. Der Streit um Alfred Döblins Metropolenroman Berlin Alexanderplatz
5. Faktoren und Tendenzen des literarischen Lebens
Verlags- und Produktionszahlen
Krise des Buchhandels und Gründung von Buchgemeinschaften
Politische Ausrichtungen
Literaturkritik und Literaturvermittlung, politisch und konfessionell
Umfang und soziale Situierung der Autorenschaft
IV. LITERATUR UND POLITIK
1. Die Politisierung der Literatur während des Ersten Weltkriegs
2. Der Ernstfall der Politisierung: Die Revolution
2.1. Die literarische Vorbereitung der Revolution
2.2. Die «Geistigen» in der Revolution
Deutsche Verhältnisse
Österreichische Verhältnisse
3. Auseinandersetzungen mit dem Politisierungspostulat
3.1. Verneinung aller Politik: Hermann Graf Keyserling
3.2. Vermeidung von Politik: Rainer Maria Rilke und Gottfried Benn
3.3. Protest gegen das Politisierungspostulat: Franz Werfel und Thomas Mann
3.4. Befreiung von der Politik durch «reine» Kunst: Kurt Schwitters
3.5. Religion statt Politik: Hugo Ball
3.6. Urlaub von der Politik:Erzählungen von Armin T. Wegner und Thomas Mann
3.7. Die unumgängliche Politisierung eines Werks: Thomas Manns Zauberberg und Mario und der Zauberer
4. Ein Rückblick aus dem Jahr 1929
5. Konsequenzen der Politisierung
5.1. Konjunktur der ‹Zeitliteratur›
5.2. Literarisierung des Politischen und Zensur
ZWEITER TEIL: LITERATUR ALS SPIEGEL UND GESTALTUNGSFAKTOR DER EPOCHE
I. REVOLUTION UND NACHKRIEGSWIRREN
1. Literarische Reflexionen
1.1. Revolutionsliteratur
Manifeste
Gedichte
Essayistik
1.2. Fiktionale Spiegelungen der Revolution
Dramatische Spiegelungen
Romane
1.3. «Fazit der Perspektiven»
2. Friedensschlüsse und Verfassungsgebung
2.1. Literarische Reaktionen auf den Frieden
2.2. Die Verfassunggebende Versammlung
2.3. «Versailles» in der Literatur ab Mitte der zwanziger Jahre
3. Gebietsverluste, Grenzlandstreitigkeitenund Grenzlanddiskurs
3.1. Historische Grundlegung
3.2. Elsaß-Lothringen
3.3. Baltikum
3.4. Westpreußen und Posen
3.5. Oberschlesien
3.6. Böhmen, Egerland, Mähren
3.7. Südtirol
3.8. Resümee
II. KRISENJAHRE
1. Schieberzeit und Inflation
1.1. Mentalitätsgeschichtliche Bedeutung
1.2. Typen: «Raffkes», Schieber und Spieler
1.3. Historisches: Ursachen und Verlauf der Inflation
1.4. Literarisierung der Inflationszeit
1.5. Sittenbilder aus der österreichischen Inflationszeit: Hugo Bettauer, Robert Neumann u.a.
1.6. Konträres über den «Inflationskönig» Hugo Stinnes
1.7. Zwei Inflationsdramen aus späteren Jahren: Arnolt Bronnen und Walter Mehring
1.8. Erzählerische Rückblicke auf die Inflation um 1930: Martin Raschke, Adam Scharrer u.a.
1.9. Ein kritischer und doch versöhnlicher Abschlußroman: Josef Wincklers Großschieber
2. Paramilitärische und arkane Gewalt
2.1. Freikorps und Geheimbünde
2.2. Politische Morde und Fememorde
2.3. Öffentliche Reaktionen
2.4. Überblick: Publizistische und literarische Reflexionen
2.5. Deutschsein – Jüdischsein: Ein Aufruf zur Brüderlichkeit
2.6. Politischer Mord in Erzählwerken der Jahre 1923 bis 1930: Joseph Roth, Vicki Baum, Alfred Neumann u.a.
2.7. Täter und Sympathisanten melden sich zu Wort
2.8. Drei kritische Dramen: Peter Martin Lampel, Ödön von Horváth, Curt Corrinth
2.9. Zwei Romane von Eingeweihten: Ernst von Salomon und Friedrich Wilhelm Heinz
2.10. Freikorps-‹Helden› in der Außensicht: Romane von Arnolt Bronnen und Hanns Heinz Ewers
3. Umsturzversuche und Unruhen
3.1. Kapp-Lüttwitz-Putsch
3.2. Ruhrkrieg
3.3. Mitteldeutscher Aufstand oder Märzaktion 1921
Lebensbericht eines Sozialrebellen: Max Hoelz
Literarische Aufarbeitung der Märzaktion
4. «Franzosen- und Separatistenzeit» an Rhein und Ruhr
4.1. Politik und Publizistik
4.2. Die Debatte um den historisch-politischen Status des Rheinlands: Maurice Barrès, Ernst Bertram, Josef Winckler u.a.
4.3. Tausend Jahre deutsches Rheinland
4.4. Weitere literarische Reaktionen auf den Rhein-Ruhr-Konflikt
Zwei frühe Greuelromane
Der Fall Schlageter
Romane aus den Jahren 1924–1931
Vier Dramen über die «Franzosen- und Separatistenzeit»
Nationalistische Darstellungen um 1930
Darstellungen linker Provenienz
Drei letzte unbeschwerte Rheinlandbücher
5. Das Krisen- und Putschjahr 1923
5.1. Der Küstriner Putschversuch der Schwarzen Reichswehr
5.2. Deutscher Roter Oktober
5.3. Hitler-Putsch
III. FRÜHE LITERARISCHE REFLEXIONEN DES ERSTEN WELTKRIEGS
1. Umfänge, Formen und Phasen der Kriegsdarstellung
2. Zwischen Heroismus und Pazifismus: Fritz von Unruh und Paul Zech
3. Frühe kriegsaffine Kriegsbücher: Franz Schauwecker, Werner Beumelburg, Ernst Jünger
4. Zwei gegensätzliche lyrische Reaktionen: Stefan George und Oskar Kanehl
5. Frühe kriegskritische und pazifistische Werke
5.1. Das Aufblühen der Friedensbewegung
5.2. Frühe pazifistische Literatur unterschiedlicher Gattungen: Leonhard Frank, Claire Studer-Goll, Bruno Vogel u.a.
5.3. Die «unrühmlichen» Seiten des Kriegs: Etappe, Lazarett, Schanzarbeit und Tollhaus
5.4. Pazifistische Kriegsdramen: Alfred Döblin und Karl Kraus
IV. DIE MITTLERE PHASE ODER DIE NICHT NUR «GOLDENEN» ZWANZIGER
1. Atempause: Politische und ökonomische Stabilisierung
2. Literarische Spiegelungen
2.1. Zeitstücke: Johst, Zuckmayer, Toller
2.2. Zeitgedichte – Streitgedichte
2.3. Zeitdiagnostische und weltanschauliche Essayistik
2.4. Die Fülle der Zeitromane: Vorsortierung
3. Romane über die Jahre des Übergangs 1923–1925: Walther von Hollander, Joseph Roth, Siegfried Kracauer u.a.
4. Zwei Reichspräsidenten im Spiegel der Literatur
4.1. Friedrich Ebert
4.2. Paul von Hindenburg
5. Zwei propagandistische Romane des Jahres 1926: Johannes R. Becher und Hans Grimm
5.1. Aus dem kommunistischen Lager: Levisite oder Der einzig gerechte Krieg
5.2. Aus dem nationalistischen Lager: Volk ohne Raum
6. Zukunftsromane: Hans Dominik, Alfred Döblin u.a.
7. Lebensformen und Lebensfragen im Roman der mittleren und späten zwanziger Jahre
7.1. Einblicke in verschiedene Milieus: Leonhard Frank, Meinrad Inglin, Hans Sochaczewer u.a.
7.2. Lebenskrisen: Max Pulver und Hermann Hesse
7.3. Bilder modernen Lebens – Großstadtglanz: Wilhelm Speyer, Vicki Baum, Gabriele Tergit u.a.
7.4. Sportbegeisterung: Kasimir Edschmid und Marieluise Fleißer
7.5. Imaginationen der «Neuen Frau»: Irmgard Keun u.a.
7.6. Probleme der Jugend: Friedrich Torberg, Ernst Glaeser, Peter Martin Lampel, Erich Noth u.a.
7.7. Justiz- und Haftkritik: Jakob Wassermann, Ernst Ottwalt u.a.
8. Ausschweifungen in eine heile Welt: Kurt Tucholsky u.a.
9. Optimierungsphantasien: Wolfgang C. Ludwig Stein, Paul von Schoenaich und Hans Natonek
10. Zwei Rückblicke auf die Goldenen Zwanziger: Erik Reger und Robert Neumann
11. Ein Fanal: Der Brand des Wiener Justizpalastes 1927
V. LITERATUR DER ARBEITSWELT
1. Aspekte der Produktion und Rezeption
1.1. Ausdifferenzierung der ‹Arbeiterliteratur›
1.2. Adressaten
1.3. Organisatorische Unterstützung
1.4. Literaturtheoretische Begleitung: Klassenkämpfer und Kunstlumpen
1.5. Reaktionen der bürgerlichen Literaturkritik
1.6. Bestandsaufnahme 1929
2. Anthologien
3. «Arbeiterdichter» der frühen zwanziger Jahre: Alfons Petzold, Karl Bröger, Heinrich Lersch, Paul Zech u.a.
4. Werkstudentenromane
5. Vagabunden
6. Klassenkämpferische Arbeiterliteratur der mittleren und späten zwanziger Jahre
6.1. Gedichte, Erzählungen, Romane
Die Fähigkeit zur Empörung: Kurt Kläber
Abenteuerromane über den weltweiten Kapitalismus: B. Traven und Heinrich Hauser
6.2. Proletarisch-revolutionäres Arbeitertheater: Erwin Piscator
6.3. Die Arbeiter-Sprechchorbewegung
6.4. BPRS-Betriebsliteratur: Willi Bredel, Hans Marchwitza u.a.
7. Neue, nicht parteigebundene Arbeiterdichtung: Theodor Kramer und Walter Bauer
8. Proletarische Autobiographien und Lebenserinnerungen: August Winnig, Heinrich Lersch, Ludwig Turek, Adam Scharrer u.a.
9. Neusachliche Fotobücher: Heinrich Hauser, Georg Schwarz, Graf Alexander Stenbock-Fermor
10. Die literarische Entdeckung der Angestellten: Joseph Breitbach, Christa-Anita Brück, Hans Fallada, Martin Kessel u.a.
Die weiblichen Angestellten
Nöte der Konfektionsangestellten: Kleiner Mann – was nun?
Und ein Blick auf die besseren Angestellten
11. Der Roman der Schwerindustrie: Erik Regers Union der festen Hand
VI. DIE JAHRE DER RADIKALISIERUNG UND DER KRISE
1. Krieg, Revolution und Nachkriegswirren in der Literatur um 1930
1.1. Die literarische Wiederkehr des Weltkriegs
1.2. Der Weltkrieg im Spiegel der Romane: Panorama
1.3. Kriegskritische Romane: Ludwig Renn, Erich Maria Remarque, Edlef Köppen u.a.
1.4. Nationalistisch-bellizistische Kriegsromane und Fotobücher: Werner Beumelburg, Franz Schauwecker u.a.
1.5. Wirkungsfragen
1.6. Kriegsdramen mit unterschiedlichem Erfolg
1.7. Ein «Volksbuch» vom Krieg und vom unmöglichen Frieden
1.8. Spiegelungen der Revolution in Dramen und Romanen der Jahre 1927/28: Joseph Roth, Leo Perutz u.a.
1.9. Vier Matrosenstücke von 1930/31: Theodor Plievier, Friedrich Wolf u.a.
1.10. Episodische Revolutionsdarstellungen in Romanen
1.11 Aufarbeitung des Scheiterns: Revolutionsromane von Georg Hermann, Theodor Plievier, Ernst Glaeser, Carl Weiskopf
1.12. Die Revolutions- und Nachkriegszeit in Romanen der frühen dreißiger Jahre: Erich Maria Remarque, Franz Schauwecker, Bruno Brehm u.a.
Fortsetzungen
Über den Untergang der Monarchien
2. Literarische Formierung der politischen Extreme
2.1. Lagerbildung und Militarisierung der Literatur
Fronten
Literatur und Literaturkritik als Waffen
Das Ende der Gruppe 1925
2.2. Der Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller (BPRS)
Proletarisch-revolutionäre Planliteratur: Johannes R. Becher u.a.
Agitationsliteratur
Zwiespältige Blicke auf die Sowjetunion: Walter Benjamin, Joseph Roth u.a.
2.3. Zwischen links und rechts: Austauschdiskurse und Gruppenkonflikte
2.4 Konservative Revolution und Neuer Nationalismus
Die Literarisierung des «neuen» Nationalismus
Das Konzept der Konservativen Revolution
Die Jungkonservativen und das ‹Dritte Reich›
«Revolutionärer» und «soldatischer» Nationalismus: Der Kreis um Ernst Jünger
2.5. Kulturelle und literarische Aufrüstung der Nationalsozialisten
Nationalsozialistische «Kulturarbeit» um 1930
Erste nationalsozialistische Texte
Präsenzsteigerung durch Verlautbarungen und Störaktionen
3. Das Ende der Weimarer Republik
3.1. Kampf um das Bild der Republik: Fotobücher als Waffen
3.2. «Deutsches Elend», von außen gesehen
3.3. Von rechts und von links: Demokratie-, Parteien- und Parlamentarismuskritik
3.4. Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit
Die Wirtschaftskrise in Zeitromanen
Zwei Dramen zur Wirtschaftskrise: Gustav von Wangenheim und Hermann Broch
Arbeitslosigkeit als Massenphänomen
3.5. Der Auftakt zum Bürgerkrieg: Blutmai 1929
3.6. Bürgerkriegsliteratur: Mobilisierungsromane, Zeitstücke und Instruktionsschriften
3.7. «Landvolk» gegen die Republik
3.8. Schriftsteller als politische Vordenker, Mahner und Warner
3.9. Was tun? Reflexionsromane aus den beiden letzten Jahren
3.10. Bleiben oder gehen?
DRITTER TEIL: DIE ENTWICKLUNG DER GATTUNGEN
I. LYRIK
1. Umfänge und Tendenzen
2. Schlußakkorde alter Meister: Rainer Maria Rilke und Stefan George
3. Avantgardistische und kabarettistische Diversifizierung: Yvan Goll und Kurt Schwitters, Walter Mehring und Klabund
4. Formen und Funktionen der politischen Lyrik
5. Zwei neue Großmeister: Gottfried Benn und Bertolt Brecht
6. Lyrische Querelen am Ende der zwanziger Jahre
7. Traditionalisten und neue Naturlyriker
8. Großstadt- und Frauenlyrik: Zwei repräsentative Anthologien
II. DRAMATIK
1. Auslese
2. Phasen und Impulse, Krisendiagnosen und kabarettistische Inspirationen
3. Von der expressionistischen Kompromißlosigkeit zum neusachlichen Laissez-faire
4. Konjunktur der Komödie und Wiederbelebung des Volksstücks
5. Historische Spiegelungen gegenwärtiger Probleme, insbesondere Hugo von Hofmannsthals Der Turm
6. Wirkungsvolles Mitleidstheater: Peter Martin Lampel und Friedrich Wolf
7. Bertolt Brechts Episches Theater
III. EPIK
1. Romane der ersten Nachkriegsjahre
2. Die Erzähl- und Romandebatte
3. Pionier- und Meisterwerke der reflektierten Moderne: Franz Kafka, Thomas Mann, Alfred Döblin, Hans Henny Jahnn, Robert Musil, Hermann Broch
4. Pflege der traditionellen Erzähl- und Romanform: Joseph Roth
5. Exempel des historischen Romans und des Bauern- oder Dorfromans
6. Novellistisches und Legendenhaftes
EPILOG: KARL UND DAS ZWANZIGSTE JAHRHUNDERT: RUDOLF BRUNNGRABERS BEOBACHTUNG DER «HEROISCHEN» MODERNE
ANHANG
AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE
Theorie und Methodologie der Literaturgeschichte
Grundlegend wichtige Dokumentationen
Literaturgeschichten und literaturgeschichtliche Sammelbände
Wichtige neuere und weiterführende Studien zur Literatur der Zeit
Zur Lyrik
Zur Dramatik
Zur Epik
Literatur und neue Medien
Literarisches Leben: Autorenschaft, Verlagswesen, Institutionen, Literaturkritik, Zeitschriften usw.
Politische Entwicklung und politische Kultur, ökonomische und soziale Verhältnisse, Literatur und Politik
Internationale Bezüge
Österreich
Schweiz
REGISTER
EINLEITUNG
Für die deutschsprachige Literatur wurden die vierzehn bewegten Jahre zwischen dem 9. November 1918 und dem 30. Januar 1933, zwischen der revolutionären Begründung der ersten deutschen Republik und ihrer leichtfertigen Preisgabe durch die Bestellung Hitlers zum Reichskanzler, zu einer Glanzzeit. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs entstand unter den Bedingungen liberaler Verfassungen und provoziert durch die anhaltenden politischen, sozialen und geistigen Probleme der 1920er Jahre eine große Zahl hochkarätiger, innovativ und zugleich auf Dauer mustergültig wirkender Werke aller literarischen Gattungen. Exemplarisch seien vorweg drei dichterische Leistungen genannt, an denen die Signatur der Zeit und die aus ihr erwachsenen poetischen Ansprüche der Autoren in besonderer Deutlichkeit abzulesen sind: Gottfried Benns Weltanschauungslyrik, wie sie sich in den geschichtsphilosophischen Montagegedichten Chaos (1923) und Qui sait (1927) zeigt; Alfred Döblins vielstimmiger, alltagsnaher und zugleich mythologisch überwölbter Großstadtroman Berlin Alexanderplatz (1929); schließlich Bertolt Brechts formenreich anklägerisches und ergreifendes System- und Wirtschaftskrisendrama Die heilige Johanna der Schlachthöfe (1932). Daneben stehen gleichrangig in der Lyrik: Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien (1923), Bertolt Brechts Hauspostille (1927), Stefan Georges letzter Gedichtband Das Neue Reich (1928) und Oskar Loerkes Atem der Erde (1930); in der Dramatik: Georg Kaisers Gas (1918–20), Karl Kraus’ Die letzten Tage der Menschheit (1922), Hugo von Hofmannsthals Der Turm (1925), Bertolt Brechts und Kurt Weills Musikdrama Die Dreigroschenoper (1928); in der Epik: Thomas Manns Der Zauberberg (1924), Hermann Hesses Der Steppenwolf (1927), Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften (1930–33), Hermann Brochs Die Schlafwandler (1930–32). Es sind die Exponenten der sogenannten klassischen – aber besser: reflektierten – Moderne (s.S. 92 f.), die bis heute in erster Linie angeführt werden, wenn nach den künstlerisch bedeutendsten und repräsentativsten Werken der Epoche gefragt wird. Einige von ihnen – Thomas Manns Zauberberg und Hofmannsthals Turm seien als herausragende Beispiele genannt – haben traditionelle Darstellungsweisen modernisiert und zu einer neuen Hochform geführt; andere – wie Döblins Berlin Alexanderplatz und Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe – arbeiteten mit avantgardistischen Mitteln, waren in augenfälliger Weise innovativ und wirkten inspirierend auch für die zweite Phase der reflektierten Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg.
Daneben sind in allen Sparten der Literatur großartige Leistungen zu registrieren, von denen hier – wiederum in exemplarischer Absicht – einige angeführt seien: als Epochenromane: René Schickeles Trilogie Das Erbe am Rhein (1925–31), Joseph Roths Radetzkymarsch (1932) und Rudolf Brunngrabers Karl und das zwanzigste Jahrhundert (1933); als Auseinandersetzungen mit dem Weltkrieg: Ernst Jüngers In Stahlgewittern (1920), Arnold Zweigs Roman Der Streit um den Sergeanten Grischa (1926), Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues (1929) und Edlef Köppens Heeresbericht (1930); als politische Zeitromane: Lion Feuchtwangers Erfolg (1930), Hans Falladas Bauern, Bonzen und Bomben (1931) und Erich Kästners Fabian (1931); als historische Romane: Erwin Guido Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie (1917–26), Lion Feuchtwangers Jud Süß (1925) und Ina Seidels Roman Das Wunschkind (1930); als Epos der versinkenden bäuerlichen Lebenswelt: Paula Groggers Das Grimmingtor (1926) und Hermann Eris Busses Bauernadel (1930); als Roman der ‹kleinen Leute›: Hans Falladas Kleiner Mann – was nun? (1932); als Romane der ‹neuen Frau›: Marieluise Fleißers Mehlreisende Frieda Geier (1931) und Irmgard Keuns Gilgi – eine von uns (1931) sowie Das kunstseidene Mädchen (1932); als Roman der industriellen Wirtschafts- und Arbeitswelt: Erik Regers Union der festen Hand (1931); als Ausdruck kommunistischen Revolutionsbegehrens: Bertolt Brechts «Lehrstück» Die Maßnahme (1930–32) mit der Musik von Hanns Eisler und Anna Seghers’ Roman Die Gefährten (1932); als Erzählung jüdischen Lebensleids und Lebensglücks: Joseph Roths Hiob (1930); als Volksstücke neuen Stils: Carl Zuckmayers Komödie Der fröhliche Weinberg (1925) und Ödön von Horváths Geschichten aus dem Wiener Wald (1931); als sozialreformerisches Kampfdrama: Friedrich Wolfs Cyankali § 218 (1929) – und anderes mehr.
Die meisten dieser Werke und viele andere, die in einer nicht nur exemplarisch gemeinten Liste anzuführen wären, sind aufgrund ihrer künstlerischen Qualität, ihrer historischen Vermittlungsleistung und existentiellen Erhellungskraft bis heute lebendig und werden, wenn auch in unterschiedlichem Maß, von einem breiteren Publikum wahrgenommen oder zumindest im literaturwissenschaftlichen und literaturkritischen Diskurs in Erinnerung gehalten. Manche – wie Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie – sind aus Gründen der politischen Verfehlungen der Autoren – also vor allem der Parteinahme für den Nationalsozialismus – mehr oder minder geächtet und aus der Rezeption verdrängt, doch dürfen sie in einer Literaturgeschichte der 1920er Jahre nicht fehlen, zumal ihnen die spätere Hinwendung der Autoren zum Nationalsozialismus nicht unbezweifelbar eingeschrieben ist. Ebenso müssen in einer Literaturgeschichte Werke berücksichtigt werden, die heute aufgrund ihrer inhaltlichen und formalen Antiquiertheit mehr oder minder reizlos sind, damals aber – wie die Bestseller von Rudolf Herzog, Walter Bloem und Paul Oskar Höcker – eine breite Leserschaft hatten. Zwar ist es legitim und aus mancherlei Gründen auch sinnvoll, sich an die Spitzenleistungen zu halten und manches andere außer Betracht zu lassen. Prinzipiell gilt aber, was Kurt Tucholsky 1925 anläßlich eines Artikels über die populären Bücher des belgisch-französischen Schriftstellers Clément Vautel feststellte: «Nicht nur Gerhart Hauptmann repräsentiert die deutsche Literatur, sondern auch die Herren Herzog und Hoecker.»
Zudem auch «die Herren» Salomon und Heinz sowie Marchwitza und Hoelz, um vier Namen zu nennen, die für einen Autorentypus stehen, der zwar kein Spezifikum der Weimarer Republik ist, aber doch zu ihren auffallenden Erscheinungen gehört und ihrer Literatur einen besonderen Akzent gab. Es ist der Typus des militanten politischen Akteurs, der nach der Beteiligung an politischen Gewalttaten die Literatur als Reflexions- und Wirkungsmedium entdeckt. Friedrich Wilhelm Heinz war als Mitglied der Marine-Brigade Ehrhardt und der Organisation Consul an verschiedenen konterrevolutionären und antirepublikanischen Aktionen beteiligt, die er 1930 unter dem Titel Sprengstoff (s.S. 399 ff.) in romanartiger Form darstellte, nicht nur um sie nachträglich zu rechtfertigen, sondern auch um seine Position in den sich wieder verschärfenden politischen Auseinandersetzungen zu festigen. Ernst von Salomon, der ebenfalls Freikorps- und OC-Mitglied war, wurde 1922 wegen Beihilfe zur Ermordung Walther Rathenaus zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt und konnte sich danach mit seinem autobiographisch geprägten Roman Die Geächteten (1930; s.S. 392 ff.) einen Namen als Schriftsteller machen. Der im Krieg militärisch geschulte Bergarbeiter Hans Marchwitza kämpfte 1920 als Zugführer der Roten Ruhrarmee gegen die Freikorps, die nach dem Kapp-Putsch zur Befriedung des Ruhrgebiets eingesetzt wurden, und machte dies 1930 zum Gegenstand der literarisch geformten Darstellung Sturm auf Essen, die 1931 vom Staatsanwalt als staatsgefährdend bewertet und verboten wurde (s.S. 418 ff.). Max Hoelz war der populärste Arbeiterführer des mitteldeutschen Märzaufstands vom Frühjahr 1921 und wurde wegen bewaffneter Aktionen zu lebenslänglicher Haft verurteilt, aber 1928 begnadigt. Das Erscheinen seiner Briefe aus dem Zuchthaus (1927) und seiner Autobiographie Vom «Weißen Kreuz» zur roten Fahne (1929; s.S. 421 ff.) war jeweils ein literarisches Ereignis; auch wurde Hoelz etwa in Otto Gotsches Roman Sturmtage im März (1933; s.S. 428 ff.) selber zur literarischen Figur. Wie Heinz, Salomon, Marchwitza und einige andere Autoren steht er für die Verbindung von politisch motivierten Gewaltaktionen und Literatur, die, wenn nicht ein Spezifikum, so doch ein Charakteristikum der Literaturgeschichte der Weimarer Republik ist. Nicht umsonst hat der renommierte englische Journalist George Eric Rowe Gedye, der ein vorzüglicher Deutschland-Kenner war, sie 1930 im Titel eines Buches über ihre Anfangsjahre als «Revolver Republic» bezeichnet (s.S. 436). Eine Revolverrepublik war die Weimarer Republik aber nicht nur in den Anfangsjahren, als der politische Mord grassierte, sondern auch in den Endjahren, als der Straßenterror der extremen Parteien tobte und durch Mobilisierungsliteratur gefördert wurde.
Würde man die literarische Qualität allein zum Kriterium für die Berücksichtigung eines Werks in einer Literaturgeschichte machen, so käme von den zuletzt genannten Werken wohl nur Salomons Roman Die Geächteten in Frage. Das würde allerdings zu einer großen Entstellung der literarischen Verhältnisse in den zwanziger Jahren führen. Neben Werken, die primär als Kunstwerke konzipiert wurden und künstlerischen Ansprüchen zumindest genügen wollten, gibt es eine große Gruppe von Werken, bei denen eine politische, soziale oder weltanschauliche Mitteilungsabsicht einigermaßen geschickt oder auch nur notdürftig in eine Gedicht-, Dramen- oder Romanform gebracht ist. Vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, weniger jedoch in der Schweiz, bildeten die Jahre von 1918 bis 1933 eine Epoche, in der die Literatur, wie Friedrich Wolf 1928 in einem programmatischen Essay sagte, als «Waffe» im gesellschaftlichen «Kampf» um ideologische Ausrichtungen, politische Optionen, soziale Rechte, ökonomische Konzepte und kulturelle Werte verwendet wurde. Die literarische Dignität dieser sehr zeitbezogenen Literatur ist meist nicht eben hoch zu veranschlagen, wie in vielen Fällen schon die zeitgenössische Kritik anmerkte. Aber auch diese Werke oder Elaborate gehören zur Literatur jener Zeit und müssen historiographisch als eine ihrer charakteristischen Ausprägungen in angemessener Weise berücksichtigt werden. Bemerkenswert sind sie freilich nur im Rahmen einer Literaturgeschichte, die ihren Gegenstand – die literarischen Artikulationen einer Epoche – im Horizont nicht nur der Geistes- und Kulturgeschichte, sondern auch der politischen und sozialen Geschichte sieht, und das heißt: im unverkürzten gesellschaftsgeschichtlichen Rahmen. Das bedeutet – vielleicht nicht primär, aber jedenfalls auch – im nationalen Rahmen, der allerdings in den zwanziger Jahren problematisch wurde.
Der entschieden international und paneuropäisch ausgerichtete Otto Flake ließ 1928 in seinem Roman Freund aller Welt einen Literaturhistoriker mit der Bemerkung zu Wort kommen: «Bis zum Krieg nannten wir unsere Bücher Geschichte der deutschen Nationalliteratur. Heute würde die Hand zögern, diesen Titel niederzuschreiben.» Der Grund dafür ist – diesem fiktiven Literaturhistoriker zufolge – aber nicht etwa nur in der nationalen Aufgliederung des deutschen Sprachraums in Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie die «Grenzlande» zu sehen, sondern auch im großen Anteil der Juden an der modernen deutschen Literatur; auch deswegen könne es «fortan nur noch eine Geschichte der Literatur deutscher Sprache geben». Das sind (referierte) Überlegungen aus der Zeit des grassierenden Antisemitismus, dem Flake immer entgegengetreten ist und dem er auch in seinem Roman widersprechen läßt. Gleichwohl ist mit den Worten jenes Literaturhistorikers ein Thema benannt, das spätestens seit Moritz Goldsteins berühmtem, 1912 in der Zeitschrift Kunstwart erschienenen Aufsatz Deutsch-jüdischer Parnaß zur Debatte stand: die Bedeutung des Judentums für die deutsche Kultur und die Verhältnisbestimmung von Jüdischem und Deutschem, die sich in den Verlegenheitsbegriffen von «deutsch-jüdisch» oder «jüdisch-deutsch» artikulierte und die in den zwanziger Jahren zu prekären terminologischen Verrenkungen und betrüblichen Verwerfungen führen sollte, bevor sie eliminatorische Züge annahm. Jakob Wassermann hat dieses Problem schon 1921 in seinem Buch Mein Weg als Deutscher und Jude auf der Basis seiner individuellen Erfahrungen beschrieben, und Arnold Zweig hat mit seinem 1934 im Amsterdamer Exil-Verlag Querido erschienenen Buch Bilanz der deutschen Judenheit 1933 einen weit ausgreifenden «Versuch» unternommen, die Geschichte der kulturell so fruchtbaren und politisch so belasteten deutsch-jüdischen Beziehungen in historischer Tiefe und systematischer Breite darzustellen.
Gegen den Begriff der «deutschen Nationalliteratur», den Flakes Literaturhistoriker 1928 für obsolet erklärte, sprachen aber längst auch andere, politische und landsmannschaftliche Differenzierungen Deutschlands, gleich, ob in den Grenzen des großräumigen «Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation» oder des «[Klein-]Deutschen Reichs» von 1871, dessen republikanischer Nachfolgestaat, die Weimarer Republik, offiziell «Deutsches Reich» hieß. Der österreichische Literaturhistoriker Josef Nadler hat dieser inneren Differenzierung der deutschen Literatur durch seine mehrbändige Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften (1912–28) Rechnung zu tragen gesucht. Dies geschah auf eine Weise, die heute trotz Nadlers stupendem Wissen bestenfalls als «umstritten» gilt (so Irene Ranzmaier 2008 in der Einleitung ihrer detaillierten Darstellung von «Nadlers Konzeption der deutschen Literaturgeschichte»). Zumeist wird Nadlers Konzept als Beispiel einer in die Irre gehenden «deutschen» oder «völkischen» Wissenschaft abgelehnt, und dies nicht nur, weil Nadler schon in den zwanziger Jahren zum Antisemitismus tendierte und 1938 einen (später bewilligten) Antrag auf Aufnahme in die NSDAP stellte; das spekulative Element seiner essentialistischen «stammeskundlichen» Betrachtungsweise und vieler der von ihm behaupteten Affinitäten ist nicht zu übersehen. Dennoch hat kein Geringerer als Walter Benjamin 1929 in seiner Rezension von Hans Heckels Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien (1929) zweimal von den «anregenden Entwürfen» Nadlers gesprochen und für ein «vertieftes Studium der Literatur in ihrer sozialen und landschaftlichen Bedingtheit» plädiert. Die zunächst volkskundlichen, dann sozialgeschichtlichen und regionalgeschichtlichen Literaturstudien haben sich dies zu eigen gemacht und den Begriff der Nationalliteratur zunächst «von unten» ergänzt, zugleich aber auch unterminiert und suspendiert. Eine «Geschichte der deutschen Literatur» meint nun in der Tat eine «Geschichte der deutschsprachigen Literatur» in ihrer politisch bedingten räumlichen Differenziertheit, die bei der Dreiteilung in reichsdeutsche, österreichische und schweizerdeutsche Literatur nicht stehenbleiben muß, sondern sich im Blick auf binnendeutsche Regionen, Grenzgebiete oder gar ausländische deutsche Literaturgebiete (wie Rumänien) verfeinern läßt. Die Auflösung der Nationalliteratur in Regionalliteraturen würde der Sache allerdings auch nicht gerecht. Westfälische oder oberrheinische oder bayerische, ja auch siebenbürgische oder rumäniendeutsche Literatur steht immer im Zusammenhang mit dem, was deutsche Literatur hieß, gleich ob die Werke nun von einem Theodor Storm, einem Adalbert Stifter oder einem Gottfried Keller stammten.
So wichtig wie der nationale Rahmen ist der europäische Horizont. Deutsche Literatur war schon im Mittelalter europäisch inspirierte Literatur und wurde dazu erst recht, als sie von Martin Opitz mit seinem Buch von der deutschen Poeterey (1624) und von Johann Christoph Gottsched mit seinem Versuch einer Critischen Dichtkunst (1730) ausdrücklich auf den Boden der modernen europäischen Poetik gestellt wurde. Auch der poetologische Blick der großen deutsch(sprachig)en Autoren der 1920er Jahre war europäisch; Alfred Döblin, um ein Beispiel zu geben, trat 1912/13 in eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem italienischen Futuristen F. T. Marinetti ein und studierte 1927/28 während der Arbeit an seinem innovativen Hybridroman Berlin Alexanderplatz (1929) intensiv James Joyces Ulysses (1922) in der deutschen Übersetzung von 1927 als unerschöpfliches «Lehr-Kunstwerk» (wie Döblin sagte). Im übrigen gibt es prominente Fälle deutschsprachiger Literatur aus den zwanziger Jahren, die sich einer nationalen Zuordnung letztlich entziehen und dadurch anzeigen, daß es trotz nationaler Differenzen angebracht ist, von einer transnationalen «deutschen» Literatur im Sinne einer «deutschsprachigen» Literatur zu sprechen. Hermann Hesse, 1877 im württembergischen Calw geboren, war 1912 von Gaienhofen am Bodensee nach Bern übergesiedelt und 1919 ins Tessiner Montagnola gezogen. 1923 wurde er Schweizer Staatsbürger. Der danach entstandene Roman Der Steppenwolf (1927) könnte, wie einzelne Ortsangaben suggerieren, in Basel spielen, wo Hesse mehrmals für eine gewisse Zeit gelebt hatte; aber der Protagonist Haller ist ein deutscher Intellektueller und Publizist, der während des Kriegs eine kritische Position gegenüber Deutschland vertreten und sich dadurch seiner Heimat wie seiner bürgerlichen Existenz entfremdet hat. Nationales und Lokales ist im Roman erkennbar vorhanden, aber doch nur von nachrangiger Bedeutung. Hesses Steppenwolf, von einem ‹Ex-Deutschen› und ‹Neu-Schweizer› im schweizerischen Montagnola geschrieben und von S. Fischer in Berlin verlegt, ist weder ein deutscher noch ein schweizerischer Roman, sondern ein deutschsprachiger Roman für ein internationales Publikum. Solche Koinzidenzen und Grenzverwischungen entheben allerdings nicht der Pflicht, die Besonderheiten der österreichischen und schweizerdeutschen Literaturverhältnisse der Jahre zwischen 1918 und 1933 zu beachten; dies geschieht ausdrücklich in zwei grundlegenden Abschnitten (s.S. 68 ff.), aber auch in den weiteren Ausführungen über einzelne Sektoren und Werke.
Daraus ergibt sich die Perspektivik der vorliegenden Literaturgeschichte. Sie blickt in einem ersten, politik- und gesellschaftsgeschichtlichen Durchgang auf die politischen und sozialen Dimensionen der Literatur jener Zeit und in einem zweiten, gattungsgeschichtlichen Durchgang auf die Entwicklung der großen literarischen Formen unter den Bedingungen der avancierten und medial erweiterten Moderne. Diese beiden Betrachtungsweisen sind aber nicht widersprüchlich oder einander ausschließend, als hätten sie nichts miteinander zu tun, sondern – bei unterschiedlicher Fokussierung – einander berührend und überlappend. Viele und zumal auch wichtige Werke wie Thomas Manns Zauberberg und Bertolt Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe sind für beide Beobachtungsinteressen von Bedeutung, und ebenso ist zu sehen, daß die politische Justierung der Literatur und ihre mediale Modernisierung oft Hand in Hand gingen. So führte die Beschäftigung mit dem aufkommenden Rundfunk bei Brecht um 1927 sofort zu der Frage, wie dieses neue Medium im Sinne seines ‹eingreifenden› Literaturverständnisses genutzt werden könnte, und spiegelt sich nicht nur in seiner ‹interaktiven› Radiotheorie, sondern auch in seinen frühen Badener Lehrstück-Versuchen und in einigen Erscheinungsformen seiner Gedichte «für Städtebewohner». Ebenso ging Brechts Interesse am Film eine Verbindung mit seiner politisch-sozialen Wirkungsabsicht ein: Das bemerkenswerteste seiner vielen Filmprojekte, der Kinofilm Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt? (1932), hat die Arbeitslosigkeit und die sozialistische Mobilisierung der Jugend zum Inhalt.
Die genannten beiden Beobachtungsinteressen bestimmen selbstverständlich die Auswahl der behandelten Werke, die ebenso selbstverständlich begrenzt ist. Große Werkgruppen wie die ungeheure Fülle der historischen Romane, Dramen und Biographien oder die Vielzahl der Reisebücher können nur in äußerst begrenzter Zahl berücksichtigt werden.
Daß Literatur in ihren soziokulturellen Zusammenhängen zu sehen sei, ist weder eine Erfindung der Literaturwissenschaft noch eine ihrer bloß modischen Erscheinungsformen. Diese Verbindung entspricht vielmehr dem Wesen der Literatur, wie kein Geringerer als Thomas Mann festgestellt hat, und zwar aus Anlaß der Gründung der prominenten Dichterakademie oder genauer der «Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste» am 26. Oktober 1926. Mann sagte bei dieser Gelegenheit, jeder Künstler und «besonders jeder Dichter von Wirkung» mache, «wenn nur erst gewisse Jahre bohemehafter Absolutheit und Beziehungslosigkeit vorüber sind», eine wichtige Erfahrung:
Er entdeckt, daß er ein Ausdruck war, ein Mundstück; daß er für viele sprach, als er für sich, nur von sich zu sprechen glaubte. Er entdeckt, daß er allenfalls empfindlicher und ausdrucksreicher ist als die Mehrzahl der anderen, aber nicht anders, nicht fremd, nicht wirklich einsam, daß Kunst- und Geisteswerke nicht nur sozial genossen, sondern auch schon sozial empfangen, konzipiert werden: in einer tiefen, abenteuerlichen Einsamkeit, die sich, wer hätte es gedacht, als eine besondere Form der Gesellschaftlichkeit, als soziale Einsamkeit entpuppt. Mit einem Worte, er entdeckt, er erlebt, er erfährt es mit wirklicher Ergriffenheit, daß Kunst, dichterisches Schrifttum wirklich und nicht nur offiziell-redensartlich ein Organ des nationalen Lebens ist, wenn auch zunächst auf unkenntliche, abenteuerliche, aufsässige, träumerisch-verspielte Weise. Der deutsche Dichter entdeckt seine Sozialität.
Andere sahen die «Sozialität» ihres Schaffens und ihrer Werke nicht nur ebenso deutlich, sondern pflegten sie auch bewußt, indem sie sich zum Gedankenaustausch in Vereinigungen wie der Gruppe 1925 trafen oder indem sie kollektive Formen der Produktion entwickelten, seien es institutionalisierte Vereinigungen wie der Bund der Proletarisch-Revolutionären Schriftsteller, turnusmäßige Treffen wie die von Hans Grimm initiierten Lippoldsberger Dichtertage oder dauerhafte Informations- und Arbeitsgruppen wie die «Brechtwerkstatt» (John Fuegi), in der Künstler und Intellektuelle wie Elisabeth Hauptmann und Walter Benjamin, Caspar Neher und Margarete Steffin, Helene Weigel und Fritz Sternberg mit ihren spezifischen Fähigkeiten zum Ausbau des Brechtschen Werks beitrugen. Aber ganz gleich, ob die Werke in solch einer kommunikativen «Werkstatt» oder auf dem «Isolierschemel» (Alfred Döblin, 1929) einer Dichterklause entstanden: Der in jedem Fall gegebenen «Sozialität» der Literatur entspricht, daß sie zunächst einmal in jenem spezifischen Produktions- und Rezeptionszusammenhang zu sehen ist, den man seit Pierre Bourdieus einschlägigen Studien als «literarisches Feld» bezeichnet, dann aber auch in einem breit aufgefächerten und geschichtlich mehrfach gestuften Ereignis- und Diskursrahmen mit Diskurspraktiken und Redesystemen, deren Verhältnis zur Literatur fluide ist.
Jeder Versuch, die Literatur einer Epoche im Rahmen der zeitgenössischen Diskurse politischer, religiöser, wissenschaftlicher, weltanschaulicher und anderer Art zu betrachten, führt zunächst einmal zu einer gewaltigen Ausdehnung des Beobachtungsfeldes und Analysematerials. Thorsten Eitz und Isabelle Engelhardt haben für ihre 2014 erschienene Diskursgeschichte der Weimarer Republik neben dem Reichsgesetzblatt und den stenographischen Berichten des Reichstags «mehrere Zehntausend Artikel» aus sechs Zeitschriften und fünfzehn Tageszeitungen ausgewertet und skizzieren auf dieser Basis auf rund 950 Seiten durch Titelnennung, Stichworte und kleinere Zitate den politik-, sozial- und ideologiegeschichtlichen Diskurs der Weimarer Republik – eine große Leistung, und doch nur ein Ausschnitt, sowohl im Hinblick auf die ausgewählten Periodika (es fehlt etwa die konservativ-revolutionäre Tat) als auch im Hinblick auf die erfaßten Diskurse. Gegenüber diesen uferlosen Diskursen kann eine Literaturgeschichte sich nicht einfach blind stellen, doch hat sie auch unter der Ägide eines «erweiterten Literaturbegriffs» das Recht und die Aufgabe, ihren Blick vor allem auf die Texte zu richten, die durch bestimmte, allerdings auch epochal spezifizierte Merkmale als dezidiert literarisch ausgewiesen sind. Diese literarischen oder poetischen Merkmale – fiktionale Überformung des Gegenstands, spezifische Strukturierung des Textes, Poetisierung des Ausdrucks – sind nicht nur Instrumente der effektvollen Verschönerung, sondern auch Zeichen der relativen Autonomie literarischer Werke, die eben soziale Realitäten und politische Vorgänge nicht einfach homolog abbilden, sondern auf eine dialektische Weise, die freilich viele Distanzgrade und Spielarten kennt, reflektieren.
Die vorliegende Literaturgeschichte der Jahre 1918–1933 versucht, der gesellschaftlichen Lagerung und Funktion der Literatur durch die einleitende soziokulturelle Rahmung, durch historische Einführungen in die einzelnen Segmente und schließlich durch laufende Hinweise gerecht zu werden. Mehr als Hinweise können freilich kaum gegeben werden; eine Literaturgeschichte, die mit begrenztem Raum auskommen muß, kann die Lektüre der Spezialstudien, auf denen sie aufbaut und für die der Kollegenschaft zu danken ist, nicht ersetzen. Durch die Absicht, die Literatur in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang zu zeigen, wird selbstverständlich auch die Auswahl gesteuert. Manche Werke – wie beispielsweise Döblins Berlin Alexanderplatz (1929) oder Tollers Hoppla, wir leben! (1927) – sind nicht zu übergehen, weil sie ebendie aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhänge auf der inhaltlichen wie auf der formalen Ebene in einer besonders intensiven und zeitspezifischen Weise reflektieren. Bei anderen Werken von Rang – einige der damals vielgelesenen Romane Jakob Wassermanns könnten als Beispiele dienen – ist dies weniger der Fall. Das spricht nicht gegen diese Werke, die, sei es wegen ihres existentiellen Gehalts oder ihrer hohen Erzählkunst, sowohl von zeitgenössischen als auch von späteren Lesern geschätzt wurden, aber unter den gesellschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten, denen diese Literaturgeschichte verschrieben ist, weniger aufschlußreich sind. Daß solche Werke möglicherweise zu kurz kommen oder ganz übergangen werden müssen, ist, so bedauerlich es sein mag, angesichts der unabweisbaren Nötigung zur Auswahl nicht zu vermeiden.
Natürlich kann man alles auch ganz anders sehen und anders machen. Ein 2014 erschienener Aufsatzband mit dem Titel Literaturgeschichte: Theorien – Modelle – Praktiken bringt eindrucksvoll zu Bewußtsein, was hinsichtlich der Konzeptionalisierung einer Literaturgeschichte, der Auswahl und Verklammerung der Texte, der kultur- und mediengeschichtlichen Orchestrierung, der räumlichen (territorialen, regionalen) Einbettung, der sozial- und politikgeschichtlichen Kontextualisierung, der formgeschichtlichen Herleitung und der inhaltsanalytischen Erörterung, der ethischen Reflexion und ästhetischen Wertung zu bedenken und zu leisten ist. Gegenüber diesen theoretisch sehr berechtigten Postulaten und anregenden Modellen kann sich jede Praxis nur als reduktionistisch blamieren, sofern sie sich nicht auf sehr kleine Segmente beschränkt oder sich auf ein Abstraktionsniveau begibt, das meist mit einer zweckdienlich strengen Selektion verbunden ist und von der Fülle und Vielfalt der Texte in der Regel wenig zeigt. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze hat Christoph Fackelmann unlängst in der Einleitung zu dem Sammelband Literatur – Geschichte – Österreich scharfsichtig aufgewiesen.
Stärker als in Literaturgeschichten zu anderen Epochen werden in dieser Literaturgeschichte der Jahre 1918–33 jene eng gegenwartsbezogenen Werke berücksichtigt, die man damals als «Zeitstücke», «Zeitromane» und «Zeit-» oder «Gebrauchslyrik» bezeichnete (s.S. 194 ff.). Die allgemeine politische Aufgeregtheit drängte die Autoren zur Darstellung aktueller Vorgänge; das Politisierungspostulat der Revolutionszeit verlangte sie, und die operative Literaturvorstellung der späteren Jahre begünstigte sie. Die literarische Dignität dieser Werke ist unterschiedlich. Manche arbeiten mit einfachsten Gestaltungsmitteln und kommen über eine dürftige literarische «Maskerade» (Kurt Tucholsky) ihrer Botschaft nicht hinaus. Andere – Brechts Heimkehrer- und Revolutionsstück Trommeln in der Nacht mag als Beispiel dienen – nehmen aktuelle Gegebenheiten oder Vorgänge als «Mittel», wie Georg Kaiser 1922 in seinem kleinen Essay Ein Dichtwerk in der Zeit sagte, «um ins Menschunendliche [!] vorzudringen» und aus dem gegenwärtigen Stoff «abzuleiten das Gleichnis, das beständig gültig ist». Das wäre dann «Zeit-Dichtung» (Kaiser) in einem anderen Sinn, als es viele der eng an die Aktualität gebundenen «Zeitromane», «Zeitstücke» und «Zeitgedichte» sind. Beide Formen der ‹Zeitliteratur› gehören zu jener Epoche.
Ein Wort zur Darstellungsweise: Literaturgeschichten konzentrieren sich üblicherweise nicht auf die Erörterung der einzelnen Werke der behandelten Epoche, sondern auf die Darstellung der Zusammenhänge, die unter ihnen sowie zwischen ihnen und ihrer Zeit bestehen; die Darstellung der Werke beschränkt sich meist auf die Nennung des Titels und einiger charakterisierender Sätze. Gegen Literaturgeschichten, die biographische oder literatur-, geistes-, kultur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge betonen, wurde in den letzten Jahren immer wieder eingewandt, daß die Integration der Werke in solche Kontexte eine doppelte Verfehlung darstelle: Zum einen mißachte sie den «Eigensinn» der Werke oder vernachlässige ihn wenigstens, indem sie vorzugsweise oder gar ausschließlich registriere, was zur Reihe oder zu den thematisierten Zusammenhängen passe, andere wichtige Komponenten aber stillschweigend ausklammere. Zum andern, so wurde auch gesagt, schreibe die Integration in literarische Reihen und gesellschaftsgeschichtliche Kontexte der literarischen Entwicklung eine Systematik und Konsequenz zu, die diese in Wirklichkeit nicht gehabt habe. Mehrfach wurde deswegen in den letzten Jahren eine andere Darstellungsform gewählt: die der sozusagen monographischen Darstellung und Erörterung ausgewählter Werke in schlicht chronologischer Reihung. Eine Alternative, welche die erhobenen Vorwürfe ausräumen würde, ist diese chronikalische Form der Literaturgeschichte indessen nicht. Sobald die Artikel über die bloße Registratur des Titels und die reine Beschreibung (soweit dies überhaupt möglich ist) von Inhalt und Form hinausgehen, beginnt ebendie Integration in Reihen und Zusammenhänge, die vermieden werden sollte. So stehen die Werke plötzlich wieder im «Schnittpunkt mannigfacher Bezugssysteme», wie dann mit Erwin Panofsky in salvierender Absicht gesagt wird, oder zeigen sich «Wechselwirkungen» und «Konfigurationen historischer Tatsachen», die man dann mit Walter Benjamin in ebenfalls salvierender Absicht «Konstellationen» nennt. Nichts anderes hat Literaturgeschichtsschreibung, sofern sie nicht ganz einseitig auf einen Aspekt fixiert war, seit eh und je ansichtig zu machen versucht. Die vorliegende Literaturgeschichte nimmt aber die Kritik an der Vernachlässigung des «Eigensinns» der Werke ernst und versucht deswegen, die Eigenständigkeit der einzelnen Werke stärker zur Geltung kommen zu lassen, indem sie in den Binnenkapiteln zur chronologischen Reihung und tendenziell separaten Darstellung übergeht. Dies geht freilich auf Kosten einer breiteren Erfassung oder Nennung von Titeln, die an der einen oder anderen Stelle auch noch Erwähnung verdient hätten.
Welchen Umfang die Literatur des hier behandelten Zeitraums hatte, ist nicht einfach festzustellen. Es ist zunächst eine Erfassungsfrage: Welche Verlags- und Bibliotheksverzeichnisse bilden die Produktion in den einzelnen Sparten (Gedichte, Dramen, Romane, Erzählungen, Essays) zuverlässig ab? Es ist zudem eine Definitionsfrage: Was gehört alles in den Bereich der ‹schönen Literatur›, wie man früher sagte, also der poetisch gestalteten Literatur? Im Fall von Zeitgedichten, die nicht selten nur gereimte Leitartikel sind, und im Fall von zeitdiagnostischen Essays, auch wenn sie von namhaften Autoren stammen, kann man generell und in jedem Einzelfall lange darüber streiten (s.S. 196 ff.).
Für den Umfang der ‹schönen Literatur› der zwanziger Jahre gibt es immerhin ein Medium, das die Verhältnisse wohl auf eine qualifizierte Weise abbildet: die bis 1933 von dem promovierten Germanisten, Journalisten und Schriftsteller Ernst Heilborn herausgegebene Zeitschrift Das literarische Echo, die 1923 den Titel Die Literatur bekam, eine großformatige Zeitschrift, die übers Jahr zunächst als «Halbmonatsschrift», dann als «Monatsschrift» erschien und die belletristischen Neuerscheinungen fortlaufend bibliographisch anzeigte und teilweise kommentierte. Von 1918 bis 1930 registrierte diese Zeitschrift im jeweils letzten Teil «Der Büchermarkt» unter der Rubrik «Romane und Novellen[sammlungen]» ca. 5100 Titel; unter der Rubrik «Lyrisches und Episches» ca. 1620 Titel; unter der Rubrik «Dramatisches» 830 Titel. (Ab dem Jahrgang 33 (1930/31) gab es den «Büchermarkt» nicht mehr.) An Romanen und Erzählungen wurden von 1918 bis 1932 nicht ganz 2900 in «kurzen Anzeigen» von durchschnittlich einer halben Spalte besprochen, an versepischen Texten und lyrischen Sammlungen ungefähr 170, an Dramen etwas mehr als 60. Gleichzeitig wurden in den Spalten «Echo der Zeitungen» und «Echo der Zeitschriften» Rezensionen aus anderen Organen zitiert und solchermaßen der Blick auf die aktuelle literarische Produktion noch einmal erweitert. Davon kann auch in einer noch so umfangreichen Literaturgeschichte nur ein kleiner Teil aufgerufen werden: vorzugsweise die Werke, die schon von den Zeitgenossen als besonders bemerkenswert aus der Masse des Gedruckten hervorgehoben wurden, zunächst einmal in öffentlichen Debatten und literaturprogrammatischen Gesprächen eine Rolle spielten, dann aber auch in die literaturgeschichtliche Überlieferung einflossen und in Dokumentationen und rückblickenden Darstellungen aller Art, in Schriftstellerautobiographien und Briefwechseln, in Essays und Rezensionensammlungen bevorzugt erwähnt wurden.
Dazu gehören selbstverständlich auch professionelle Literaturgeschichten. Für den hier behandelten Zeitraum haben schon drei Zeitgenossen literaturgeschichtliche Darstellungen vorgelegt: der in Chemnitz lehrende Literaturhistoriker Albert Soergel mit Dichtung und Dichter der Zeit: eine Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte (1925, 896 Seiten); der für die Vossische Zeitung als kulturpolitischer Redakteur tätige Werner Mahrholz mit Deutsche Literatur der Gegenwart: Probleme, Ergebnisse, Gestalten (1930, 517 Seiten) und der unter anderem für die Reichsbahn arbeitende Publizist Guido K. Brand mit Werden und Wandlung: eine Geschichte der deutschen Literatur von 1880 bis heute (1933, 572 Seiten größeren Formats). Erfassungsdichte und Einordnung der Werke in verschiedene Zusammenhänge (Stilrichtungen, Gattungen, Sachgebiete usw.) sind unterschiedlich, die Zahl der angeführten und meist auch knapp erläuterten Titel ist aber eindrucksvoll. Brand, um ein Beispiel zu geben, nennt auf den dreieinhalb Druckseiten, die er dem Verfasser des Helianth-Romans, Albrecht Schaeffer (s.S. 1162 ff.), widmet, über zwanzig Titel – Romane und Erzählungen, Dramen und Gedichtsammlungen – und subsumiert sie einem bündig wirkenden Schaffensporträt. Der Informationsgehalt aller drei Werke ist anerkennenswert, auch wenn zwei der Verfasser – Mahrholz starb 1930 – auf unterschiedliche Weise dem Nationalsozialismus dienstbar wurden: Soergel wurde 1933 Mitglied der NSDAP und später des NS-Lehrerbunds. Brand emigrierte, als sein Buch gleich nach Erscheinen verboten wurde, nach Budapest, kehrte aber 1936 nach Berlin zurück und wurde später als Kriegsberichterstatter tätig.
Die Literaturgeschichten teilen das Schicksal der Literatur und der Literaten, über die sie berichten; der Schatten des Jahres 1933, von dem im nächsten Kapitel noch mehr die Rede sein muß, liegt auch über den Literaturgeschichten und der literaturgeschichtlichen Überlieferung überhaupt. Sie ist eine Geschichte frappierender politisch bedingter Umwertungen und Selektionen, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Jahr für Jahr erscheinen Untersuchungen und Dokumentationen, die einzelne Autoren belasten oder einzelne ihrer Werke diskreditieren. Die Archive sind noch nicht ausgeschöpft, die Analyse- und Interpretationsmöglichkeiten noch nicht in jedem Fall ausgereizt, die Akten noch nicht geschlossen.
ERSTER TEIL
EPOCHENPROFIL UND HISTORISCHE RAHMUNGEN
I. POLITIKGESCHICHTLICHE ASPEKTE
1. 1918–1933 als Beobachtungszeitraum
Eine Teil-Geschichte der deutschsprachigen Literatur, deren Beobachtungszeitraum durch die Jahre 1918 und 1933 begrenzt wird, folgt offenkundig dem Takt der politischen Geschichte Deutschlands: Es ist die Zeit der «Weimarer Republik», wie man seit ungefähr 1929 zu sagen begann, die Zeit, in der das «Deutsche Reich» – so der offizielle Name – erstmals in der verfassungsrechtlichen Form einer parlamentarischen Demokratie existierte, bevor die Nationalsozialisten 1933 die republikanischen Institutionen und Prozeduren außer Kraft setzten. Für Deutschland bedeuten die dominierenden Ereignisse der Jahre 1918 (Kriegsniederlage sowie Revolution) und 1933 (Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft) tiefgreifende Zäsuren mit gravierenden Folgen gerade auch im kulturellen und literarischen Bereich des Lebens. Für Österreich müßte die Jahreszahl 1933 durch 1934, das Jahr der Ablösung der Republik durch den autoritären «Ständestaat», oder 1938, das Jahr des «Anschlusses» Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland, ersetzt werden. Dabei war die Zäsur von 1934 in politischer und kultureller Hinsicht wohl weniger einschneidend als die von 1938, insofern der «Ständestaat» trotz seiner diktatorischen Herrschaftspraxis mehr politischen und kulturellen Spielraum ließ als der NS-Staat und bis zum «Anschluß» ja auch eine Zufluchtsstätte für NS-Verfolgte und konservative Gegner des Nationalsozialismus war. Für die Schweiz und die deutschschweizerische Literatur haben die Jahreszahlen 1918 und 1933 längst nicht dieselbe Bedeutung. Zwar blieben der Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise sowie der Aufstieg des Faschismus in Italien und des Nationalsozialismus in Deutschland auch für die Schweiz nicht folgenlos; aber die Rahmenbedingungen des literarischen Schaffens änderten sich dort weder 1918 noch 1933 noch 1938 auch nur annäherungsweise in dem Maße, in dem dies in Deutschland und Österreich geschah.
Trotz dieser Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz mag es erlaubt sein, mit den Jahreszahlen 1918 und 1933 einen spezifischen Abschnitt in der Entwicklung der deutschsprachigen Literatur zu umgrenzen. 1918 bedeutet zunächst einmal: Literatur, die nun entstand, war Nachkriegsliteratur. Sie wurde unter dem Eindruck eines Kriegs von beispielloser Destruktionswirkung geschrieben und rezipiert. Erwin Piscator, einer der maßgeblichen Theaterintendanten in der Weimarer Republik, hat diesen Umstand zu Beginn seines autobiographischen Buches Das politische Theater (1929) betont, indem er den Krieg (mit der Jahreszahl 1914, aber den Material- und Opferzahlen von 1918) an den Beginn einer neuen Zeitrechnung setzte:
Meine Zeitrechnung beginnt am 4. August 1914. Von da ab stieg das Barometer: 13 Millionen Tote 11 Millionen Krüppel 50 Millionen Soldaten, die marschierten 6 Milliarden Geschosse 50 Milliarden Kubikmeter Gas
Literatur mußte deswegen nicht unbedingt vom Krieg sprechen; aber sie mußte sich allemal die Frage gefallen lassen, wie sie sich zum Krieg verhielt und wie sie vor ihm bestehen konnte.
1918 bedeutet ferner, daß Literatur in Deutschland und Österreich erstmals unter republikanischen Bedingungen, unter weitgehender verfassungsmäßig garantierter Freiheit von Zensur und unter demokratischem Vorzeichen geschrieben werden konnte. Anders als in der Schweiz war der republikanisch-demokratische Horizont in Deutschland und Österreich aber nicht selbstverständlich, sondern höchst umstritten, und anders als in der Schweiz wurde deswegen die neu entstehende Literatur in Deutschland und Österreich in den Kampf für und wider die Republik und die Demokratie hineingezogen, wurde Medium dieses Kampfes oder «Waffe» in ihm, wie man damals gerne sagte.
1918 bedeutet nicht zuletzt, daß der deutsche Sprachraum noch stärker nationalstaatlich aufgesplittert wurde. Deutschland und Österreich mußten mit Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy, Westpreußen, Oberschlesien beziehungsweise Böhmen und Mähren sowie Südtirol beträchtliche Gebiete abtreten, in denen vorerst noch deutsch gesprochen und deutsche Literatur nicht nur rezipiert, sondern auch produziert wurde. Neben die drei nationalen deutschsprachigen Literaturen traten nun vermehrt sogenannte «auslandsdeutsche» Literaturen, die in den zwanziger Jahren von entsprechenden Organisationen protegiert wurden (s.S. 271 ff.). Gleichwohl erhielt sich eine grenzüberschreitende deutsche Literatur, deren unterschiedliche Herkunft sich nicht in stark distinktiven Merkmalen äußerte und die Rezeption in allen Teilen des deutschen Sprachraums nicht wesentlich behinderte. Der Hauptgrund dafür ist wohl in dem Umstand zu sehen, daß Deutschland das mit Abstand wichtigste Verlags- und Absatzgebiet war. Dies wirkte sich, wie am Beispiel von Franz Theodor Csokors Rheinlanddrama Besetztes Gebiet (1930) zu sehen ist, bis auf die Stoffwahl aus; vermutlich griff der Wiener Autor nicht (nur) aus historisch-politischem Interesse nach diesem dezidiert deutschen Stoff, sondern (auch) weil die Krise der österreichischen Bühnen und Bühnenverlage Theaterautoren auf den deutschen Markt verwies. Es zeigt sich auch in dem Sog, den Deutschland – und zumal Berlin – auf schweizerische und österreichische Autoren ausübte; sowohl der Schweizer Jakob Schaffner als auch der Österreicher Robert Musil, um nur zwei prominente Beispiele zu nennen, lebten um die Mitte der zwanziger Jahre in Berlin und profitierten offensichtlich von der anregenden Atmosphäre der deutschen Metropole (s.S. 134 ff.).
Mit dem Jahr 1933 veränderten sich die Bedingungen des literarischen Schaffens in Deutschland auf eine gravierende Weise, deren Beschreibung jedoch nicht mehr Aufgabe einer Literaturgeschichte der Jahre zwischen dem Kriegsende und dem Ende der Weimarer Republik ist. Wohl aber ist in einer Literaturgeschichte dieser Jahre zu bedenken, daß sich mit dem Jahr 1933 auch die Interpretationsweisen und Bewertungskriterien für die Literatur der vorausgehenden Jahre änderten. Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Machtübernahme und der sofort einsetzenden Gewalttaten las man manche Texte anders als zuvor, und dies potenzierte sich durch die folgende Schreckensherrschaft, den Zweiten Weltkrieg und den Judenmord auf eine Weise, die für die Literaturgeschichtsschreibung von unübergehbarer Bedeutung, aber zugleich mit außerordentlichen Schwierigkeiten behaftet ist. Der 30. Januar 1933, der 9. November 1938, der 1. September 1939 und der 20. Januar 1942 wirken wie Schallverstärker, die bestimmte Töne der Literatur des Beobachtungszeitraums 1918–1933 plötzlich heraushoben und – je mehr die nationalsozialistische Schreckensherrschaft voranschritt und den Zeitgenossen bekannt wurde – als unheilvoll und inakzeptabel erscheinen ließen.
Das gilt selbstverständlich für alle Literatur mit antisemitischen Anklängen, auch wenn diese, wie man in manchen Fällen unterstellen darf, nicht auf Exklusion oder Eliminierung aus war, sondern nur, was schlimm genug ist, einer eingebürgerten und literarisch legitim scheinenden Typisierung diente. Es gilt für manche Schriften konservativer und nationalistischer Autoren wie Ernst Jünger und Ernst Niekisch, die zwar mit dem Faschismus oder Kollektivismus, aber eben nicht mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, sondern schon vor 1933 erkennbar zu Hitlers Gegnern zählten. Es gilt ebenso für Werke der sogenannten «völkischen» und antimodernistischen Heimatliteratur wie Karl Heinrich Waggerls Romane Brot (1930) und Schweres Blut (1931; s.S. 1216 f.), die dem Verfasser die Anerkennung der Nationalsozialisten einbrachten, aber keineswegs als nationalsozialistische Literatur bezeichnet werden können. Es gilt für ein solch exzeptionelles Werk wie Erwin Guido Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie (1917–1926; s.S. 1211 ff.), die ebenfalls nicht nationalsozialistisch genannt werden kann, aber eben doch auch die Basis für Kolbenheyers Prominenz in der NS-Zeit war, allein schon deswegen bei vielen Zeitgenossen in Mißkredit geriet und nach 1945 durch konsequentes Beschweigen seitens der Literaturwissenschaft und Literaturkritik mehr und mehr aus dem Korpus nicht nur der schätzenswerten, sondern der akzeptablen Literatur überhaupt verdrängt wurde. Das heißt: Eine nicht geringe Zahl von Werken würde, wenn die Machtübernahme Hitlers 1933 nicht ermöglicht worden wäre und die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hätte, heute anders gelesen und anders beurteilt, als es – verständlicherweise – der Fall ist. Solche Werke würden dann nicht als Vorboten oder Wegbereiter des Nationalsozialismus gelesen, sondern wie diejenige Literatur, die im Umkreis des Bundes Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller (BPRS) entstanden ist, als Manifestationen einer der vielen mehr oder minder bedeutenden ideologischen und literarischen Strömungen der Weimarer Zeit.
Nun haben kontrafaktische Überlegungen immer den Nachteil, daß sie vorab durch die historische Faktizität widerlegt sind. Dennoch sind sie nicht unsinnig oder in ihrem diagnostischen Wert geringzuachten. Das wären sie nur, wenn die Geschichte eine eherne, alle Kontingenzen ausschließende Folgerichtigkeit oder gar Zwangsläufigkeit hätte – und die verbrecherische NS-Herrschaft also die unvermeidbar zwingende Konsequenz aus der vorherigen deutschen Geschichte und zumal der Weimarer Zeit gewesen wäre. Dies wird heute kaum jemand noch im Ernst behaupten. Zu Hitlers Machtübernahme oder zur Machtübergabe an Hitler gab es bis zuletzt Alternativen, die gangbar gewesen wären. Daß das Anwachsen der NSDAP von einer Splitterpartei, die bei der Reichstagswahl von 1928 nur 2,8 Prozent der Stimmen erhalten hatte, zu einer unumgänglich scheinenden politischen Größe möglich wurde, war die Folge fataler wirtschaftlicher Umstände und einer daraus resultierenden Unzufriedenheit mit der Republik, zu der allerdings auch antidemokratische und autoritäre Neigungen rechter und linker Provenienz beitrugen (s.S. 938 ff.). Daß die Macht dann vollends in Hitlers Hände geriet, war das Ergebnis entsprechender politischer Bestrebungen, aber auch leichtfertiger Fehlentscheidungen, die nicht zwingend so hätten getroffen werden müssen.
Die Darstellung und Bewertung der Literatur der Weimarer Zeit kann von der anschließenden NS-Herrschaft und den furchtbaren Verbrechen, die in der NS-Zeit von Deutschen begangen wurden, nicht absehen. Viele Autoren und Werke werden dadurch in mehr oder minder großem Maß belastet oder diskreditiert, und das ist in die literaturhistorische Reflexion jederzeit miteinzubeziehen. Die historische Gerechtigkeit gebietet es aber auch zu fragen, ob und in welchem Maß den betreffenden Werken die späteren NS-Greuel, die sie in der Retrospektive belasten und verdunkeln, tatsächlich eingeschrieben waren, sei es, indem sie bewußt Intoleranz, Rassismus, Inhumanität und Gewalttätigkeit befürworteten, sei es, indem sie unabsichtlich – etwa durch die bloße Darstellung von historischer Gewalt und autoritären Verhältnissen oder durch die registrierend gemeinte Reproduktion rassistischer Stereotype – NS-affin wirkten. Man gerät beim Versuch, solche Affinitäten dingfest zu machen, allerdings immer wieder in Verlegenheiten. Manches, was aus heutiger Sicht eindeutig und zu Recht als rassistisch und speziell antisemitisch identifiziert und verurteilt wird, verliert, wenn man nach Intentionen forscht und sowohl die Umstände als auch die Nuancen der Darstellung berücksichtigt, an Eindeutigkeit. Die jüdischen Gestalten in Romanen wie Robert Müllers Flibustier (1922; s.S. 333 ff.), Walter Bloems Brüderlichkeit (1922; s.S. 373 ff.), Ernst von Salomons Die Stadt (1932; s.S. 973 ff.) und selbst Felix Riemkastens Der Götze (1932; s.S. 988 ff.) sind – anders als etwa die Judenkarikaturen in Hans Heycks Zukunftsroman Deutschland ohne Deutsche (1930; s.S. 582 f.) – trotz ihrer Klischeehaftigkeit zu komplex und zu sehr von der Problemlage jener Zeit geprägt, als daß man sie nur als Ausdruck von Antisemitismus betrachten und deswegen diese Romane unbeachtet lassen sollte; in ihnen spiegelt sich nicht nur der Antisemitismus der Zeit wider, sondern auch der – freilich – prekäre Versuch dieser Autoren, in ein reflektiertes Verhältnis zum Judentum zu kommen.
Ein für die Beurteilung besonders intrikater Fall ist Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie, die vor der Kulisse des beginnenden 16. Jahrhunderts kriegerische Gewalt auf exzessive Weise vorführt, um sie als Fehlweg der Geschichte zu demaskieren. Im letzten Band von 1926, der unter dem Titel Das dritte Reich des Paracelsus steht, findet sich eine mehrseitige, überaus beklemmende Passage über die gewaltsame Vertreibung der Regensburger Juden im Jahr 1519: die Schilderung eines Regensburger Bürgers, der sich am Pogrom beteiligt und eines der demolierten Judenhäuser erworben hat, seitdem aber von der Erinnerung an die Ausschreitungen verfolgt wird, «sich vor seinen eigenen Wänden fürchtet» und nicht aufhören kann, mit einer «heftig und heiser» klingenden Stimme von der Zerstörung der Häuser, der «Judenschule» und der Synagoge zu erzählen, von «blitzenden Beilen» und den «zersplitternden» Kultgegenständen. Es ist eine Passage, die nicht nur zeigt, was den Juden angetan wurde, sondern auch, was sich die Täter selbst antaten; sie leben – bei Kolbenheyer – für immer im pathologisierenden Bewußtsein ihrer Untat. Man hätte diese außerordentlich eindrucksvolle Passage als Warnung vor dem Irrweg der Gewalt und speziell der Judenverfolgung lesen können, ja lesen müssen, obwohl – oder gerade weil – sie aus der Sicht eines Menschen geschrieben ist, der sich als Täter durch die antisemitischen Vorurteile seiner Zeit gerechtfertigt fühlt und diese immerfort beschwört.
Mit all dem soll gesagt sein, daß das Epochenjahr 1933 den Blick auf die Literatur der vorangegangenen vierzehn Jahre nachhaltig veränderte. Die Wahrnehmung wurde und wird seitdem anders fokussiert. Der Interpretations- und Bewertungshorizont verschob sich gesamthaft und mit Konsequenzen auf allen Ebenen. Dinge, die man zuvor überlesen hätte, fielen nun als ominös ins Auge und ließen ein Werk als präfaschistisch, ein anderes als antifaschistisch erscheinen. Was man vor 1933 etwa als legitimen Ausdruck einer antimodernistischen Haltung gelten ließ, konnte nun als Einstimmung auf die reaktionären Ziele des Nationalsozialismus verstanden werden. Wörter wie «Werkgemeinschaft» oder «Volksgemeinschaft», die sich nicht nur in Werken rechter, sondern auch linker Provenienz finden, wurden nach 1945 zunehmend als Indizien einer faschistischen und rassistischen Gesinnung betrachtet. Mitunter wurden Autoren, die zuvor als Geistesverwandte betrachtet werden konnten, voneinander getrennt. Als Alfred Döblin 1938 einen Überblick über die deutsche Literatur entwarf, rechnete er zur «geistesrevolutionären Strömung» nicht nur Bertolt Brecht und sich selbst, sondern auch Ernst Jünger, Ernst von Salomon und Arnolt Bronnen; in Döblins novellierten Aufstellungen aus den Jahren nach 1945 fehlen die zuletzt genannten Namen indessen. Es scheint, als hätten die nationalsozialistische Machtübernahme und ihre Folgen viele Werke und Autoren in ihrem «eigentlichen» Charakter erkennbar gemacht, doch könnte es auch sein, daß die NS-Verbrechen den Blick auf deren eigentlichen Charakter verstellt haben. So bleibt, wenn man der Literatur der Jahre 1918–1933 gerecht werden will, die Aufgabe, sie in einem engeren und weiteren, durch das Jahr 1933 gestuften Horizont zu sehen und mit doppeltem Blick zu lesen: in Kenntnis der Geschichte seit 1933, aber auch im Bewußtsein, daß die Unheilsgeschichte jener Jahre nicht primär der Literatur anzulasten ist und daß manche der später inkriminierten Werke heute vermutlich anders gelesen würden, wenn Hitlers Machtübernahme verhindert worden wäre.
2. Geschichtliche Rahmungen, auch im Spiegel der Literatur
Fragt man nach weiteren geschichtlichen Rahmungen und Zusammenhängen, so bieten sich – aus historisch-politischer Warte – vor allem drei Epochenkonzepte an:
Einen zeitlich weit ausgreifenden Rahmen bildet die «Weltkriegszeit», die durch die Jahre 1914 und 1945 begrenzt ist und häufig als ein «zweiter dreißigjähriger Krieg» bezeichnet wurde (Charles de Gaulle, 1941; Sigmund Neumann, 1942; Winston Churchill, 1944; Raymond Aron, 1950; Arno J. Mayer, 1988; Hans-Ulrich Wehler, 2003). Diese Benennung bezieht sich zum einen auf den Umstand, daß der Zweite Weltkrieg auch aus den Verhältnissen und Problemen resultierte, die der Erste Weltkrieg hinterlassen hatte, zum andern auf den Umstand, daß die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen keineswegs friedvoll und entspannt war, sondern von Konflikten aller Art in Atem gehalten wurde: anfangs von heftigen Grenzkriegen, militärischen Interventionen, Besetzungen, ethnischen «Säuberungen», Pogromen und bürgerkriegsähnlichen Kämpfen, später durch ökonomische und diplomatische Konflikte mit militärischen Drohgebärden. Die Formel «zweiter dreißigjähriger Krieg» betont nicht nur ein größeres Kontinuum, das die Zeit der Weimarer Republik umschließt, sondern benennt mit «Krieg» auch dessen grundierendes Moment, den massiv bellizistischen Charakter dieser ganzen Zeit.
Ein zeitlich etwas engerer und qualitativ anders scheinender Rahmen wird mit der Bezeichnung «Zwischenkriegszeit» oder «Interbellum» angegeben, die in der Historiographie der letzten Jahrzehnte häufig verwendet wird. Sie sieht in den Jahren von 1918/19 bis 1939 ein Kontinuum, das – für den größten Teil Europas – durch die Abwesenheit von Krieg bestimmt war. Dieser Umstand ist nicht geringzuschätzen und berechtigt dazu, diese Zeit als Einheit zu fassen: Es waren zwanzig Jahre, in denen die Menschen im deutschen Sprachraum keinem regulären Krieg ausgesetzt waren, nicht im Belagerungszustand lebten und nicht täglich tausendfaches Sterben von Soldaten und Zivilisten verkraften mußten, sondern trotz aller politischen Umschwünge, sozialer Krisen und lokaler Konfrontationen Frieden hatten. Die Einheit dieses Interbellums wurde aber in Deutschland 1933 durch den Beginn der NS-Herrschaft auf gravierende Weise unterbrochen, in Österreich 1934 durch die Etablierung des «Ständestaats» auf eine zwar weniger einschneidende, aber doch auch spürbare Weise. Der Frieden blieb für weitere fünf oder sechs Jahre bestehen, aber in Deutschland lebte man ab Januar 1933 in Verhältnissen, die nicht nur undemokratisch, sondern zutiefst unrechtlich und von der permanenten Ausübung verbrecherischer Staatsgewalt geprägt waren. Zudem verwandelte Hitler die «Nachkriegszeit» durch seine revanchistische Rhetorik und seine alsbald eingeleitete Aufrüstungs- und Konfrontationspolitik in eine schon für Zeitgenossen klar erkennbare «Vorkriegszeit».
Daß sich die Rede von einer «Zwischenkriegszeit» und nicht etwa von einer unzweifelhaft positiv konnotierten «zwanzigjährigen Friedenszeit» eingebürgert hat, ist im Hinblick auf die erfahrungsgeschichtliche Qualität dieser Jahre – ihr Erscheinungsbild für die Zeitgenossen – allerdings bemerkenswert: Sie stand zunächst im nachlaufenden Schatten des Ersten Weltkriegs, dann im vorlaufenden Schatten des Zweiten Weltkriegs. Ihr Frieden schien schon manchen Zeitgenossen nur Abwesenheit von offenem Krieg zu sein, ja nicht einmal das, sondern ein Krieg anderer Art, ein «stummer» Krieg, wie es zu Beginn von Martin Raschkes Roman Fieber der Zeit (1930) heißt, oder ein «latenter» Krieg, wie Erich Mühsam im Juli 1927 in seiner Zeitschrift Fanal schrieb:
Am 11. November 1918 ging, mit dem Abschluß des Waffenstillstands im Walde von Compiègne, der akute Krieg in den latenten über. Der latente Krieg ist seitdem […] der Dauerzustand in der Beziehung der Staaten zueinander geblieben. Wann der latente Krieg wieder in den akuten umschlagen wird, hängt von Umständen ab, die sich nicht allein aus ökonomischen Gesetzen und finanziellen Interessen, sondern zum guten Teil auch aus der Widersinnigkeit der politischen Weltorganisation und der Eitelkeit und Dummheit ihrer diplomatischen und militärischen Sachwalter ergeben.
Vor allem viele Deutsche lebten in dem Gefühl, der Krieg sei nicht beendet, sondern nur vorübergehend ausgesetzt. Zwar hatte Deutschland unter dem Druck der Siegernationen fast gänzlich abrüsten müssen, aber zu einer eingreifenden «kulturellen Demobilisierung», welche die Feindbilder und die kriegerische Gesinnung der Kriegsjahre aufgelöst hätte, kam es, wie John Horne und Nicolas Beaupré verdeutlicht haben, indessen nicht. Der Hauptgrund für das Gefühl, in einer «Zwischenkriegszeit» zu leben, lag in der Unzufriedenheit der Deutschen mit dem Friedensvertrag von Versailles. Wenige Tage nach Bekanntwerden der Friedensbedingungen sagte der Präsident der Weimarer Nationalversammlung, der Zentrumsabgeordnete Konstantin Fehrenbach, bei einer Kundgebung in der Berliner Universität, der Vertrag bedeute «eine Verewigung des Krieges». Der Fortgang der Geschichte – Rheinlandbesetzung, Brückenkopfbildung, Kämpfe um Oberschlesien, Ruhrbesetzung – schien ihm recht zu geben und die Schuld den Franzosen zuzuweisen. Angesichts der unnachgiebigen Haltung der französischen Regierung in den Reparationsfragen sprach der Berliner Theologe, Kulturphilosoph und Staatssekretär Ernst Troeltsch unter dem Datum des 26. März 1921 in einem seiner Spektatorbriefe von einem französischen «Versuch der Wiedereröffnung des Krieges». Das waren zweifellos Übertreibungen, aber sie entsprachen dem, was viele Deutsche empfanden, und so ist es kaum verwunderlich, daß es nicht zu einer eingreifenden kulturellen Demobilisierung kam, sondern, wie Frank Reichherzer und Rüdiger Bergien gezeigt haben, zu einer neuen und von fast allen politischen Lagern bejahten «Bellifizierung» der deutschen Gesellschaft und zu einer kulturellen «Remobilisierung».
Dem Gefühl vieler Zeitgenossen und speziell auch vieler Autoren, in einem «latenten» Kriegszustand zu leben, und der Erfahrung, daß dieser Zustand leicht in einen mehr oder minder «akuten» Krieg mit einem ausländischen Feind («Ruhrkampf» 1923) oder in eine Art von Bürgerkrieg («Ruhrkrieg» und mitteldeutscher Aufstand 1920) umschlagen konnte, entspricht die Fülle und Intensität der Darstellungen von kriegsaffiner Gewalt in Zeitromanen der Weimarer Republik, also nicht in den Romanen über den Krieg, sondern in den Romanen über die Revolutions- und Aufstandszeit bis zum Frühsommer 1921 (s.S. 240 ff.) sowie die Besetzungs- und Separatistenzeit an Rhein und Ruhr (s.S. 446 ff.). In Romanen wie Rudolf Herzogs Kameraden (1922) über die Revolutionszeit, Arnolt Bronnens O. S. (1929) über die Kämpfe um Oberschlesien und Otto Gotsches Sturmtage im März