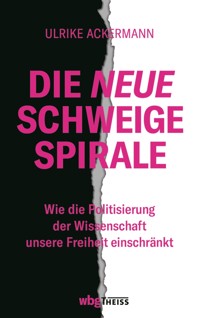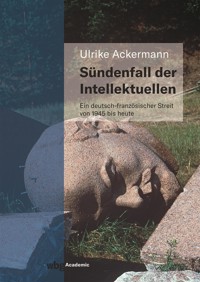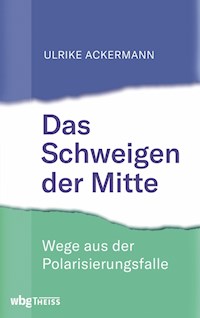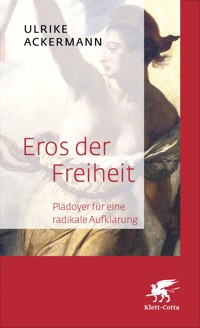
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die individuelle Freiheit ist die größte Errungenschaft der Moderne. Mehr denn je ist eine Neubestimmung des Verhältnisses von politischer und individueller Freiheit notwendig. Dieser Essay handelt von den Fallstricken der Freiheit ebenso wie von ihren Potentialen, von ihrem Dilemma, das uns spätestens seit der Aufklärung begleitet: nämlich der Sehnsucht nach Freiheit, die ständig mit der Angst vor ihr ringt. Mit der deutschen und der europäischen Wiedervereinigung ist nicht nur der real existierende Sozialismus, sondern auch der prosperierende Wohlfahrtsstaat in Westeuropa an seine Grenzen gelangt. Gerade die historische Zäsur der Wiedervereinigung hätte die Chance des Aufbruchs in die Freiheit und einer Modernisierung des Sozialstaats geboten. Stattdessen überwiegt bis heute die Angst vor Veränderung, Innovation und Flexibilisierung. Trifft es zu, dass in Deutschland die Liebe zur Freiheit und der Bürgersinn nie sehr ausgeprägt waren? Lässt sich die Freiheit nur über Sozial- und Wohlfahrtsstaat definieren? Kann es überhaupt eine gesellschaftliche Ordnung ohne Utopien und Erlösungsversprechen geben? Diesen und vielen anderen Fragen geht Ulrike Ackermann auf den Grund. Ohne die dunkle Seite ist die Freiheit für die Autorin jedoch unvollständig, also muss sie integriert werden - nämlich auch als Quelle von Fantasie und Kreativität. Erst damit ist die Voraussetzung geschaffen, die Freiheit lieben zu können und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie zerbrechlich sie ist. Eindrucksvoll verteidigt die Autorin die individuelle Freiheit als Herzstück der westlichen Zivilisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ulrike Ackermann
Eros der Freiheit
Plädoyer für eine radikale Aufklärung
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2008 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Klett-Cotta-Design
Titelbild: Eugène Delacroix – Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple. Public domain, via Wikimedia Commons
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
E-Book: ISBN 978-3-608-11717-2
Dieses E-Book basiert auf der 1. Auflage der Printausgabe.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Prolog
»Denn was ist Freiheit?
Die Möglichkeit zu leben, wie du willst.«
Cicero
Warum ist die Freiheit in unserem Land so unbeliebt und liberales Denken so schwach verankert? Der Freiheitsmüdigkeit der Bürger entspricht heute ein Paternalismus des Staates, der Politik und Recht zunehmend moralisiert. Er schwingt sich auf als Tugendwächter und maßt sich Vorschriften darüber an, wie das gute, richtige und gesunde Leben auszusehen hat. Im Gegenzug bedient er des Bürgers Sehnsucht, von der Wiege bis zur Bahre versorgt zu werden. Doch trotz der Diktaturerfahrungen des letzten Jahrhunderts wird die Kritik an Kapitalismus, Individualismus und der sogenannten Dekadenz des Westens immer lauter – nicht nur von Seiten des politischen Islam. Westliche Selbstzweifel nähren immer häufiger die Frage: Taugt unsere Zivilisationsgeschichte, die uns in die säkulare Moderne geführt hat, tatsächlich zum Erfolgsmodell? Oder hat sie uns seit der Aufklärung vor allem Schrecken und Katastrophen beschert, wie uns linke und rechte Kulturkritiker glauben machen wollen?
Die ideologischen Kämpfe, die die bürgerliche Gesellschaft seit ihrer Entstehung begleiten, die Kollision unterschiedlicher Werte und Glücksversprechen und das Ringen des Individuums mit seinen unerfüllten Wünschen und den schnöden Anforderungen, die die Realität an es stellt, hat Thomas Mann 1924 in seinem Zauberberg auf die Spitze getrieben. Die Protagonisten seines Romans befinden sich mitten im Drama der Freiheit. Die Dispute zwischen Naphta und Settembrini, den beiden Mentoren des jungen Hans Castorp in dem Lungensanatorium in Davos, kreisen um die zentralen Werte und Errungenschaften der westlichen Zivilisation. Der Literat Lodovico Settembrini, Humanist, Freimaurer und »individualistisch gesinnter Demokrat«, bejaht, ehrt und liebt »den Körper, die Schönheit, die Freiheit, die Heiterkeit und den Genuss«. Er versteht sich als Vorkämpfer der »Interessen des Lebens«. Zwei Prinzipien sieht er um die Welt kämpfen: »die Macht und das Recht, die Tyrannei und die Freiheit, der Aberglaube und das Wissen, das Prinzip des Beharrens und dasjenige der gärenden Bewegung, des Fortschritts. Man könnte das eine das asiatische Prinzip, das andere aber das europäische nennen, denn Europa war das Land der Rebellion, der Kritik und der umgestaltenden Tätigkeit, während der östliche Teil die Unbeweglichkeit, die untätige Ruhe verkörperte.« Ganz ohne Zweifel hat für ihn die »heilige Allianz der bürgerlichen Demokratie gesiegt«: Vernunft, Wissenschaft und Recht. »Die Errungenschaften von Renaissance und Aufklärung heißen Persönlichkeit, Menschenrecht und Freiheit«, hält er seinem Kontrahenten Naphta entgegen.
Der asketische Jesuit, ein zum Katholizismus konvertierter galizischer Jude, ist nicht weniger rhetorisch begabt. Er erteilt dem Liberalismus, Individualismus und der humanistischen Bürgerlichkeit eine radikale Absage. Statt dessen will er den »anfänglichen paradiesisch justizlosen und gottesunmittelbaren Zustand« der »Staat- und Gewaltlosigkeit, worin es weder Herrschaft noch Dienst gab, nicht Gesetz noch Strafe, kein Unrecht, keine fleischliche Verbindung, keine Klassenunterschiede, keine Arbeit, kein Eigentum, sondern Gleichheit, Brüderlichkeit, sittliche Vollkommenheit« wiederherstellen. Die Väter der Kirche seien »human und antihändlerisch genug gewesen, wirtschaftliche Tätigkeit überhaupt eine Gefahr für das Seelenheil, das heißt: für die Menschlichkeit zu nennen. Sie haben das Geld und die Geldgeschäfte gehaßt und den kapitalistischen Reichtum den Brennstoff des höllischen Feuers genannt«. Nach jahrhundertelanger Verschüttung hätten diese Grundsätze zum Glück Auferstehung in der modernen Bewegung des Kommunismus gefunden: Gegen die »bürgerlich-kapitalistische Verrottung« kann für Naphta nur die Diktatur des Proletariats die angemessene politisch-wirtschaftliche Heilsforderung sein. Aufgabe der Arbeiterklasse »ist der Schrecken zum Heile der Welt und zur Gewinnung des Erlösungssziels, der staats- und klassenlosen Gotteskindschaft«. Das Prinzip der Freiheit in Gestalt der Demokratie und des Kapitalismus ist für Naphta ein überlebter Anachronismus.
Beide Positionen, Naphtas und Settembrinis, ringen in mehr oder weniger ausgeprägter Fasson bis heute miteinander. Und die Sehnsucht nach dem Paradies, das der Mensch nach seinem Sündenfall dem biblischen Schöpfungsmythos zufolge verloren hat, weil er die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis gekostet hatte, ist lebendig wie eh und je.
Angesichts der Renaissance des Religiösen und der wachsenden Zweifel an den Errungenschaften der westlichen Moderne, die sich in einem prekären Kulturrelativismus spiegeln, ist es höchste Zeit, sich unserer Freiheitstraditionen neu zu vergewissern, nämlich uns selbst darüber aufzuklären, was Freiheit bedeutet und was sie uns wert ist. Im Kern ist das der kostbare Schatz der individuellen Freiheit, wie sie über Jahrhunderte in unserem westlichen Zivilisationsprozeß gewachsen ist und immer wieder im Kampf lag mit der vorgeblich politischen Freiheit, die bis heute geneigt ist, gegenüber dem Individuum die Vormundschaft zu übernehmen.
Dieser Essay handelt von den Fallstricken der Freiheit ebenso wie von ihren Potentialen, von ihrem Dilemma, das uns spätestens seit der Aufklärung begleitet: nämlich der Sehnsucht nach Freiheit, die ständig mit der Angst vor ihr ringt. Beide sind angetrieben vom Eros, jenen Lebenstrieben, die die Vernunft nicht bändigen kann, die nicht Ruhe geben und uns zugleich die Kraft verleihen, die Freiheit zum Guten wie zum Bösen zu nutzen. Das ist ihr Doppelgesicht. Ohne die Hereinnahme dieser abgründig irrationalen Seite werden wir uns die Freiheit kaum aneignen, sie gar lieben können. Es ist ein lebendiger Prozeß mit offenem Ausgang.
Gottvater Staat
Es ist schon kurios, je weiter das Jahr 1989 und der gloriose Sieg der Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft über den Kommunismus in die Ferne rückt, desto beliebter und hoffähiger wird der Sozialismus, desto mehr verkümmert die Liebe zur Freiheit hierzulande. Alarmierend sind Umfrageergebnisse, nach denen die Zahl jener, die die Idee des Sozialismus gut finden, wenngleich sie schlecht ausgeführt wurde, seit Jahren kontinuierlich steigt. 45 Prozent der Westdeutschen sind dieser Meinung und immer noch 57 Prozent der Ostdeutschen. Schon kurz nach der Wiedervereinigung setzte bei den Deutschen eine Entwicklung ein, in der kontinuierlich die Wertschätzung der errungenen Freiheit, im Kern die individuelle Freiheit, zugunsten sozialer Sicherheit und des Diktums sozialer Gerechtigkeit abnahm. Das belegt auch eine große Studie von Allensbach 2003/2004 über die Verankerung des Freiheitsbewußtseins in der deutschen Bevölkerung. Kurze Zeit nach dem Fall der Mauer verschwand das Freiheitsthema aus den Medien und sozialwissenschaftlichen Publikationen. Die Berichterstattung konzentrierte sich fortan auf die finanziellen Folgen der Wiedervereinigung. Zwar wird die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit im abstrakten Sinne von der Bevölkerung hoch geschätzt, doch verschiebt sich diese Einstellung seit den 90er Jahre zugunsten von Gleichheit und Sicherheit. Je konkreter es um die persönliche Lebenseinstellung und Alltagspraxis der Bürger geht, desto größer ist deren Neigung, sich im Zweifelsfalle gegen die Freiheit zu entscheiden. Auch dem Bürger zum Nachteil geratende staatliche Bürokratie und Überregulierung werden zugunsten des Gefühls sozialer Sicherheit billigend in Kauf genommen, ein bürokratisches Staatswesen alles in allem gar als das gerechtere und menschlichere angesehen. »Kürzlich sagte uns jemand, was soll das für eine Freiheit sein, in der Millionen arbeitslos sind, immer mehr Leute von Sozialhilfe leben müssen und die Großindustrie Rekordgewinne macht. Auf so eine Freiheit kann ich verzichten. Würden Sie das auch sagen, empfinden Sie das auch so oder würden Sie das nicht sagen?« fragten 2007 die Forscher von Allensbach. 62 Prozent der Befragten sahen das auch so, fünf Jahre zuvor waren dies noch 53 Prozent. Das Herz der Republik schlägt inzwischen wieder links. Der Einzug der Linkspartei in Bundestag und Länderparlamente ist nur die Spitze des Eisbergs. Das antikapitalistische Ressentiment reicht bis in die bürgerliche Mitte hinein. Die Bürger begehren offensichtlich eine Demokratie ohne Kapitalismus. Die Rettung soll der Staat bringen, der zunehmend für alle Lebensrisiken haftbar gemacht wird, und religiöse oder semi-religiöse Gemeinschaften, die egalitäre Sehnsüchte bedienen. Und unsere Großkoalitionäre bedienen munter des Volkes Sehnsüchte mit Blick auf die nächste Wahl. Denn 72 Prozent der Befragten einer Umfrage des Emnid-Instituts sind der Meinung, die derzeitige Regierung tue zu wenig für die soziale Gerechtigkeit im Lande. Die Debatten über Mindestlöhne, Managergehälter und Rauchverbot zeigen, daß eine Reformpolitik längst zugunsten des traditionsreichen Etatismus aufgegeben wurde. Auch wenn Mindestlöhne keineswegs neue Arbeitsplätze schaffen, sondern eher vernichten. Doch diese Politik der konservativen Besitzstandswahrung zugunsten der Arbeitsplatzbesitzer wird keineswegs nur von gewerkschaftlicher Seite propagiert, sondern hat längst ihre Advokaten im bürgerlichen Lager gefunden. Wenn die Schließung einer deutschen Niederlassung des finnischen Handyherstellers Nokia parteiübergreifend eine derartige Wut auslöst, fragt man sich, in welchem Teil der globalisierten Welt wir leben? Doch wenn in Ungarn und Rumänien die Standortbedingungen für das Unternehmen günstiger, die Kosten für die Produktion und letztlich für das Endprodukt zu senken sind, hat der Käufer des Nokia-Telefons den Vorteil von der Verlagerung. Hysterische Boykottaufrufe der politischen Klasse in Deutschland und kollektive Happenings, die kleinen, beliebten Geräte auf den Scheiterhaufen zu werfen und ihre Hersteller als »Subventionsheuschrecken« zu beschimpfen, zeigen, welch krudes Verständnis vom globalisierten Markt hierzulande herrscht. Denn die Konsumenten wollen ein Handy so preisgünstig wie möglich – und das können sie nur haben, wenn es so günstig wie möglich produziert wird. Man kann den Kuchen nicht behalten und zugleich essen wollen. Auch der »polnische Klempner« mußte gleich nach der politischen Osterweiterung der EU und seiner Ankunft in diesem Wirtschaftsraum für den Populismus der politischen Klasse herhalten, indem er als böser Lohndrücker aus dem Osten gebrandmarkt wurde. Doch die Polen waren dann trotz des ausgebliebenen Willkommensgrußes des Nachbarn so höflich, die xenophoben Anwürfe der EU-Kollegen sportlich zu nehmen: Das polnische Fremdenverkehrsbüro verbreitete ein Plakat mit einem sympathischen, überaus wohlgebauten jungen Klempner unter der Überschrift: »Wir bleiben hier!«
Doch immer wieder wird die Illusion erzeugt, der Staat oder die Regierung könnten den globalen ökonomischen Strukturwandel und die damit einhergehenden Verwerfungen, die den einen zum Vorteil gereichen, für die anderen aber sehr schmerzlich sein können, aufhalten. Denn Vater Staat ist immer noch die Appellationsinstanz und ersehnte Autorität, die es richten soll.
In seiner Vorlesung Über eine Weltanschauung widmete sich Sigmund Freud 1933 den Sehnsüchten und Wünschen des Menschen nach einer behaglichen, gerechten Welt, in der für ihn gesorgt wird, seinem Schutzbedürfnis entsprochen und damit seine eigene Hilflosigkeit erträglich wird. Fand der Mensch jahrhundertlang in der Religion bei Gott-Vater solch tröstliche Versicherungen, so scheint an dessen Stelle der moderne Fürsorgestaat getreten zu sein. »Der Vater hat das schwache, hilflose, allen in der Außenwelt lauernden Gefahren ausgesetzte Kind beschützt und bewacht; in seiner Obhut hat es sich sicher gefühlt. Als Erwachsener mag er auch jetzt nicht auf den Schutz verzichten, den er als Kind genossen hat. Längst hat er aber erkannt, daß sein Vater ein in seiner Macht eng beschränktes, nicht mit allen Vorzügen ausgestattetes Wesen ist. Darum greift er auf das Erinnerungsbild des von ihm so überschätzten Vaters der Kindheit zurück, erhebt es zur Gottheit und rückt es in die Gegenwart und in die Realität.« Muß man nicht ähnlich wie die Religion, fragte sich Freud 1927 in Die Zukunft einer Illusion, »anderen Kulturbesitz und die Voraussetzungen, die unsere staatlichen Einrichtungen regeln, gleichfalls Illusionen nennen?« Zu diesem Kulturbesitz zählt zweifellos auch das deutsche Verständnis vom Sozialstaat, das nun einem zähen und schmerzhaften Desillusionierungsprozeß unterworfen ist. Ein Großteil der Bevölkerung hegt immer noch die Sehnsucht, Vater Staat möge für eine soziale und gerechte behagliche Welt sorgen – eine Illusion, die seit Jahrzehnten nicht nur zu Wahlkampfzeiten von der politischen Klasse bedient wird. Aber Vater Staat ist längst das Geld ausgegangen. Bund, Länder und Gemeinden haben einen Schuldenberg von 1,5 Billionen Euro angehäuft; die Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung hat damit ihr historisches Höchstmaß erreicht. Rund 40 Prozent der Bürger bestreiten ihren Lebensunterhalt von Transferleistungen des Staates in Form von Altersrenten, Invalidenrenten, Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe oder öffentlichen Stipendien. Ökonomen warnen schon lange davor, was dies für die Zukunft der Volkswirtschaft bedeuten wird. Doch die Krise der Wirtschaft hat sich bereits seit den 70er Jahren in einer beunruhigenden Korrelation zwischen zunehmender Staatsverschuldung und struktureller, unabhängig vom Konjunkturverlauf größer werdender Arbeitslosigkeit angebahnt. Seit langem pfeifen es nicht nur die Wirtschaftsexperten von deutschen Dächern, daß die zu hohen Lohnnebenkosten die Wirtschaftskraft hierzulande empfindlich dämpfen. Das Rentensystem ist längst aus den Angeln gehoben, und der Konkurs wird auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Doch grundlegende Reformen des so geliebten und gepäppelten Sozialstaats blieben aus. Um die Gunst der Wählerschaft zu gewinnen – immer mit Verweis auf die unterstellten Widerstände in der Bevölkerung –, leugnen die beiden großen Volksparteien weiterhin die tiefe Krise des Wohlfahrtsstaats. Statt dessen nähren sie mit Parolen über soziale Gerechtigkeit die große Illusion, eine Regierung könne Arbeitsplätze schaffen und die Vollbeschäftigung aus alten Zeiten herbeizaubern. Anstelle notwendiger Reformen sind die Regierungsparteien längst kleinmütig geworden und bedienen munter die Angst vor der Freiheit.
Neben Globalisierung und Wirtschaftkrise ist aber mit der deutschen Wiedervereinigung nicht nur der real existierende Sozialismus der alten DDR, sondern auch das alte BRD-Modell des rheinischen Kapitalismus untergegangen. Gerade die historische Zäsur der Wiedervereinigung hätte die Chance des Aufbruchs in eine strukturelle Modernisierung des Sozialstaats geboten und eine Befreiung von staatlicher Bevormundung und regulierungswütiger Bürokratie bescheren können. Aber die Angst vor Veränderung und die Feigheit vor neuen Wegen ist stärker und erstickte den Mut für grundlegende Reformen. Freiheit wird in Deutschland nicht als Eigenverantwortung, Risikobereitschaft, Selbsttätigkeit und Gestaltungsoption des Individuums begriffen, sondern erschöpft sich weiterhin in der sozialen Sicherheit, die Vater Staat den Bürgern lange Zeit garantieren konnte. Selbst der Preis der staatlichen Bevormundung ist ihnen dafür offensichtlich nicht zu hoch. Doch an Wagemut und Beweglichkeit gebricht es auch der politischen Klasse und den Interessenverbänden, wie der deutsche Korporatismus vom Gesundheitswesen bis zur Tarifpolitik zeigt. Keiner will vertraute Sicherheiten aufgeben zugunsten einer riskanten Freiheit mit offener Perspektive, die naturgemäß ein Scheitern ebenso einschließen kann wie den Zuwachs an Selbstbestimmung.
Die seit Otto von Bismarck währende staatliche Sozialpolitik, eine Melange aus Etatismus und Korporatismus, hat sich tief in die deutsche Mentalität eingegraben. Sie wurde erfolgreich als innenpolitisches Instrument zur Konsolidierung gesellschaftlicher und politischer Stabilität angewandt. Fortgesetzt, weiterentwickelt und vertieft durchzieht sie kontinuierlich wie ein roter Faden die deutsche Geschichte vom Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und dem DDR-Kommunismus bis zum prosperierenden Nachkriegsdeutschland. Das Selbstverständnis der Deutschen, der Staat habe die Lebensrisiken seiner Bürger zu tragen und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, hat also eine lange Tradition. Der nationale Sozialismus bediente die Sehnsüchte nach staatlicher Fürsorge ebenso wie später die Sozialistische Einheitspartei in der DDR. Hitler erkaufte sich die Zustimmung der Massen nicht zuletzt mit dem Ehegattensplitting, Kilometerpauschalen und den Zuschlägen für Sonn- und Feiertagsarbeit. Mitten im Krieg 1941 erhöhte er die Renten um 15 Prozent.
Schon 1927 konstatierte der liberale Jurist und Ökonom Ludwig von Mises scharfsinnig: »Der Haß gegen den Liberalismus ist das Einzige, in dem sich die Deutschen einig sind.« Den Deutschen ist die von der Französischen Revolution und später der amerikanischen Verfassung postulierte Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz im Laufe ihrer Geschichte offenkundig zusammengeschmolzen auf die soziale Gleichheit. Sie sehen sich in erster Linie nicht politisch als Staatsbürger einer Demokratie, sondern beziehen ihre Identität aus dem Sozialstaat. Daran hat selbst die historische Zäsur von 1989 nicht rütteln können. Der obwaltende Sozialetatismus und Arbeitskorporatismus, Erbschaften aus beiden deutschen Diktaturen, sorgen bis heute dafür, daß Gleichheit und soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft immer noch höhere Güter sind als die Freiheit.
Doch angesichts der Lücke zwischen laufenden Ein- und Ausgaben des Staates von rund 100 Milliarden Euro pro Jahr werden nicht etwa die Staatsausgaben in relevantem Maße reduziert, sondern die Steuern erhöht – auf daß noch mehr im Staatsmoloch verschwinden möge. Sozial- wie Christdemokraten folgen damit der Adenauerschen Staatsdoktrin: »Keine Experimente!« Ihm hatte Ludwig Erhard Ende der 50er Jahre im Streit um die deutsche Wirtschaftspolitik warnend entgegengehalten: »Die Entwicklung zum Versorgungsstaat wird nicht unwesentlich auch durch den deutschen Hang zum übersteigerten Ordnungsdenken, zum Gesetzesperfektionismus und das darauf beruhende Vordringen des Staates in immer weitere private, wirtschaftliche und kulturelle Bereiche gefördert.«
Wie vorausschauend und luzide war Ludwig Erhards Beobachtung! Anstatt im marktwirtschaftlichen Wettbewerb ein Entdeckungsverfahren und zugleich ein Entmachtungsinstrument zu sehen, wächst bei Bürgern und in der politischen Klasse wieder das antikapitalistische Ressentiment.
Der ökonomische Motor der westlichen Zivilisation auf dem mühsamen Weg zur liberalen Demokratie war der freie Handel und Markt. Doch die fortschreitende Entfaltung der Freiheit, die damit einherging und als politische und individuelle Freiheit heute in den westlichen Verfassungen garantiert ist, hat ihre Wertschätzung als treibende Kraft und zugleich substantielle Errungenschaft dieses Entwicklungsprozesses offensichtlich eingebüßt. Freiheit ist in den Köpfen zur »kalten Freiheit« des Kapitalismus geronnen, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit produziere. Und flugs wird sie mit dem zum Lieblingsschimpfwort gewordenen Neoliberalismus assoziiert. Hatte der Liberalismus schon einen schlechten Ruf, so wird ihm mit dem Attribut ›neo‹ erst recht seine vorgebliche Scheinheiligkeit und Verderbtheit unterstellt. Schaut man jedoch nach seiner Herkunft, erhellt sich sofort, daß er das Gegenteil des angeprangerten wilden und ungezähmten Kapitalismus ist. Von Hause aus ist er nämlich wesentlich sozialer und dem Staat zugewandter als sein böser Ruf. Geboren wurde der Begriff 1938 auf einem Kolloquium in Paris, auf dem sich u.a. Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke und Alexander Rüstow trafen. Den Erfolg der kollektivistischen Ideologien des Kommunismus, Nationalsozialismus und Faschismus sahen sie als Reaktion auf das freie Spiel der Märkte. Das bis dahin waltende liberale Dogma vom Laissez-faire, das sich jegliche staatliche Einmischung verbat, hatte in ihren Augen mit zum Niedergang des Liberalismus beigetragen. Sie revidierten deshalb die klassische Position, die in der Folge von Adam Smith die weitgehende Selbstregulierung des Marktes propagierte. Mit dem Begriff des Neoliberalismus gaben sie ihrer Überzeugung Ausdruck, ohne einen staatlichen institutionellen Rahmen sei der Wettbewerb durch Kartell- und Monopolbildung gefährdet. Ein starker Staat, über der Wirtschaft stehend, solle deshalb als Schiedsrichter über den Wettbewerb wachen. Es ging den Neoliberalen und Ordoliberalen seinerzeit also keineswegs um die Schwächung des Staates gegenüber der Wirtschaft, sondern um die Suche nach einer Wettbewerbsordnung, die Chancen für alle ermöglicht und niemandem Privilegien gewährt.
Haß auf den Bourgeois
»Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet (...) Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt.« So hellsichtig hatten Karl Marx und Friedrich Engels 1848 den Entwicklungsprozeß des Kapitalismus und seine Globalisierung im Kommunistischen Manifest beschrieben. Sie sollten recht behalten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Sieg der Demokratie und Marktwirtschaft über den Kommunismus und seine Planwirtschaft ist es um Freiheit und Wohlstand der Erdenbürger nicht schlecht bestellt: Fast Zweidrittel aller 192 Staaten haben heute gewählte Regierungen, in über 80 Ländern existieren sogar echte liberale Demokratien. Seit 1980 hat sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Weltbevölkerung verdoppelt. Und die mittlere Lebenserwartung der Menschheit liegt inzwischen bei 65 Jahren.
Mit dem prognostizierten weltweiten Untergang des von ihnen so gehaßten dekadenten Kapitalismus hatten sie allerdings unrecht. Aber nicht der realistische Kern und ihre Weitsicht auf die produktiven Kräfte des Weltmarkts blieben in den Köpfen hängen, sondern die Täuschung und Illusion, die im Ressentiment gegenüber dem Bourgeois gründen. Auch wenn die Realität die Propheten der klassenlosen Gesellschaft und der Revolution und in der Nachfolge ihre staatskommunistischen Vollstrecker Lügen gestraft hat, hat der Haß auf Kapitalismus und Globalisierung eine ungeahnte Haltbarkeit, gerade auch im ökonomisch gut abgepolsterten Europa. Nicht nur das bunt gemischte Volk der Globalisierungskritiker, von Attac, Pax Christi, Linkspartei, Verdi bis NPD und schwarzem Block, auch die abertausend Teilnehmer auf Evangelischen Kirchentagen würden der Schlußfolgerung Karl Marx‘ und Friedrich Engels‘ aus ihrem Globalisierungsbefund kaum widersprechen: »Die Bourgeoisie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an anderer Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.«
Aus diesem Grunde traf Karl Marx bereits in seinen Frühschriften die Unterscheidung zwischen der sogenannten »formellen Freiheit«, die in der bürgerlichen Gesellschaft walte, und der »reellen Freiheit«, die sich erst in der klassenlosen Gesellschaft, im Paradies auf Erden, mitsamt dem neuen Kollektivmenschen entfalten würde.
Obwohl das kommunistische Gesellschaftsexperiment gescheitert ist und Millionen Todesopfer beschert hat, überwintern zählebig seine ideologischen Versatzstücke bis hinein in die bürgerliche Mitte der europäischen Gesellschaften.