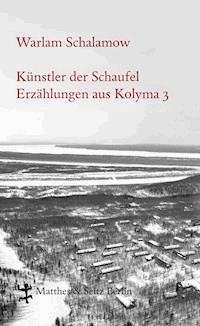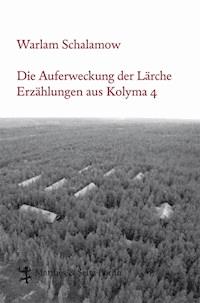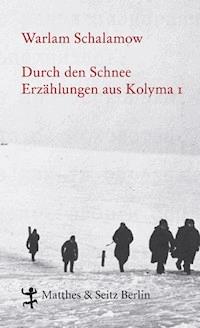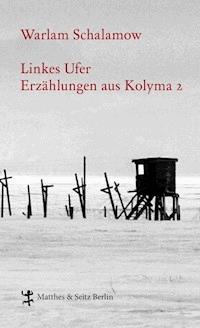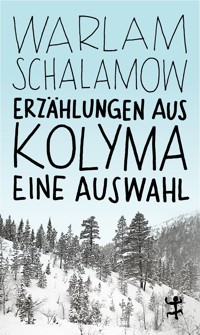
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warlam Schalamows Erzählungen aus Kolyma gehören zu den herausragendsten Leistungen der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Der Autor geht darin einer Schlüsselfrage unserer Gegenwart nach: Wie können Menschen, die über Jahrhunderte in der Tradition des Humanismus erzogen wurden, Lager wie Auschwitz und Kolyma hervorbringen? Diese Ausgabe im Paperback versammelt ein Dutzend der prägendsten Texte aus Schalamows umfangreichem Erzählwerk über die Lagerwelt in einer der kältesten Regionen der Erde. Wer die Erzählungen liest, wird in einen Lageralltag hineingezogen, in dem die unmittelbare Gewalt stets präsent ist und dem Häftling jede Hoffnung auf einen Ausweg nimmt. Und dennoch legen Schalamows Erzählungen ein bleibendes literarisches Zeugnis ab über die enorme physische wie auch moralische Widerstandskraft des Menschen. Sie tun das nicht zuletzt durch ihre lakonische und zugleich melodische Sprache, ihren vielschichtigen poetischen Reichtum. »In den Erzählungen aus Kolyma gibt es nichts, das nicht Überwindung des Bösen und Triumph des Guten wäre – wenn man die Frage im großen Rahmen, im Rahmen der Kunst betrachtet.« So Schalamow über sein Jahrhundertwerk, das auch dem heutigen Leser tiefstes Erschrecken über das Menschenmögliche, zugleich aber größte Hoffnung auf Überwindung aller Schrecknisse beschert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warlam Schalamow
Erzählungen aus Kolyma
Eine Auswahl
Aus dem Russischen von Gabriele Leupold
Mit einem Nachwort von Franziska Thun-Hohenstein
Die Geschichte wiederholt sich, und jede Erschießung des Jahres siebenunddreißig lässt sich wiederholen. Warum schreibe ich dann trotzdem? Ich schreibe, damit der Leser in meiner von jeder Lüge sehr fernen Prosa, wenn er meine Erzählungen liest, sein Leben so [gestalten] kann, dass er etwas Gutes tut, wenigstens irgendetwas [Positives]. Der Mensch muss etwas tun.
Warlam Schalamow, Aus den Notizheften
Die Frage des Aufeinandertreffens von Mensch und Welt, des Kampfes zwischen Mensch und Staatsmaschinerie, die Wahrheit dieses Kampfes, der Kampf für sich, im eigenen Inneren – und außerhalb seiner selbst. Ist es möglich, das eigene Schicksal zu beeinflussen, das von den Zähnen der Staatsmaschinerie, den Zähnen des Bösen zermalmt wird? Illusion und Bürde der Hoffnung. Die Möglichkeit, sich auf andere Kräfte zu stützen als die Hoffnung.
Warlam Schalamow, »Über Prosa«
Inhalt
Durch den Schnee
Auf Ehrenwort
Die Einzelschicht
Cherry Brandy
Kinderbildchen
Waska Denissow, der Schweinedieb
Die Juristenverschwörung
Typhusquarantäne
Der Statthalter von Judäa
Das letzte Gefecht des Majors Pugatschow
Sentenz
Der Anfall
Wie alles begann
Das Kreuz
Berdy Ali As
Der Zug
Der Pfad
Ankerplatz der Hölle
Marcel Proust
Der Handschuh
Attische Nächte
Die Auferweckung der Lärche
Nachwort Franziska Thun-Hohenstein
Anmerkungen
Durch den Schnee
Wie tritt man einen Weg in unberührten Schnee? Ein Mann geht voran, schwitzend und fluchend, setzt kaum einen Fuß vor den anderen und bleibt dauernd stecken im lockeren Tiefschnee. Der Mann läuft weit vor und markiert seinen Weg mit ungleichen schwarzen Löchern. Er wird müde, legt sich in den Schnee, steckt sich eine Papirossa an, und Machorkarauch schwebt als blaues Wölkchen über dem weißen funkelnden Schnee. Der Mann ist schon weitergegangen, doch das Wölkchen steht noch immer dort, wo er verschnauft hat – die Luft ist beinahe unbewegt. Wege legt man stets an stillen Tagen an, damit die Winde die menschliche Arbeit nicht verwehen. Der Mann sucht sich seine Punkte in der Unendlichkeit des Schnees: einen Fels, einen hohen Baum – der Mann lenkt seinen Körper durch den Schnee, wie ein Steuermann sein Boot über den Fluss lenkt von Landzunge zu Landzunge.
Auf der schmalen und flüchtigen Spur folgen fünf, sechs andere, Schulter an Schulter. Sie treten um die Fußspur herum, nicht hinein. An der zuvor bezeichneten Stelle angekommen, machen sie kehrt und laufen wieder so, dass sie frischen Schnee berühren, eine Stelle, die der Fuß des Mannes noch nicht betreten hat. Der Weg ist gebahnt. Nun können ihn Menschen, Schlittenzüge, Traktoren nehmen. Geht man den Weg des ersten in seinen Fußstapfen, entsteht eine erkennbare, doch kaum begehbare schmale Fährte, ein Fußpfad, kein Weg – Löcher, in denen es sich schwerer läuft als im unberührten Schnee. Der erste hat es am schwersten, und wenn seine Kräfte erschöpft sind, geht ein anderer vom selben Fünfervortrupp voran. Von denen, die der Spur folgen, muss jeder, selbst der Kleinste und Schwächste, auf ein Stückchen unberührten Schnee treten, nicht in die fremden Fußspuren. Auf Traktoren und Pferden kommen nicht die Schriftsteller, sondern die Leser.
<1956>
Auf Ehrenwort
Sie spielten Karten beim Pferdetreiber Naumow. Die diensthabenden Aufseher schauten niemals in die Baracke der Pferdetreiber, sie fanden zu Recht, ihre Hauptaufgabe bestehe in der Überwachung der nach Artikel 58 Verurteilten. Den Konterrevolutionären aber wurden die Pferde in der Regel nicht anvertraut. Insgeheim allerdings murrte die praktisch denkende Leitung: Sie kam um die besten, sorgfältigsten Arbeiter, doch die Vorschrift war in dieser Hinsicht eindeutig und streng. Kurz, bei den Pferdetreibern war man am sichersten, und dort trafen sich die Ganoven jede Nacht zu ihren Kartenduellen.
In der rechten Ecke der Baracke waren auf der unteren Pritsche bunte Steppdecken ausgebreitet. Am Eckpfosten war mit Draht eine brennende »Kolymka« befestigt, ein selbstgemachtes Benzindampflämpchen: Auf den Deckel einer Konservendose wurden drei, vier offene Kupferröhrchen gelötet, das war die ganze Vorrichtung. Damit die Lampe brannte, legte man heiße Kohle auf den Deckel, das Benzin wurde warm, der Dampf stieg durch die Röhrchen auf, und das Benzingas, mit einem Streichholz angesteckt, brannte.
Auf den Decken lag ein schmutziges Daunenkissen, und zu seinen beiden Seiten, die Beine auf Burjatenart untergeschlagen, saßen die Spieler – die klassische Pose der Kartenschlacht im Gefängnis. Auf dem Kissen lag ein nagelneues Kartenspiel. Das waren keine gewöhnlichen Karten, es war ein selbstgemachtes Gefängnisspiel, das die Meister dieses Handwerks in erstaunlicher Schnelligkeit herstellten. Zu dieser Herstellung brauchte man Papier (ein beliebiges Buch), ein Stück Brot (zum Zerkauen und Durchdrücken zur Gewinnung von Stärke – zum Zusammenkleben der Seiten), einen Kopierstift (anstelle von Druckfarbe) und ein Messer (zum Ausschneiden der Farbschablonen und der Karten selbst).
Die heutigen Karten waren gerade aus einem Bändchen Victor Hugo geschnitten, gestern hatte jemand das Buch im Kontor liegenlassen. Das Papier war fest und dick, man brauchte die Seiten nicht zusammenzukleben, wie man es bei dünnem Papier tut. Im Lager wurden bei allen Durchsuchungen strikt die Kopierstifte konfisziert. Auch bei der Kontrolle von eingehenden Paketen wurden sie eingezogen. Das tat man nicht nur zur Unterbindung der möglichen Herstellung von Dokumenten und Stempeln (auch diese Kunst beherrschten viele), sondern auch zur Vernichtung jeglicher Konkurrenz mit dem staatlichen Kartenmonopol. Aus den Kopierstiften wurde Tinte gemacht, und mit der Tinte trug man durch die vorgeschnittene Papierschablone die Muster auf die Karte auf – Damen, Buben, Zehner aller Farben … Die Spielkartenfarben unterschieden sich nicht nach Rot und Schwarz, und der Spieler braucht diesen Unterschied auch nicht. Beim Pik-Buben zum Beispiel saß der Spieß an zwei entgegengesetzten Ecken der Karte. Verteilung und Form der Muster blieben über Jahrhunderte gleich – die eigenhändige Herstellung von Spielkarten gehört zur »Ritter«erziehung des jungen Ganoven.
Das nagelneue Kartenspiel lag auf dem Kissen, und einer der Spieler schlug seine schmutzige Hand mit den feinen weißen, unabgearbeiteten Fingern darauf. Der Nagel des kleinen Fingers war von übernatürlicher Länge – ein Ganoven-Schick, genauso wie die »Stifte«, Gold-, d. h. Bronzekronen, die auf völlig gesunde Zähne gesetzt werden. Es gab sogar Meister, selbsternannte Zahnprothesenmacher, die mit der Herstellung solcher ständig gefragten Kronen nicht wenig dazuverdienten. Was die Nägel betrifft, so hätte sich ihr farbiges Lackieren zweifellos in der Verbrecherwelt eingebürgert, wenn man im Gefängnis Lack hätte herbeischaffen können. Der gepflegte gelbe Nagel glänzte wie ein Edelstein. Mit der linken Hand fuhr sich der Herr des Nagels durch das verklebte und schmutzige helle Haar. Er hatte einen makellosen »Fassonschnitt«. Die niedrige, vollkommen faltenlose Stirn, die gelben Büschel der Augenbrauen, das aufgeworfene Mündchen – all das verlieh seiner Physiognomie eine für das Äußere eines Diebes wichtige Eigenschaft: Unauffälligkeit. Das Gesicht war so, dass man es sich nicht merken konnte. Man schaute es an und vergaß es, verlor alle Züge, und beim nächsten Mal erkannte man es nicht wieder. Das war Sewotschka, eine berühmte Koryphäe für Terz, Stoß und Bura, die drei klassischen Kartenspiele, ein begeisterter Exeget Tausender Regeln des Kartenspiels, deren strenge Beachtung in einer echten Schlacht zwingend ist. Von Sewotschka hieß es, dass er »vorzüglich Kommers mache« – das heißt, Können und Geschicklichkeit eines Falschspielers zeige. Und er war auch ein Falschspieler, selbstverständlich; ehrliches Ganovenspiel ist ja Spiel auf Betrug: Pass auf und überführ deinen Partner, das ist dein Recht, sieh zu, selbst zu betrügen, sieh zu, dich gegen einen zweifelhaften Gewinn zu verwahren.
Es spielten immer zwei, Mann gegen Mann. Keiner der Meister erniedrigte sich durch die Teilnahme an Gruppenspielen wie Siebzehn und Vier. Gegen starke »Kommerzianten« anzutreten fürchteten sie nicht – auch im Schach sucht ein echter Kämpfer stets den stärkeren Gegner.
Sewotschkas Partner war Naumow selbst, der Brigadier der Pferdetreiber. Er war älter als sein Partner (wie alt war übrigens Sewotschka, zwanzig? dreißig? vierzig?), ein schwarzhaariger Bursche mit einem solchen Dulderausdruck in den tiefliegenden Augen, dass ich ihn, hätte ich nicht gewusst, dass Naumow ein Eisenbahndieb aus dem Kubangebiet ist, für einen Wallfahrer gehalten hätte – einen Mönch oder ein Mitglied der Sekte »Gott weiß es«, einer gewissen Sekte, die nun schon einige Jahrzehnte in unseren Lagern anzutreffen ist. Dieser Eindruck verstärkte sich beim Anblick der Schnur mit Zinnkreuzchen, die um Naumows Hals hing – sein Hemdkragen stand offen. Dieses Kreuzchen war keineswegs ein lästerlicher Scherz, eine Grille oder Improvisation. Zu jener Zeit trugen alle Ganoven Aluminiumkreuzchen um den Hals – das war ein Erkennungszeichen des Ordens, wie eine Tätowierung.
In den zwanziger Jahren trugen die Ganoven Ingenieursmützen, noch früher Kapitänsmützen. In den vierziger Jahren trugen sie im Winter kubanki und krempelten die Schäfte der Filzstiefel um, und um den Hals trugen sie ein Kreuz. Das Kreuz war gewöhnlich glatt, doch wenn Künstler da waren, zwang man sie, beliebte Motive darauf einzuritzen: ein Herz, eine Spielkarte, ein Kreuz, eine nackte Frau … Naumows Kreuz war glatt. Es hing auf Naumows dunkler nackter Brust und störte beim Lesen der blauen Tätowierung – einem Vers von Jessenin, dem einzigen von der Verbrecherwelt anerkannten und kanonisierten Dichter:
Wie wenig Weg zurückgelegt;
Und wie viel Fehler schon begangen.
»Was setzt du?«, murmelte Sewotschka mit unendlicher Verachtung zwischen den Zähnen: Auch das galt als guter Ton bei Spielanfang.
»Die Klamotten hier. Diese Kluft …« Und Naumow klopfte sich auf die Schultern.
»Ich setze fünfhundert«, veranschlagte Sewotschka den Anzug.
Als Antwort ertönte ein wortreiches Geschimpfe, das den Gegner vom erheblich höheren Wert des Stücks überzeugen sollte. Die die Spieler umringenden Zuschauer erwarteten geduldig das Ende dieser traditionellen Ouvertüre. Sewotschka blieb nichts schuldig und schimpfte noch giftiger, um den Preis zu drücken. Schließlich wurde der Anzug mit tausend veranschlagt. Sewotschka seinerseits setzte ein paar getragene Pullover. Nachdem die Pullover veranschlagt und sofort auf die Decke geworfen waren, mischte Sewotschka die Karten.
Garkunow, ein ehemaliger Textilingenieur, und ich sägten für Naumows Baracke Holz. Das war Nachtarbeit – nach unserem Arbeitstag in der Mine mussten wir Holz für vierundzwanzig Stunden sägen und hacken. Gleich nach dem Abendessen verschwanden wir bei den Pferdetreibern – hier war es wärmer als in unserer Baracke. Nach der Arbeit goss uns Naumows Barackendienst kalte »Brühe« in unser Kochgeschirr – den Rest des einzigen, des Stammgerichts, das in der Kantine »ukrainische Mehlklößchen« hieß, und gab uns jedem ein Stück Brot. Wir setzten uns irgendwo in der Ecke auf den Boden und vertilgten das Verdiente schnell. Wir aßen in völliger Dunkelheit – die Barackenfunzeln beleuchteten das Kartenfeld, doch der Löffel, so die treffende Beobachtung erfahrener Gefängnisinsassen, findet immer zum Mund. Jetzt sahen wir dem Spiel von Sewotschka und Naumow zu.
Naumow hatte seine »Kluft« verspielt. Hose und Jackett lagen neben Sewotschka auf der Decke. Jetzt wurde um das Kissen gespielt. Sewotschkas Fingernagel zeichnete in der Luft komplizierte Muster. Die Karten waren mal in seiner Hand verschwunden, mal tauchten sie wieder auf. Naumow saß im Unterhemd – der Satin-Russenkittel war den Hosen gefolgt. Dienstfertige Hände legten ihm eine Wattejacke um die Schultern, doch er warf sie mit einer schroffen Bewegung zu Boden. Plötzlich wurde alles still. Sewotschka kratzte gemächlich mit dem Nagel über das Kissen.
»Ich setze die Decke«, sagte Naumow heiser.
»Zweihundert«, antwortete Sewotschka mit gleichgültiger Stimme.
»Tausend, du Kanaille!«, schrie Naumow.
»Wofür? Das ist nichts wert! Das ist ein Loksch, ein Dreck«, erwiderte Sewotschka. »Nur für dich – ich spiele um dreihundert.«
Die Schlacht ging weiter. Nach den Regeln darf der Kampf nicht beendet werden, solange der Partner noch etwas aufbieten kann.
»Ich setze die Filzstiefel.«
»Ich spiele nicht um Filzstiefel«, sagte Sewotschka fest. »Ich spiele nicht um Staatsklamotten.«
Um ein paar Rubel wurde ein ukrainisches Handtuch mit Hähnen verspielt und ein Zigarettenetui mit ziseliertem Gogol-Profil – alles ging an Sewotschka. Durch Naumows dunkle Wangenhaut trat eine satte Röte hervor.
»Auf Ehrenwort«, sagte er unterwürfig.
»Das fehlte noch«, sagte Sewotschka lebhaft und streckte die Hand nach hinten: Sogleich wurde ihm eine angezündete Marchorka-Papirossa in die Hand gelegt. Sewotschka nahm einen tiefen Zug und bekam einen Hustenanfall. »Was soll ich mit deinem Ehrenwort? Neue Etappen gibt es nicht – wo nimmst du es her? Von den Posten vielleicht?«
Die Einwilligung, »auf Ehrenwort« zu spielen, auf Pump, war dem Gesetz nach eine nichtobligatorische Gefälligkeit, doch Sewotschka wollte Naumow nicht beleidigen und ihm die letzte Chance des Rückgewinns nicht nehmen.
»Einen Hunderter«, sagte er langsam. »Ich gebe dir eine Stunde.«
»Gib eine Karte«, Naumow rückte das Kreuzchen zurecht und setzte sich. Er gewann die Decke, das Kissen, die Hosen zurück – und verlor wieder alles.
»Vielleicht setzten wir ein tschifirchen an«, sagte Sewotschka und legte die gewonnenen Sachen in einen großen Sperrholzkoffer. »Ich warte.«
»Aufbrühen, Jungs«, sagte Naumow.
Es ging um ein staunenswertes nördliches Getränk, um starken Tee, wo für eine kleine Tasse fünfzig und mehr Gramm Tee aufgebrüht werden. Das Getränk ist extrem bitter, man trinkt es in kleinen Schlucken und isst dazu gesalzenen Fisch. Es vertreibt den Schlaf und steht darum bei den Ganoven und auch den Chauffeuren auf ihren langen Fahrten im Norden hoch im Kurs. Tschifir müsste zerstörerisch auf das Herz wirken, doch ich kannte langjährige tschifir-Trinker, die ihn fast problemlos vertrugen. Sewotschka nahm einen Schluck aus dem ihm gereichten Becher.
Der schwere dunkle Blick Naumows glitt über die Umgebenden. Sein Haar war wirr. Sein Blick erreichte mich und hielt inne.
Ein Gedanke blitzte auf in Naumows Hirn.
»Los, komm her.«
Ich trat vor ins Licht.
»Zieh die Jacke aus.«
Es war schon klar, worum es ging, und alle verfolgten Naumows Versuch mit Interesse.
Unter der Wattejacke trug ich nur die Staatswäsche – die Feldbluse hatten sie vor zwei Jahren ausgegeben, und sie hatte sich längst aufgelöst. Ich zog mich wieder an.
»Komm du«, sagte Naumow und zeigte mit dem Finger auf Garkunow.
Garkunow zog die Wattejacke aus. Sein Gesicht war weiß. Unter dem schmutzigen Unterhemd trug er einen Wollpullover, er war das Letzte, was seine Frau ihm gebracht hatte vor dem Abtransport auf den weiten Weg, und ich wusste, wie Garkunow ihn hütete, ihn im Badehaus wusch, am Körper trocknete und nicht einen Moment aus den Händen ließ – die Kameraden hätten das Strickhemd sofort geklaut.
»Los, ausziehen«, sagte Naumow.
Sewotschka hob zustimmend einen Finger – Wollsachen wurden geschätzt. Wenn man das Jäckchen zum Waschen gibt und die Läuse abdampft, kann man es auch selber tragen, das Muster ist schön.
»Nein«, sagte Garkunow heiser. »Nur mitsamt der Haut …«
Sie stürzten sich auf ihn, warfen ihn um.
»Er beißt«, schrie jemand.
Garkunow stand langsam vom Boden auf und wischte sich mit dem Ärmel das Blut vom Gesicht. Und sofort ging Saschka, Naumows Barackendienst, derselbe Saschka, der uns vor einer Stunde das Süppchen fürs Holzsägen eingeschüttet hatte, leicht in die Hocke und zog etwas aus dem Schaft seines Filzstiefels. Dann streckte er die Hand nach Garkunow aus, und Garkunow schluchzte auf und kippte langsam zur Seite.
»Ging’s denn nicht ohne!«, schrie Sewotschka.
Im flackernden Licht des Benzinlämpchens sah man, wie Garkunows Gesicht grau wurde.
Saschka streckte die Arme des Getöteten, zerriss das Unterhemd und zog den Pullover über den Kopf. Der Pullover war rot und das Blut darauf kaum zu sehen. Vorsichtig, um sich die Finger nicht schmutzig zu machen, legte Sewotschka den Pullover in den Holzkoffer. Das Spiel war aus, und ich konnte nach Hause gehen. Zum Holzsägen musste ich mir jetzt einen anderen Partner suchen.
1956
Die Einzelschicht
Am Abend sagte der Aufseher, Dugajew bekomme am nächsten Tag eine Einzelschicht, und wickelte sein Bandmaß auf. Der Brigadier, der danebenstand und den Aufseher gebeten hatte, ihm »bis übermorgen ein Dutzend Kubikmeter« zu stunden, war plötzlich stumm und schaute zum Abendstern, der über der Bergkuppe aufblinkte. Baranow, Dugajews Partner, der dem Aufseher geholfen hatte, die geleistete Arbeit zu vermessen, nahm die Schaufel und kratzte die längst gesäuberte Grube aus.
Dugajew war dreiundzwanzig, und alles, was er hier sah und hörte, verwunderte ihn mehr, als dass es ihn erschreckte.
Die Brigade sammelte sich zum Appell, gab das Werkzeug ab und kehrte im ungeordneten Häftlingsverband in die Baracke zurück. Der schwere Tag war zu Ende. In der Kantine trank Dugajew im Stehen, gleich aus der Schüssel, seine Portion dünne kalte Graupensuppe. Das Brot wurde morgens für den ganzen Tag verteilt und war längst aufgegessen. Jetzt hätte er gern geraucht. Er sah sich um und überlegte, wen er um eine Kippe bitten konnte. Auf dem Fensterbrett häufelte Baranow aus dem umgedrehten Tabaksbeutel Machorkakrümel auf ein Stückchen Papier. Nachdem er sie sorgfältig gehäufelt hatte, drehte Baranow eine dünne Zigarette und hielt sie Dugajew hin.
»Rauch und lass mir was übrig«, bot er an.
Dugajew wunderte sich, Baranow und er waren nicht befreundet. Übrigens schließt man bei Hunger, Kälte und Schlaflosigkeit niemals Freundschaft, und trotz seiner Jugend spürte Dugajew die ganze Verlogenheit der Redensart von der Freundschaft, die sich in Unglück und Not bewährt. Damit Freundschaft zu Freundschaft wird, muss eine solide Basis dafür gelegt sein, bevor die Verhältnisse, das Leben jene letzte Grenze erreichen, jenseits deren im Menschen nichts Menschliches bleibt, nur noch Misstrauen, Erbitterung und Lüge. Dugajew erinnerte sich gut an die Redensart aus dem Norden, die drei Häftlingsgebote: glaube nichts, fürchte nichts, bitte um nichts …
Dugajew zog gierig den süßen Machorkarauch ein, und ihm wurde schwindlig.
»Ich werde schwächer«, sagte er.
Baranow antwortete nicht.
Dugajew kehrte in die Baracke zurück, legte sich hin und schloss die Augen. In letzter Zeit schlief er schlecht, der Hunger ließ ihn nicht gut schlafen. Seine Träume waren besonders quälend – Brotlaibe, dampfende fette Suppen … Der Schlummer kam spät, doch eine halbe Stunde vor dem Wecken hatte Dugajew die Augen trotzdem schon geöffnet.
Die Brigade erreichte ihren Einsatzort. Alle verteilten sich auf die Schürfgruben.
»Warte du mal«, sagte der Brigadier zu Dugajew. »Du wirst vom Aufseher eingeteilt.«
Dugajew setzte sich auf den Boden. Er war schon so erschöpft, dass ihn jede Veränderung in seinem Schicksal vollkommen gleichgültig ließ.
Die ersten Schubkarren schepperten auf dem Steg, die Schaufeln knirschten auf dem Stein.
»Komm her«, sagte der Aufseher zu Dugajew. »Hier ist dein Platz.« Er maß den Rauminhalt der Grube aus und legte ein Merkzeichen hin, ein Stück Quarz. »Bis hier«, sagte er. »Der Stegbauer verlegt dir ein Brett bis zum Hauptsteg. Dort karrst du hin, wie die anderen auch. Hier hast du Schaufel, Hacke, Brechstange, Schubkarre, leg los.«
Dugajew begann fügsam mit der Arbeit.
Umso besser, dachte er. Kein Kamerad wird schimpfen, dass er schlecht arbeitet. Die ehemaligen Ackerbauern müssen weder begreifen noch wissen, dass Dugajew Anfänger ist, dass er gleich von der Schule an die Universität gewechselt und die Universitätsbank gegen diese Grube eingetauscht hat. Jeder für sich allein. Sie müssen nicht, sind nicht verpflichtet zu begreifen, dass er längst schon ausgezehrt und halb verhungert ist und unfähig zu stehlen: Die Fähigkeit zu stehlen ist die wichtigste Tugend des Nordens, in allen Varianten, angefangen vom Brot des Kameraden bis hin zu den Tausenden Rubeln Prämien, die die Leitung einstreicht für nichtvorhandene, nichtexistente Erfolge. Niemanden geht es etwas an, dass Dugajew einen Sechzehnstundentag nicht durchhält.
Dugajew karrte, hackte und kippte, und wieder: karrte, hackte, kippte.
Nach der Mittagspause kam der Aufseher, warf einen Blick auf das von Dugajew Geschaffte und entfernte sich wortlos … Dugajew hackte und kippte wieder. Bis zur Quarzmarke war es noch sehr weit.
Am Abend erschien der Aufseher erneut und wickelte das Bandmaß ab. Er maß, was Dugajew geschafft hatte.
»Fünfundzwanzig Prozent«, sagte er und sah Dugajew an. »Fünfundzwanzig Prozent. Hörst du?«
»Ich höre«, sagte Dugajew. Er wunderte sich über diese Zahl. Die Arbeit war so schwer, die Schaufel fasste so wenig Stein, es war so schwer zu hacken. Die Zahl – fünfundzwanzig Prozent der Norm – erschien Dugajew sehr hoch. Die Waden schmerzten, vom Druck auf die Schubkarre taten Arme, Schultern und Kopf unerträglich weh. Der Hunger hatte ihn längst verlassen. Dugajew aß, weil er sah, dass die anderen aßen, irgendetwas diktierte ihm: Du musst essen. Aber er mochte nicht essen.
»Na dann«, sagte der Aufseher im Gehen. »Ich wünsche Gesundheit.«
Am Abend wurde Dugajew zum Untersuchungsführer gerufen. Er antwortete auf vier Fragen: Vorname, Nachname, Artikel, Haftdauer. Vier Fragen, die der Häftling dreißig Mal am Tag gestellt bekommt. Dann ging Dugajew schlafen. Am nächsten Tag arbeitete er wieder mit der Brigade, mit Baranow, und in der Nacht darauf führten ihn Soldaten hinter den Pferdestützpunkt und brachten ihn auf einem Waldweg an einen Ort, wo, einen kleinen Hohlweg beinahe verdeckend, ein hoher Zaun mit Stacheldrahtverhau stand und woher in den Nächten fernes Traktorengeknatter herüberklang. Und als Dugajew begriff, worum es ging, bedauerte er, dass er umsonst gearbeitet, sich umsonst gequält hatte an diesem letzten heutigen Tag.
<1955>
Cherry Brandy
Der Dichter lag im Sterben. Die großen, vom Hunger angeschwollenen Hände mit den weißen blutleeren Fingern und den schmutzigen, röhrenförmig ausgewachsenen Fingernägeln lagen auf der Brust, ohne sich vor der Kälte zu schützen. Früher hatte er sie unter den Achseln verborgen, am nackten Körper, aber jetzt war dort zu wenig Wärme. Die Handschuhe hatte man ihm längst gestohlen; zum Stehlen brauchte man nur Dreistigkeit – und man stahl am helllichten Tag. Eine trübe elektrische Sonne, von den Fliegen besudelt und von einem runden Gitter gefesselt, war hoch oben unter der Decke angebracht. Das Licht fiel auf die Füße des Dichters – er lag in der dunklen Tiefe der unteren Reihe der durchgehenden doppelstöckigen Pritschen, wie in einem Kasten. Von Zeit zu Zeit bewegten sich seine Finger, schnalzten wie Kastagnetten, befühlten einen Knopf, ein Knopfloch oder Loch an der Weste, fegten irgendeinen Dreck weg und hielten wieder still. Der Dichter lag so lange im Sterben, dass er nicht mehr wusste, dass er starb. Manchmal kam und bahnte sich schmerzhaft und fast spürbar ein einfacher und starker Gedanke einen Weg durchs Hirn – man habe ihm das Brot gestohlen, das er unter den Kopf gelegt hatte. Und das war so versengend schrecklich, dass er bereit war zu streiten, zu fluchen, sich zu prügeln, zu suchen, zu beweisen. Doch dafür fehlten ihm die Kräfte, und der Gedanke an das Brot wurde schwächer … Und sofort dachte er an anderes, daran, dass man alle hatte übers Meer fahren sollen, und der Dampfer hat aus irgendeinem Grund Verspätung, und es ist gut, dass er hier ist. Und ebenso leicht und diffus begann er, sich den großen Leberfleck auf dem Gesicht des Barackendiensts vorzustellen. Den größten Teil des Tages dachte er an jene Ereignisse, die sein Leben hier ausmachten. Die Bilder, die vor seinen Augen erstanden, waren keine Bilder der Kindheit, der Jugend, des Erfolgs. Sein Leben lang hatte er es eilig gehabt. Es war wunderbar, dass er sich Zeit lassen, dass er langsam denken durfte. Und er dachte ohne Eile an die große Gleichförmigkeit der Bewegungen Sterbender, daran, was die Ärzte früher begriffen und beschrieben haben als die Künstler und Dichter. Das Hippokratische Gesicht – die Maske des sterbenden Menschen – kennt jeder Student der Medizinischen Fakultät. Diese rätselhafte Gleichförmigkeit der Bewegungen Sterbender diente Freud als Anlass für die kühnsten Hypothesen. Gleichförmigkeit, Wiederholung – das ist notwendige Grundlage der Wissenschaft. Das, was unwiederholbar ist am Tod, haben nicht die Ärzte, sondern die Dichter gesucht. Es war angenehm zu erkennen, dass er noch denken konnte. Die Hungerübelkeit war er schon lange gewöhnt. Und alles war gleichberechtigt, Hippokrates, der Barackendienst mit dem Leberfleck und der eigene schmutzige Fingernagel.
Das Leben trat in ihn ein und trat aus, und er lag im Sterben. Doch das Leben kam wieder, die Augen öffneten sich, es kamen Gedanken. Nur Wünsche kamen keine. Er lebte längst in einer Welt, wo man die Menschen oft ins Leben zurückholen musste, mit künstlicher Beatmung, Glukose, Kampfer, Koffein. Der Tote wurde wieder lebendig. Und warum auch nicht? Er glaubte an die Unsterblichkeit, an die wahre menschliche Unsterblichkeit. Oft dachte er, dass es einfach keinerlei biologische Gründe gibt, weshalb der Mensch nicht ewig leben sollte … Das Alter ist nur eine heilbare Krankheit, und wäre nicht das bis heute unaufgelöste tragische Missverständnis, könnte er ewig leben. Oder so lange, bis er es leid ist. Und er war das Leben keineswegs leid. Selbst jetzt, in dieser Durchgangsbaracke, der »Transitka«, wie die hiesigen Einwohner liebevoll sagten. Sie war die Vorstufe des Schreckens, doch der Schrecken selbst war sie nicht. Im Gegenteil, hier lebte der Geist der Freiheit, und das spürten alle. Vor ihm lag das Lager, hinter ihm das Gefängnis. Das war eine »Welt des Übergangs«, und der Dichter verstand das.
Es gab einen weiteren Weg der Unsterblichkeit, den des Dichters Tjuttschew:
»Und selig ist, der weilt’ auf dieser Welt
In ihren Schicksalsaugenblicken.«
Doch wenn er offensichtlich schon nicht in seiner menschlichen Gestalt, als physische Einheit unsterblich sein konnte, dann hatte er sich die künstlerische Unsterblichkeit doch schon verdient. Man nannte ihn den ersten russischen Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts, und oft dachte er, dass das tatsächlich so war. Er glaubte an die Unsterblichkeit seiner Gedichte. Er hatte keine Schüler, aber können denn Dichter sie ertragen? Er hat auch Prosa geschrieben – schlechte Prosa, und Artikel. Doch nur in den Gedichten hat er für die Dichtung Neues gefunden, Wichtiges, wie ihm immer schien. All sein früheres Leben war Literatur, war Buch, Märchen, Traum, und nur der gegenwärtige Tag war das wirkliche Leben.
All das wurde nicht widerstrebend gedacht, sondern im Stillen, irgendwo tief in ihm. Diesen Betrachtungen fehlte die Leidenschaft. Schon lange hatte ihn Gleichgültigkeit ergriffen. Was waren das alles für Lappalien, für ein »Mäusetritt«, im Vergleich zur üblen Schwere des Lebens. Er wunderte sich über sich selbst – wie konnte er so an Verse denken, wenn schon alles entschieden war, und er wusste das sehr genau, besser als irgendjemand sonst? Wer brauchte ihn hier und wem kam er gleich? Warum hatte er all das begreifen müssen, und er wartete … und begriff.
In jenen Momenten, wo das Leben in seinen Körper zurückkehrte und die halbgeöffneten trüben Augen plötzlich zu sehen, die Lider zu zittern und die Finger sich zu rühren begannen, kamen auch die Gedanken zurück, von denen er nicht dachte, dass sie die letzten wären.
Das Leben trat selbständig ein als unumschränkte Herrin: Er hatte es nicht gerufen, und dennoch trat es in seinen Körper, in sein Hirn, trat ein wie Verse, wie Inspiration. Und die Bedeutung dieses Wortes eröffnete sich ihm zum ersten Mal in aller Fülle. Die Verse waren jene lebenspendende Kraft, in der er lebte. Eben so war es. Nicht um der Verse willen lebte er, er lebte aus den Versen.
Jetzt war so anschaulich, so fühlbar klar, dass die Inspiration das Leben war; vor dem Tod war es ihm gegeben zu erfahren, dass das Leben Inspiration war, eben Inspiration.
Und er freute sich, dass es ihm gegeben war, diese letzte Wahrheit zu erfahren.
Alles, die ganze Welt war den Gedichten gleichgestellt: Die Arbeit, das Pferdegetrappel, das Haus, der Vogel, der Fels, die Liebe – das ganze Leben ging leicht in die Verse ein und fand dort bequem Platz. Und das musste auch so sein, denn die Verse waren das Wort.
Die Strophen stellten sich auch jetzt leicht ein, eine nach der anderen, und obwohl er seine Gedichte schon lange nicht mehr aufschrieb und nicht mehr aufschreiben konnte, stellten sich die Worte doch leicht in einem vorgegebenen und jedes Mal erstaunlichen Rhythmus ein. Der Reim war das Suchinstrument, das Werkzeug einer magnetischen Suche nach Worten und Begriffen. Jedes Wort war Teil der Welt, es antwortete auf den Reim, und die ganze Welt sauste mit der Schnelligkeit einer elektronischen Maschine vorüber. Alles schrie: Nimm mich. Nein, mich. Er musste nichts suchen. Er musste nur verwerfen. Hier gab es sozusagen zwei Menschen – den, der dichtet, der seinen Kreisel nach Kräften rotieren lässt, und den anderen, der auswählt und die rotierende Maschine von Zeit zu Zeit anhält. Und als er sah, dass er zwei Menschen ist, begriff der Dichter, dass er jetzt wirkliche Verse macht. Und was heißt es schon, dass sie nicht aufgeschrieben sind? Aufschreiben, gedruckt werden – das ist eitel. Was nicht ohne Eigennutz entsteht – das ist nicht das Beste. Das Allerbeste ist, was nicht aufgeschrieben wird, das verfasst wird und verschwindet, spurlos vergeht, und nur die Schaffensfreude, die er empfindet und die mit nichts zu verwechseln ist, beweist, dass ein Gedicht geschaffen, dass Schönheit geschaffen ist. Irrt er sich nicht? Kann er der Schaffensfreude vertrauen?
Er erinnerte sich, wie schlecht, wie poetisch hilflos Bloks letzte Gedichte waren und dass Blok das wohl nicht begriffen hat …
Der Dichter zwang sich innezuhalten. Das war einfacher hier als irgendwo in Leningrad oder Moskau.
Und jetzt ertappte er sich dabei, dass er schon lange an nichts mehr dachte. Das Leben trat wieder aus ihm heraus.
Lange Stunden lag er regungslos, und plötzlich sah er ganz nah so etwas wie eine Zielscheibe oder eine geologische Karte. Die Karte war stumm, und er versuchte vergeblich, das Dargestellte zu verstehen. Es verging einige Zeit, bis er begriff, dass es seine eigenen Finger waren. An den Fingerspitzen waren noch braune Spuren der Machorka-Papirossy, die er aufgeraucht, ausgesaugt hatte – auf den Fingerkuppen zeichnete sich deutlich das daktyloskopische Muster ab, wie die Karte eines Bergreliefs. Das Muster war auf allen zehn Fingern gleich, kleine konzentrische Kreise, wie der Querschnitt durch einen Baum. Er erinnerte sich, wie ihn einmal als Kind auf dem Boulevard ein Chinese aus der Wäscherei anhielt, die im Keller jenes Hauses lag, in dem er aufwuchs. Der Chinese nahm ihn zufällig bei der einen Hand, bei der anderen, drehte die Handflächen nach oben und schrie erregt etwas in seiner Sprache. Es zeigte sich, dass er den Jungen zum Glückspilz erklärte, zum Besitzer eines verlässlichen Omens. An dieses Glückszeichen hatte der Dichter immer wieder gedacht, besonders oft, als er sein erstes Buch veröffentlichte. Heute dachte er an den Chinesen ohne Erbitterung und ohne Ironie – ihm war alles egal.
Das Wichtigste war, dass er noch nicht gestorben war. Was heißt das übrigens: gestorben wie ein Dichter? Etwas kindlich Naives muss in diesem Tod sein. Oder etwas Mutwilliges, Theatralisches wie bei Jessenin, bei Majakowskij.
Gestorben wie ein Schauspieler – das ist noch verständlich. Aber gestorben wie ein Dichter?
Ja, er ahnte einiges davon, was ihm bevorstand. Während der Etappe hatte er schon vieles verstehen und erahnen können. Und er freute sich, freute sich still seiner Kraftlosigkeit und hoffte, dass er sterben würde. Er erinnerte sich an den uralten Streit im Gefängnis: Was ist schlimmer, was ist schrecklicher – Lager oder Gefängnis? Niemand wusste wirklich etwas, die Argumente waren spekulativ, und wie grausam lächelte ein Mann, der aus dem Lager in jenes Gefängnis gebracht worden war. Das Lächeln dieses Mannes hatte er sich für immer gemerkt, so sehr, dass er die Erinnerung daran fürchtete.
Denken sie, wie geschickt er sie betrügen wird, jene, die ihn hergeschafft haben, wenn er jetzt stirbt – um ganze zehn Jahre. Er war vor einigen Jahren verbannt gewesen und wusste, er steht für immer auf speziellen Listen. Für immer?! Die Maßstäbe haben sich verschoben und die Worte ihren Sinn verändert.
Wieder spürte er eine kommende Kräfteflut, tatsächlich eine Flut wie im Meer. Eine vielstündige Flut. Und dann ein Abebben. Doch das Meer geht ja von uns nicht für immer fort. Er wird sich noch erholen.
Plötzlich hätte er gern gegessen, doch ihm fehlten die Kräfte, sich zu rühren. Er erinnerte sich langsam und mühsam, dass er die heutige Suppe dem Nachbarn gegeben hatte, dass ein Becher heißes Wasser seine einzige Nahrung gewesen war den letzten Tag. Außer dem Brot, natürlich. Doch das Brot hatten sie vor langer, langer Zeit verteilt. Und das von gestern – gestohlen. Jemand hatte noch Kräfte genug, um zu stehlen.
So lag er, leicht und gedankenlos, bis der Morgen kam. Das elektrische Licht wurde ein wenig gelber, und auf großen Sperrholzbrettern wurde Brot gebracht, so wie jeden Tag.
Doch er regte sich nicht mehr auf, spitzte sich nicht mehr auf das Endstück, weinte nicht, wenn es ein anderer bekam, stopfte sich nicht mit zitternden Fingern die Zuwaage in den Mund, die Zuwaage, sie zerging sofort im Mund, während seine Nasenflügel sich blähten und er mit seinem ganzen Wesen den Geschmack und den Duft des frischen Roggenbrots aufnahm. Die Zuwaage war schon nicht mehr im Mund, obwohl er gar nicht hatte schlucken oder den Kiefer bewegen können. Das Stück Brot war zergangen, verschwunden, und das war ein Wunder – eines der vielen hiesigen Wunder. Nein, jetzt regte er sich nicht auf. Doch als man ihm seine Tagesration in die Hände legte, umfasste er sie mit den blutleeren Fingern und presste das Brot an den Mund. Er biss das Brot mit den Skorbutzähnen, das Zahnfleisch blutete, die Zähne wackelten, doch er spürte keinen Schmerz. Mit aller Kraft presste er das Brot an den Mund, stopfte es sich in den Mund, lutschte es, riss und nagte …
Seine Nachbarn hielten ihn zurück.
»Iss nicht alles auf, lass es für später, später …«
Und der Dichter verstand. Er öffnete die Augen weit, ohne das blutige Brot aus den schmutzigen bläulichen Fingern zu lassen.
»Wann später?«, sprach er deutlich und klar. Und schloss die Augen.
Gegen Abend war er tot.
Doch von der Liste gestrichen wurde er erst nach zwei Tagen – den erfinderischen Nachbarn war es gelungen, bei der Brotverteilung zwei Tage das Brot des Toten zu erhalten; der Tote hob die Hand wie eine Marionette. Also war er schon vor seinem Todesdatum gestorben – ein nicht unwichtiges Detail für seine künftigen Biografen.
1958
Kinderbildchen
Man trieb uns ganz ohne Listen zur Arbeit, am Tor wurden Fünfergruppen abgezählt. Wir traten immer zu fünfen an, denn längst nicht alle Begleitposten waren sicher in der Anwendung des Einmaleins. Jede Rechenoperation, im Frost auszuführen und noch dazu an lebendigem Material, ist eine heikle Sache. Der Kelch der Häftlingsgeduld kann plötzlich überlaufen, und die Leitung kalkulierte das ein.
Heute hatten wir leichte Arbeit, Ganoven-Arbeit – Holzmachen an der Kreissäge. Die Säge drehte sich in der Bank und tackerte leicht. Wir wälzten einen gewaltigen Block auf den Tisch und schoben ihn langsam zur Säge vor.
Die Säge kreischte und knurrte grimmig – sie mochte die Arbeit im Norden so wenig wie wir, doch wir schoben den Block immer weiter voran, und da zerfiel der Block in zwei Teile, überraschend leichte Stücke.
Unser dritter Kamerad spaltete das Holz mit einem schweren bläulichen Beil mit langem gelben Stiel. Dicke Klötze behaute er von den Rändern her, die dünneren durchschlug er mit dem ersten Hieb. Die Hiebe waren schwach – unser Kamerad war genauso ausgehungert wie wir, doch gefrorene Lärche hackt sich leicht. Die Natur des Nordens ist nicht gleichgültig, nicht teilnahmslos – sie steht mit jenen im Einvernehmen, die uns hierher geschickt haben.
Wir beendeten die Arbeit, stapelten das Holz und warteten auf den Begleitposten. Wir hatten ja einen Posten dabei, er wärmte sich in dem Büro, für das wir das Brennholz sägten, doch nach Hause zurückkehren mussten wir in voller Parade – im ganzen Trupp, der in der Stadt zu Grüppchen zerschlagen wurde.
Nach beendeter Arbeit gingen wir uns nicht wärmen. Schon längst hatten wir in der Nähe des Zauns einen großen Müllhaufen bemerkt – so etwas lässt man sich nicht entgehen. Meine beiden Kameraden untersuchten den Haufen geschickt und routiniert, indem sie eine der vereisten Schichten nach der anderen abtrugen. Gefrorene Brotstücke, zum Eisklumpen verklebte Koteletts und zerrissene Männersocken waren ihre Beute. Das Wertvollste waren natürlich die Socken, und ich bedauerte, dass nicht ich diesen Fund gemacht hatte. Freie – »zivile« – Socken, Schals, Handschuhe, Hemden oder Hosen waren eine große Kostbarkeit unter Leuten, die jahrzehntelang nur Staatssachen getragen hatten. Die Socken konnte man stopfen und flicken – dann hatte man Tabak, dann hatte man Brot.
Der Erfolg der Kameraden stachelte mich an. Auch ich trat und brach mit Füßen und Händen verschiedenfarbige Stücke des Müllbergs ab. Unter irgendeinem Lumpen, der aussah wie menschliches Gedärm, sah ich – zum ersten Mal seit vielen Jahren – ein graues Schülerheft.
Das war ein gewöhnliches Schulheft, ein Zeichenheft für Kinder. Sämtliche Seiten waren mit Farbstiften ausgemalt, sorgsam und genau. Ich blätterte in dem frostspröden Papier, den reifbedeckten bunten und kalten naiven Blättern. Auch ich hatte einmal gemalt – das war lange her – am Esstisch hockend, bei der Dreiviertelzoll-Petroleumlampe. Von der Berührung mit den Zauberpinseln erwachte der tote Recke aus dem Märchen, wie mit lebendigem Wasser besprüht. Die Aquarellfarben, die aussahen wie Damenknöpfe, lagen in einer weißen Blechkiste. Iwan Zarewitsch galoppierte auf einem grauen Wolf durch den Tannenwald. Die Tannen waren kleiner als der graue Wolf. Iwan Zarewitsch saß auf dem Wolf, wie die Ewenken auf Rentieren reiten, mit den Fersen fast das Moos berührend. Ein Rauchsäulchen schraubte sich in den Himmel hinauf, und in den blauen Sternenhimmel waren, wie Häkchen, Vögelchen gesetzt.
Und je stärker ich mich an meine Kindheit erinnerte, umso deutlicher wurde mir, dass sich meine Kindheit nicht wiederholen wird, dass ich in einem fremden Kinderheft auch nicht eine Spur davon wiederfinde.
Das war ein grausames Heft.
Die nördliche Stadt war aus Holz gebaut, Zäune und Hauswände waren in hellem Ocker gestrichen, und der Pinsel des jungen Künstlers wiederholte diese gelbe Farbe redlich überall, wo der Junge von Stadthäusern sprechen wollte, vom Werk einer menschlichen Hand.
In dem Heft gab es viele, sehr viele Zäune. Fast auf jeder Zeichnung waren Menschen und Häuser von gelben, ordentlichen Zäunen umgeben, um die sich die schwarzen Linien des Stacheldrahts wanden. Die Eisendrähte nach staatlichem Vorbild bedeckten in dem Kinderheft sämtliche Zäune.
Am Zaun standen Leute. Die Menschen in diesem Heft waren weder Bauern noch Arbeiter noch Jäger – sie waren Soldaten, sie waren Begleit- und Wachposten mit Gewehren. Die Regenschutz-Pilze, neben denen der junge Künstler Begleiter und Wachposten platzierte, standen am Fuß von riesigen Wachtürmen. Auch auf den Wachtürmen patrouillierten Soldaten und blinkten Gewehrläufe.
Das Heft war nicht groß, doch der Junge hatte darin sämtliche Jahreszeiten seiner Heimatstadt malen können.
Eine leuchtende Erde, monochrom grün wie auf den Bildern des frühen Matisse, und ein tiefblauer Himmel, frisch, sauber und klar. Die Sonnenunter- und -aufgänge waren gediegen rot, und das lag nicht an der kindlichen Unfähigkeit, mittlere Töne, farbliche Übergänge zu finden und die Geheimnisse des Helldunkel zu ergründen.
Die Verbindung der Farben im Schulheft war eine korrekte Darstellung des Himmels des Hohen Nordens, dessen Farben ungewöhnlich rein und klar sind und keine mittleren Töne kennen.
Mir fiel die alte nördliche Legende ein, dass Gott noch ein Kind war, als er die Tajga erschuf. Es gab wenige Farben, die Farben waren kindlich rein, die Zeichnungen einfach und klar, ihr Gegenstand schlicht.
Später, als Gott heranwuchs und erwachsen wurde, lernte er die bizarren Muster des Laubwerks schnitzen und ersann eine Menge vielfarbiger Vögel. Er war die Kinderwelt leid, und er überschüttete seine Tajgaschöpfung mit Schnee und ging für immer in den Süden. So sagt es die Legende.
Auch in den Winterzeichnungen hatte sich das Kind von der Wahrheit nicht entfernt. Das Grün war verschwunden. Die Bäume waren schwarz und nackt. Es waren Dahurische Lärchen, nicht die Kiefern und Fichten meiner Kindheit.
Eine nördliche Jagd: Ein bissiger deutscher Schäferhund zieht an der Leine, die Iwan Zarewitsch hält. Iwan Zarewitsch trägt eine Militärmütze mit Ohrenklappen, einen weißen Schafshalbpelz, Filzstiefel und lange Handschuhe, »