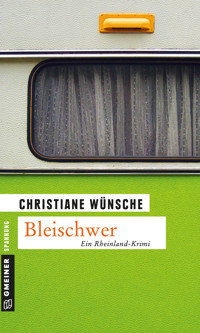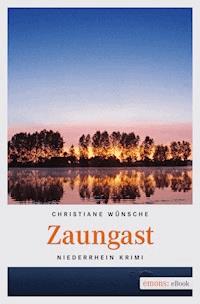14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wir erben, wenn wir erben Eine winzige Rheininsel, Fluch und Segen einer Erbschaft und eine bewegende Suche nach Identität Die Schwestern Marlene, Esther und Nicole erleben, wie die Aussicht auf eine Erbschaft auch höchst Unliebsames zu Tage fördert: Neid, Misstrauen, längst vergessen geglaubte Erinnerungen und das gut gehütete Lebensgeheimnis der Erblasserin und ihres vor Jahrzehnten verstorbenen Ehemanns. Ihre Tante Klara hat ihren sechs Nichten und Neffen ihr altes Haus auf der Insel Hohenwerth und ihren gesamten Besitz vermacht, zu gleichen Teilen allerdings auch einem völlig Unbekannten, ihrer großen Liebe. Marlene und ihre Schwestern müssen sich fragen, was sie hier eigentlich erben und wie hoch der Preis ist, den sie alle zu zahlen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christiane Wünsche
Es bleibt doch in der Familie
Roman
Über dieses Buch
Tante Klara ist hochbetagt verstorben. Ihr Haus auf der Rheininsel und ihren gesamten sonstigen Besitz vermachte sie ihren Nichten Marlene, Esther und Nicole, deren Zwillingsbruder Andi, der in Australien lebt, sowie ihren beiden Neffen Michael und Jochen und einem für ihre Verwandten völlig Unbekannten: ihrer großen Liebe. Die drei Schwestern sind entsetzt. Sie finden die Verteilung höchst ungerecht und erfahren bald schmerzhaft, dass ein Erbe nicht nur ein Glück, sondern auch eine Last sein kann. Es droht sogar ihre Verbindung zueinander zu zerreißen. Neid, Missgunst und Misstrauen scheinen die Oberhand zu gewinnen. Alle begeben sich auf Spurensuche. Marlene findet im Haus ein Tagebuch von Peter, Klaras vor Jahrzehntem verstorbenen Mann. Peters Lebensgeheimnis und Klaras Wunsch nach einer gemeinsamen Entscheidung der sieben Erben stellen alle auf eine harte Probe.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christiane Wünsche wurde 1966 in Lengerich in Westfalen geboren, aber schon kurze Zeit später zog die Familie nach Kaarst am Niederrhein. Mit zwanzig begann Christiane Wünsche ihr Studium in der Großstadt, dennoch blieb sie der Heimat eng verbunden. Seit 1991 wohnt sie wieder in Kaarst, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihren Romanen »Aber Töchter sind wir für immer« und »Heldinnen werden wir dennoch sein« gelang Christiane Wünsche auf Anhieb der Einstieg auf die Bestseller-Liste.
Impressum
Dieses Buch ist ein Roman. Ähnlichkeiten mit realen Personen und ihren Erlebnissen sind rein zufällig. Regionale Gegebenheiten wurden für die Glaubwürdigkeit der Geschichte verfremdet, Orte erfunden, so vor allem die Insel Hohenwerth. Sie existiert – leider – nur in der Phantasie.
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Redaktion: Dr. Uta Dahnke
Covergestaltung: semper smile, München
Coverabbildung: plainpicture / mia takahara und shuttertock
ISBN 978-3-10-492161-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
Insel Hohenwerth 1955
Insel Hohenwerth, Sommer 1980
Letzte Worte
Marlene, heute
Esther
Nicky
Marlene
Esther
Nicky
Marlene
Esther
Marlene
Nicky
Spekulationen und Gerüchte
Aus der Geschichte der Insel Hohenwerth
Esther
Jochen
Nicky
Marlene
Bad Honnef, 1955
Marlene
Hohenwerth, Frühjahr 1956
Marlene
Nicky
Marlene
Ein Erbe anderer Art
Marlene
Nicky
Esther
Marlene
Nicky
Marlene
Marlene
Esther
Nicky
Sinnsuche
Marlene
Nicky
Esther
Marlene
Nicky
Marlene
Esther
Marlene
Esther
Marlene
Jochen
Esther
Marlene
Marlene
Esther
Jochen
Esther
Marlene
Das wahre Erbe
Nicky
Marlene
Esther
Marlene
Nicky
Marlene
Nicky
Marlene
Esther
Jochen
Die Bürde
Esther
Marlene
Nicky
Marlene
Esther
Nicky
Marlene
Jochen
Esther
Marlene
Insel Hohenwerth, April 1958
Marlene
Esther
Wie gewonnen
Esther
Marlene
Insel Hohenwerth, kurz vor Ablauf der Frist
Esther
Epilog
[Motto]
Nachwort und Dank
Für uns Babyboomer,
gestandene Persönlichkeiten
in einer sich wandelnden Welt.
Lasst uns offen und neugierig bleiben!
Du kannst nichts festhalten,
wenn du gehst.
Du kannst nur loslassen und hoffen.
Christiane Wünsche
Prolog
Insel Hohenwerth 1955
Die junge Frau saß am Kiesstrand der Insel auf einem Findling und fröstelte in ihrer Strickjacke. Kalter Herbstwind drang durch die groben Maschen. Auch die hinter ihr aufragende mächtige Trauerweide bot kaum Schutz. Ihre Zweige, die an ruhigen Tagen wie silbriges Lametta herabhingen, peitschten, wenn der Wind böig auffrischte, durch die Luft.
Peter schien das Wetter nicht zu stören. Von ihr abgewandt, stand er mit hochgekrempelten Hosenbeinen im Flussbett des Rheins und ließ einen flachen Kiesel flitschen. Der Stein kam auf der Oberfläche auf, schnellte wieder hoch und beschrieb auf die Weise fünf weite Bögen über dem grauen Strom, bevor er schließlich einschlug und versank.
Die Neunzehnjährige war immer noch verwundert, dass Peter sie ausgerechnet an diesem ungemütlichen Sonntag Ende Oktober dazu gedrängt hatte, mit ihm zu der kleinen Rheininsel zu rudern. Allein der ernste Unterton in seiner Stimme, der sie fremd und viel erwachsener klingen ließ, als er mit seinen zwanzig Jahren war, hatte sie dazu bewogen, ihm den Gefallen zu tun.
»Nicht schlecht«, rief sie ihm durch das Brausen des Flussröhrichts zu, das die Bucht säumte. »Aber du warst sonst besser. Hast du es nicht bis zu siebenmal geschafft?«
»Kann schon sein.«
Wieder der besorgniserregende Unterton. Sie zwirbelte das Ende ihres geflochtenen Zopfes und saugte daran. Es war eine schlechte Angewohnheit, die sie trotz der Ermahnungen ihrer Mutter einfach nicht lassen konnte, wenn sie nervös war.
Jetzt drehte Peter sich zu ihr um, und das Zopfende fiel ihr vor Schreck aus dem Mund. Er weinte. Lautlos rannen Tränen über seine Wangen.
»Meine Eltern schicken mich zum Studium nach Konstanz. Und sie wollen mich enterben, noch bevor ich volljährig werde.« Mit hängenden Armen stand er da, während der Strom um seine Waden floss.
»Warum das denn?«, fragte sie entsetzt. Vor kurzem hatte Peter ihr doch noch erzählt, dass er als Erstgeborener am Tag seiner Volljährigkeit einen Großteil des Vermögens seiner Eltern überschrieben bekommen würde. Das sei alte Familientradition und ein bewährter Weg, die Besitztümer zusammenzuhalten. Zum Familienvermögen gehörten, soweit sie wusste, neben gut gefüllten Bankkonten einige Mietshäuser in Bonn, die vom Bombenhagel im Herbst 1944 wie durch ein Wunder verschont geblieben waren, die Brombachvilla und das halbverfallene Haus hier auf Hohenwerth.
Sie kannte Peter zwar erst seit ein paar Monaten – so lange, wie das Haushaltsjahr bei seiner Familie bislang währte, das sie für ihre Ausbildung benötigte –, doch hatte sie ihn schon liebgewonnen wie einen Bruder. Vielleicht sogar mehr als das. Sie sah ihn so gern an. Sein Wesen rührte sie und brachte etwas in ihr zum Klingen.
Sie sprang auf, wollte sich gerade die Schuhe von den Füßen streifen, um zu ihm zu laufen, als Peter ihr zuvorkam, an den Strand watete und dicht vor ihr stehen blieb.
»Warum wohl?« Er verzog sein liebes Gesicht zu einer verzweifelten Grimasse. »Weil ich Mutter vorgestern gebeichtet habe, dass ich lieber hierbleiben und eine Lehre zum Goldschmied machen möchte, statt Jura zu studieren. Und weil ich nicht so bin, wie sie sich einen Sohn vorstellen, schon gar nicht ihren erstgeborenen.«
Sie sah ihn verständnislos an.
»Sie glauben, dass mit mir was nicht stimmt und ich der Aufgabe nicht gewachsen bin, einmal das Familienoberhaupt zu werden. Dann wollen sie lieber Rudi …« Seine Stimme brach.
Wie betäubt schüttelte sie den Kopf. Sie war es, die ihm dazu geraten hatte, seinen Eltern endlich von seinen Zukunftsvisionen zu erzählen. Die Schuldgefühle schlugen über ihr zusammen. Wie hatte sie nur glauben können, dass es ihm gelingen würde, sich gegen seine Eltern, insbesondere seinen Vater, durchzusetzen? Vor ihrem geistigen Auge erschien die Gestalt des hünenhaften gestrengen Richters Brombach. Gegen ihn, dessen Urgewalt sie an die riesige Weide hinter ihr erinnerte, war Peter ein zarter Halm im Wind, dünner als jedes Schilfrohr.
Sie nahm ihn in die Arme. Er brauchte sie jetzt. Sie musste ihm beistehen. Ihn stark machen.
»Dann pfeif auf das Erbe und mach trotzdem die Lehre«, sagte sie daher eindringlich und drückte ihn an sich, bevor sie ihn auf Armlänge von sich schob, um ihm in die Augen sehen zu können.
Sie selbst kam aus einem Elternhaus mit bescheidenen Mitteln. Ihr Vater verdiente das Geld für die fünfköpfige Familie als Küster in einer Düsseldorfer Kirche. Lisbeth, Martha und sie lebten mit ihren Eltern in der beengten Dienstwohnung über dem Gemeindehaus. Diese hatten ihre drei Töchter gelehrt, dass Zusammenhalt und christliche Werte im Leben weit mehr zählten als materieller Wohlstand. Und es war ihnen ein Bedürfnis, dass alle drei Berufe ergriffen, die sowohl sinnstiftend waren als auch ihren Talenten entsprachen.
Sie, die Älteste, wollte Kindergärtnerin werden. Reichtümer würde sie mit ihrer Arbeit wohl nie anhäufen, aber das war ihr immer gleichgültig gewesen.
Bislang. Denn seit sie in der Villa der Brombachs putzte, nähte und bei der Betreuung von Peters jüngeren Geschwistern half, war ihr aufgegangen, dass Geld allein vielleicht nicht glücklich, aber das Leben doch wesentlich einfacher machte.
Die Brombachs mussten jedenfalls weder jeden Groschen zweimal umdrehen noch im Garten Gemüse anbauen, um satt zu werden. Im Gegenteil: Ihre Vorratskammer war wie durch ein Wunder stets gut gefüllt, und es kamen fette Speisen auf den Tisch. Außerdem stand in ihrem Saal ein herrlicher schwarz glänzender Steinway-Flügel, auf dem sie liebend gern einmal ihren Beethoven gespielt hätte.
Im Laufe der Monate bei den Brombachs bröckelten ihre hehren Grundsätze. Inzwischen stellte sie es sich wunderbar vor, zu den Reichen dieses Landes zu gehören, das sich nur langsam von den Auswirkungen des Krieges erholte.
Angesichts von Peters Elend sah sie sich nun jedoch plötzlich auf ihre ursprünglichen Ansichten zurückgeworfen. Geborgen und geliebt aufzuwachsen, so wie es ihr selbst vergönnt gewesen war, war doch allemal wichtiger als alles Geld der Welt!
Sie ballte vor Empörung die Fäuste. »Wenn sie dich nicht lieben, wie du bist, sind sie daran schuld, nicht du!«, stieß sie aus. »Du bist nicht dafür geboren worden, ihnen zu gefallen. Leb dein Leben. Mach dein Glück auf deine Weise!«
Ihre Worte schienen Peter nicht zu erreichen. Seine Züge wurden verschlossen. »Du verstehst mich nicht«, erwiderte er düster. »Meine Eltern hassen mich. Und ihre Entscheidung ist gefallen.« Für einen erschreckenden Moment – bevor er wieder zu dem lieben Gefährten wurde, den sie so mochte – ähnelte er auf einmal seinem grimmigen Vater.
Sie runzelte die Stirn und ließ sich wieder auf den Stein fallen. »Und das alles haben sie dir wirklich einfach so mitgeteilt?«
»Mitgeteilt?« Er spie das Wort aus wie Galle. »Gar nichts haben sie mir mitgeteilt.«
»Aber …« Sie kapierte gar nichts mehr.
Er ging vor ihr in die Hocke, seine nackten Zehen gruben sich in den Sand. Das hellblonde Haar war windzerzaust. Zärtlichkeit wallte in ihr auf.
»Ich habe sie belauscht«, gab er kleinlaut zu.
»Ach.«
Peter wich ihrem Blick aus, als habe er ihre Gedanken gelesen. »Nicht die feine Art, ich weiß.«
Er federte wieder hoch, fuhr sich mit einer Hand durch die Locken, die sich weich um seine Finger wanden.
»Vielleicht hast du ja was falsch verstanden«, wandte sie vorsichtig ein.
Peter lachte trocken auf. »Nein, sicher nicht!«
Sie wartete darauf, dass er weitersprach, doch in dem Moment näherte sich auf dem Rhein ein großer, langer Frachtkahn, vollbeladen mit Kohle. Laut stampfend, fuhr er an der kleinen Insel vorbei. Wellen rollten über den Kies und spülten Muscheln an Land. Eine Schar Enten flatterte in die Luft.
Erst als der Lärm abebbte, fuhr ihr Freund fort.
»Gestern Abend, als Mutter und Vater von einem Empfang zurückkamen und die Eingangshalle betraten, ging ich oben über die Galerie. Ich hatte gerade nachgeguckt, ob Sophie, Rudi und Berti schliefen, und um die drei bloß nicht zu wecken, hatte ich das Licht ausgelassen.« Er sah sie kurz an, schluckte. »Ich wollte also in mein Zimmer zurückgehen, als ich Vater unten schimpfen hörte. Gleichzeitig krachte etwas laut. Ich erschrak, spähte über das Geländer. Vater hatte seinen Hut so heftig auf die Kommode geworfen, dass der Kandelaber umgefallen war. Mutter versuchte, ihn zu beruhigen, und mahnte ihn, an die schlafenden Kinder zu denken. Sie stellte den Kerzenleuchter wieder auf. Dann half sie Vater aus dem Mantel.
Er aber wetterte, dass das Maß jetzt endgültig voll sei. Ich dachte natürlich, dass er sich über die Leute aufregte, die Mutter und er am Abend getroffen hatten, und wollte mich verdünnisieren. Da erwähnte er meinen Namen, und ich stand stocksteif da.« Peters Atem ging stoßweise. Es fiel ihm offenbar schwer weiterzusprechen.
»Ich sei einfach nicht ganz richtig im Kopf, sagte Vater, und das müsse endlich Konsequenzen haben. Mutter gab zurück, dass meine Probleme nichts mit meinem Kopf, sondern mit …« Wieder stockte Peter. Er wurde knallrot. »… mit meinem Gemüt zu tun hätten, und drängte ihn dazu, sie ins Wohnzimmer zu begleiten. Dann schloss sich die Tür hinter ihnen.«
»Und du bist dir wirklich sicher, dass du nichts falsch verstanden hast?«
Sie bedauerte, außer Haus gewesen zu sein. Andernfalls wäre es ihre Aufgabe gewesen, nach Peters kleinen Geschwistern zu sehen, und ihr Freund hätte nichts von dem Gespräch der Eltern mitbekommen. Aber sie hatte ihr freies Wochenende bei ihrer Familie in Düsseldorf verbracht und war erst heute Morgen mit dem D-Zug zurückgefahren.
Peter schüttelte heftig den Kopf. »Nein«, sagte er müde. »Ich habe mich nämlich runtergeschlichen und mein Ohr an die Wohnzimmertür gelegt. Sie wollen mich enterben und fortschicken, weil ich eine Schande für sie bin. Ihre Entscheidung steht. Aber das ist nicht das Schlimmste und auch nicht ihre Verachtung, die ich ja von klein auf kenne«, er kaute auf seiner Unterlippe, »sondern, dass ich dann für eine Ewigkeit nicht wieder auf die Insel kommen kann. Das Haus auf der Höh’ hier auf Hohenwerth ist mein Rückzugsort. Ich brauche es wie die Luft zum Atmen. Du weißt das.« Seine Stimme wurde zittrig, er deutete mit dem Kopf vage in Richtung des Hügels, auf dem das Gebäude stand. »Nur da oben, in meinem Atelier, fühle ich mich heil. Nur dort kann ich mich erholen, wenn …« Er brach ab. »Noch vor meinem Geburtstag wollen sie mir ihre Entscheidung verkünden und mich dann schnellstmöglich fortschicken.«
Erschrocken hielt sie die Luft an. Sein Geburtstag war nächste Woche. Endlich begriff sie das Ausmaß der Katastrophe. Peter war der sensibelste junge Mann, der ihr je begegnet war. Er würde daran zerbrechen.
»Das dürfen sie nicht«, flüsterte sie.
»Und ob sie das dürfen!« Peter richtete seinen Blick auf die Anhöhe der Insel, schaute dorthin, wo das Haus stand. »Darum müssen sie ihre Entscheidung zurücknehmen«, begehrte er verzweifelt auf, um anschließend wieder mutlos in sich zusammenzufallen. »Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wie ich das hinkriegen soll.«
Sie schluckte, fühlte sich immer noch schuldig an dem ganzen Desaster. Dann aber kam ihr plötzlich ein geradezu verwegener Gedanke. Wie ein Kiesel flitschte er über die Oberfläche ihrer Seele.
»Ich aber«, erwiderte sie zögernd. Der Impuls entsprang einerseits ihrem Wunsch, ihm zu helfen, andererseits ihrer Abenteuerlust, die sie immer wieder dazu brachte, unvernünftige Dinge zu tun.
Den dritten Grund mochte sie sich kaum eingestehen: Das Bild, wie sie an dem Steinway-Flügel saß und hingebungsvoll Beethoven spielte, stand ihr vor Augen, und eine Gänsehaut breitete sich auf ihren Armen aus.
»Ich habe eine Idee«, sagte sie.
Insel Hohenwerth, Sommer 1980
»Also, ich finde die Zeitumstellung super«, schwärmte die zwölfjährige Esther, streckte sich auf der alten, mit Rattan bespannten Gartenliege aus, die bei jeder Bewegung knarrte, und leckte genüsslich an ihrem Dolomiti. Tante Klara hatte immer die leckersten Eissorten in ihrer Tiefkühltruhe. »So können wir hier abends um neun noch sitzen, und es ist taghell.«
Die zwei Jahre ältere Marlene, die sich barfüßig in einem Gartenstuhl lümmelte und sich für ein Ed von Schleck entschieden hatte, ließ den Blick über die weitläufige Rasenfläche, an den knorrigen Obstbäumen entlang bis zum Haus schweifen, wo unter der mit Wein berankten Pergola ihre Mutter, Tante Klara und Tante Martha beisammensaßen und Pfirsichbowle aus Kristallgläsern schlürften. Ab und an wehten ihre Stimmen und ihr Gelächter zu den Jugendlichen herüber. »Ich fände es viel gemütlicher, wenn es jetzt schon dunkel wäre«, gestand sie. »Wir haben sowieso Ferien und dürfen bis in die Puppen aufbleiben. Und so eine laue Sommernacht unterm Sternenhimmel finde ich klasse.«
Ihr Cousin Michael, in etwa so alt wie Marlene, stimmte ihr zu. »Total doof, dass es immer noch so hell ist. Ich würde nämlich echt gern eine rauchen. Aber wir sitzen hier ja wie auf dem Präsentierteller.« Er deutete mit dem ausgestreckten Finger in Richtung der drei feiernden Frauen. Michael saß quer auf einer Gartenliege neben seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Jochen. Michaels kräftige Beine, die gebräunt aus den Jeansshorts lugten, wiesen an den Knien großflächige, nur langsam verheilende Blessuren auf. Er sei zu Hause mit dem Mofa auf einem Schotterweg ausgerutscht und habe geblutet wie ein Schwein, hatte er seinen Cousinen geradezu stolz berichtet. Dabei durfte er noch nicht mal fahren, das war gesetzlich erst erlaubt, wenn man fünfzehn war.
Der blasse, zarte Jochen mit den stockdünnen Armen, der garantiert noch nie verbotenerweise ein Mofa gefahren hatte, hockte gekrümmt im gelben Trägerhemd und ebenfalls kurzer Hose an seiner Seite. Auf seinem Schoß lag ein dicker Schmöker, von dem er sich anscheinend nicht mal jetzt trennen konnte. Als einziger der vier Jugendlichen hielt er kein Eis in der Hand. Er war insgesamt ein schlechter Esser, sagte seine Mutter, Marlenes und Esthers Tante Martha, jedes Mal, wenn er sich wieder einmal bei den leckersten Sachen verweigerte.
Nicht mal Süßigkeiten vermochten ihn zu locken. Marlene und Esther hatten sich schon darüber ausgetauscht, wie sehr Jochen sich seit dem letzten Sommer auf Hohenwerth verändert hatte. Aus dem meist gut gelaunten Jungen mit dem feinen Humor war ein richtiger Langweiler geworden.
»Die Zeitumstellung ist mir total egal«, sagte er jetzt mit seiner leisen Stimme. »Aber ob die wirklich was bringt, wie es die Wissenschaftler behaupten? Ich vermute eher, dass …«
Michael unterbrach ihn ungeduldig. »Wir können ja runter zur Bucht gehen und ein Feuerchen machen«, schlug er vor. »Ist doch viel schöner da als hier im Garten.«
Esther nickte. »Okay, gute Idee. Aber vorher muss ich noch nachgucken, ob die Zwillinge schlafen. Hab ich Mama versprochen.«
Nicole und Andreas, Marlenes und Esthers jüngere Geschwister, waren gerade mal sechs Jahre alt und lagen um die Uhrzeit natürlich längst im Bett.
Marlene und Esther wechselten sich während des alljährlichen zweiwöchigen Besuchs auf Hohenwerth, bei dem wie üblich weder ihr Vater noch ihr Onkel eingeladen waren, damit ab, ihrer Mutter bei der Betreuung der Zwillinge zur Hand zu gehen. So konnte die sich ihren beiden Schwestern widmen.
Die sommerlichen Treffen bei der kinderlosen Tante Klara hatte es schon gegeben, bevor ihre jüngeren Schwestern Lisbeth und Martha geheiratet und Familien gegründet hatten. Nach dem tragischen Tod von Klaras Mann vor über zwanzig Jahren hatten sie damit angefangen.
Jetzt leckte Esther den Stiel von ihrem Eis ab, ließ sich Michaels und Marlenes Abfall geben und lief über die Wiese zum Haus, das in der warmen Abendsonne aufleuchtete wie eine dicke weiße Kerze. »Komme gleich wieder«, rief sie den anderen über den Rücken zu. »Die zwei schlafen bestimmt längst tief und fest.«
Marlene bezweifelte das. Nicky und Andi waren sich oft spinnefeind und stritten dann wie die Kesselflicker. Oder aber sie heckten gemeinsam irgendeinen Unfug aus. In dem Fall waren sie urplötzlich ein Herz und eine Seele. Etwas dazwischen gab es nicht. Marlene fand, dass die zwei meist eine echte Landplage darstellten. Sie erhob sich steifbeinig und seufzte. Hoffentlich kehrte Esther bald zurück.
Wieder einmal fragte sie sich, warum ihre Mutter darauf bestand, dass die Zwillinge sich ein Schlafzimmer teilten – sogar hier in Tante Klaras Haus, in dem es leere Räume im Überfluss gab. Getrennt waren sie viel leichter in den Griff zu bekommen, glaubte Marlene.
Erst ungefähr eine Stunde später – nachdem Esther den Zwillingen noch eine Gutenachtgeschichte vorgelesen hatte, bei der sie endlich einschliefen – saßen ihre Schwester, sie und Michael auf dicken Findlingen rund um das flackernde Lagerfeuer in der Bucht. Inzwischen war die Sonne untergegangen. Wenige Meter von ihnen entfernt floss der Rhein behäbig und glitzrig dahin. Das strömende Wasser rauschte friedlich, hinter ihnen im Wald schrie ein Käuzchen.
Die Abendstimmung auf der winzigen Insel hatte etwas Verwunschenes und zugleich Exklusives, besonders hier in Ufernähe, wo die Lichter der Häuser von Rhöndorf genauso weit entfernt zu glimmen schienen wie die Sterne am Himmel.
Jochen hatte dennoch keine Lust gehabt mitzukommen. Er wolle lieber noch ein paar Seiten lesen, hatte er gemurmelt und war mit hochgezogenen Schultern und dem Buch im Arm ins Haus gegangen.
Also waren die drei anderen ohne ihn aufgebrochen.
Inzwischen rauchte Michael seine dritte Zigarette, und Esther probierte gerade die erste ihres Lebens. Ihr Cousin Michael war schon immer ihr großes Vorbild gewesen. Wenn einer wie er rauchte, musste das super sein.
Leider reizte der heiße Qualm ihre Kehle. Sie hustete heftig und warf die Kippe schnell ins Feuer. »Ich finde es sooo toll, dass wir alle wieder hier sind«, stieß sie nach mehrmaligem Räuspern aus. »Auf Ferien bei Tante Klara freue ich mich immer das ganze Jahr lang.«
Marlene nickte. Auch sie fieberte jedes Mal den zwei unbeschwerten Wochen auf Hohenwerth entgegen.
Ihre Familie – Weber hießen sie alle mit Nachnamen – bewohnte in einem Neusser Vorort ein schmales Reihenmittelhaus mit einem handtuchgroßen Garten, das längst noch nicht abbezahlt war. Teure Urlaube konnten sich ihre Eltern nicht leisten, weil der Kredit bedient werden musste und die Ölheizung Unsummen verschlang. Marlene und ihre Geschwister waren daran gewöhnt, nur ein kleines Taschengeld zu bekommen und selten zu verreisen. Die Ferien bei Tante Klara auf der idyllischen Rheininsel stellten daher eine willkommene Auszeit dar. Hohenwerth war eine Welt für sich, so fern vom Alltag, dass man sich fast einreden konnte, im Ausland zu sein.
Und Michael und Jochen waren für Marlene und Esther mehr als bloß irgendwelche Verwandten, eher gute Freunde, die man viel zu selten sah. Aber sie hatten sich verändert. Jochen zog sich immer öfter lesend zurück, und Michael fand sie eine Spur zu angeberisch.
»Na ja, ist schon ganz nett hier«, sagte er jetzt gedehnt und spuckte ins Feuer. »Aber zu Hause sind meine Jungs, meine Maschine und der Fußballverein. Und wir treffen uns in letzter Zeit immer mit ein paar Jugendlichen im Park, hören laut Mucke aus dem Ghettoblaster und so. Das ist echt cooler als Ferien am Arsch der Welt.«
Marlene und Esther kamen sich auf einmal kindisch vor und seltsam degradiert. Wann waren sie für ihren Cousin in die zweite Reihe gerückt? Sie wechselten einen irritierten Blick. Der Zauber von Hohenwerth, ja der Zauber ihrer Kindheit schien mit einem Schlag verflogen.
Teil I
Letzte Worte
Wer das Erbe
allein nach Prinzipien
von Freiheit und Gleichheit bewertet,
verkennt seine emotionale Bedeutung.
Jana C. Glaese, »Das Erbe geht um«, in: philosophie Magazin, Nr. 71, August/September 2023
Marlene, heute
Marlene war dabei, als Tante Klara ihren letzten Atemzug tat.
Auf einmal war es leise in dem schlichten Zimmer im Neusser Hospiz. Kein Röcheln mehr, kein sporadisches Heben und Senken des bis auf die Knochen abgemagerten Brustkorbs. Die plötzliche Stille summte laut in Marlenes Ohren.
Sie lauschte angestrengt. Ihre Augen ruhten lange auf dem bleichen, ausgemergelten Gesicht, auf den geschlossenen papiernen Augenlidern, der schmalen Nase, die im Alter immer schärfer geworden war, und den bläulich schimmernden, trockenen Lippen. Die Züge ihrer Tante blieben regungslos.
Das also war der Tod.
Marlene schluckte und löste widerstrebend ihre Hand aus Tante Klaras knöchernen Fingern.
»Jetzt hast du es geschafft, Klärchen«, flüsterte sie und fühlte sich so elend wie lange nicht mehr. Weinen konnte sie nicht, aber sie spürte, wie sich die Tränen in ihren Augen sammelten, bereit zu fließen, wenn sie es denn zuließ.
Loszulassen, das war Marlene schon immer furchtbar schwergefallen.
Sanft strich sie über das flusige weiße Haar ihrer Tante. Wie hatte sie diese Haarwolke, die den Kopf ihrer Tante umschwebte, geliebt. Ein Stöhnen drang zwischen Marlenes Zähnen hervor. Nie mehr würde sie Tante Klärchen auf sich zugehen sehen, nie mehr würde die Sonne durch ihr Haar scheinen und es zum Leuchten bringen.
Marlene sah Tante Klara bedauernd an und bekam unvermittelt eine Gänsehaut am ganzen Körper.
Schon wurde aus dem Menschen, der ihr ein Leben lang vertraut war, etwas ganz und gar Fremdes, Seelenloses, das ihrer liebenswerten Tante nur noch flüchtig ähnelte. Es verstörte Marlen zutiefst.
Sekunden später spürte sie den Trost, den sie eben noch wie eine Floskel heruntergeleiert hatte, wirklich und mit jeder Faser. »Jetzt hast du es geschafft.«
Marlenes Blick irrte durch den Raum. War Tante Klaras Seele hier noch irgendwo? Sie fröstelte.
»Mach es gut«, formten ihre Lippen steif. Erneut sah sie sich um. Auf dem rollbaren Beistelltisch stand ein Strauß der letzten Herbstrosen aus Tante Klaras Garten: lachsrosa und weiß. Marlene hatte sie gestern noch für Tante Klara geschnitten. Auf ihrer geliebten Insel.
Unter der Vase schaute der Umschlag mit dem handgeschriebenen Testament hervor. Tante Klara hatte es Marlene vor etwa vierzehn Tagen im Beisein zweier Nonnen, die im Hospiz arbeiteten, mit zittriger Stimme diktiert. Mit den Unterschriften der Frauen im weißen Habit war es somit rechtsgültig.
Bis jetzt hatte Marlene es irgendwie geschafft, weder an Klärchens letzten Willen noch an seine möglichen Folgen zu denken. Sie hatte sich darauf konzentriert, ihre Tante im Sterben zu begleiten und Abschied zu nehmen.
Doch nun konnte sie die Gedanken daran nicht länger verdrängen. Eine Aufgabe wartete auf sie. Eine ausgesprochen unangenehme Aufgabe.
Esther
Esther starrte Marlene ungläubig an. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, dass auch Nicky schockiert war über das, was sie beide eben zu hören bekommen hatten.
Sie stemmte sich in dem Sessel, dessen Sitzfläche so tief war, dass sofort ihr Rücken ächzte, ein Stück nach vorn und griff nach der Kopie des Testaments. Dabei hätte sie fast einen Stapel Notenblätter umgeworfen, der zwischen anderem Kram auf dem antiken Couchtisch lag.
Marlene war wirklich schrecklich unordentlich, schoss es ihr durch den Kopf: eine hervorragende Musikerin, aber hoffnungslos chaotisch.
Ihre Augen überflogen die Zeilen auf dem Blatt. Langsam schüttelte sie den Kopf. »Ich fass es nicht«, murmelte sie.
Ein Räuspern ließ sie den Kopf zu Nicky, der jüngsten der Schwestern, herumfahren. »War Tante Klara denn noch geistig da, als sie dir das diktiert hat?«, fragte diese mit dünner Stimme. »Ich meine, es ist doch total ungerecht. Andi hat sich nie um sie gekümmert. Wie auch, von Australien aus?« Bitterkeit ließ ihren Tonfall schärfer werden. Sie nahm es ihrem Zwillingsbruder immer noch übel, dass er sie verlassen und sein Glück in Down Under gefunden hatte. »Außerdem kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass Michael und Jochen sie je besucht hätten. Für die zwei wäre es doch wirklich ein Katzensprung gewesen …«
»Das stimmt, aber Klärchen …« Marlene brach ab, jedes Wort schien sie Kraft zu kosten. Dann setzte sie neu an. »Ihr ging es vor allem darum, ihre Schwestern zu bedenken. Mama und Tante Martha sind zwar schon tot, aber wir alle stehen stellvertretend für sie. Sie hielt es für richtig und gerecht, ihren Besitz zu gleichen Teilen zu vererben.«
Marlene blickte in die Runde; ihre Augen schienen jetzt in Tränen zu schwimmen. Fahrig griff sie nach ihrer Kaffeetasse in dem Durcheinander auf dem Tisch und trank einen Schluck.
»Aber Tante Martha ist doch schon zwanzig Jahre unter der Erde«, wandte Esther vernünftig ein, »während Mama erst vor sechs Jahren … Außerdem sind wir drei nun wirklich fast jedes Wochenende abwechselnd zu Tante Klara gefahren, weil sie doch so einsam war auf der Insel.«
Esther dachte an die mindestens einstündige Autofahrt von Düsseldorf nach Mehlem, von wo aus man mit dem Motorboot zu der länglichen Rheininsel fuhr. Das kleine bewaldete Eiland war ansonsten unbewohnt, nur Tante Klaras Haus stand dort auf der Anhöhe mitten in dem riesigen Garten.
Esther hatte es in den letzten Jahren zunehmend als Tortur empfunden, mit dem Motorboot überzusetzen. Vor allem vor der Strömung graute es ihr. Ein Fluss wie der Rhein konnte – gerade in Zeiten des sich beschleunigenden Klimawandels – eine ungeahnte Zerstörungskraft entwickeln. Das hatten die Naturkatastrophen der letzten Jahre mehr als deutlich gezeigt.
Esther war eine schlechte Schwimmerin und fühlte sich auf dem Wasser ausgeliefert. Wann war sie eigentlich so ängstlich geworden, fragte sie sich plötzlich. Wie dem auch sei, am liebsten fuhr sie zusammen mit ihrem Mann zur Insel. Obschon Thomas als Landesbeamter eigentlich ein typischer Büromensch war, liebte er Motoren aller Art und beherrschte sie perfekt. So steuerte er auch Tante Klaras uralte Boote stets sicher über den Rhein.
In den letzten Jahren hatte ab und an einer ihrer Söhne Esther begleitet, obwohl man Ben und Flo meist erst lange überreden musste. Der eine hatte als Ingenieur, der andere als Arzt einfach zu viel zu tun.
Esther jedenfalls war immer stolz darauf gewesen, welch engen Kontakt sie und ihre Familie mit der ältesten Schwester ihrer Mutter pflegten. Und Tante Klara hatte es zu schätzen gewusst. Sie hatte es geliebt, wenn sie zu Besuch kamen. Das war nun endgültig vorbei.
Auf einmal wurde Esther tieftraurig.
»Ich musste erst mit der Bahn von Frankfurt nach Bonn fahren und dann ein Taxi nehmen«, warf Nicky jetzt ein. Sie klang wie eine Märtyrerin. »Das war immer total umständlich für mich. Und vor allem teuer! Trotzdem habe ich es gern getan.«
Ihre Worte ließen Esther sofort alle sentimentalen Regungen vergessen. Es nervte sie, dass Nicky ständig betonen musste, welche Opfer sie auf sich nahm, obgleich es ihr wirtschaftlich schlechter ging als ihren Schwestern.
Marlene schienen Nickys Klagen nicht zu stören. Sie nickte. »Für mich ist es von Kaarst aus auch weit, deshalb habe ich ja auch veranlasst, dass Klärchen hier in Neuss ins Hospiz kam, als es nicht mehr anders ging. Manchmal denke ich, dass das falsch war. Von ihren Freunden konnte sie hier ja keiner so einfach besuchen.«
»Ich glaube nicht, dass Tante Klara überhaupt noch Freunde hatte«, erwiderte Esther sachlich. »Sie ist achtundachtzig Jahre alt geworden. In dem Alter leben oft kaum noch Gleichaltrige.« Sie blickte von Nicky zu Marlene. »Und jetzt geht es ja um was anderes: das Testament. Ich finde es auch echt unfair, dass Jochen und Michael …«
Marlene unterbrach sie mit einer ungeduldigen Handbewegung. So resolut kannte Esther sie gar nicht. »Klärchen hatte keine Kinder, dafür Neffen und Nichten. Familie eben. Wir alle waren ihr wichtig.« Sie holte tief Luft. »Was ich nur überhaupt nicht begreife, ist, dass auch ein Fremder ein Siebtel erben soll. Hansi Berg. ›Die Liebe ihres Lebens‹, hat sie mir wortwörtlich diktiert. Ich bin fast vom Stuhl gefallen! Wer soll das überhaupt sein?«
Nicky
Nicky war noch ganz durcheinander, als Esther sie in dem kleinen Wendehammer am Nebeneingang des Neusser Hauptbahnhofs absetzte. Sie war immerhin Tante Klaras Patentochter gewesen und hatte fest damit gerechnet, weit mehr als nur ein Siebtel zu erben.
Ihre finanziellen Probleme seit der Scheidung von René waren Tante Klara außerdem hinlänglich bekannt gewesen. Ihr Ex hatte sie übervorteilt, weshalb sie nun in einer kleinen Mietwohnung leben musste, statt wie früher in einem schönen großen Haus. Pauline studierte mit vierundzwanzig Jahren im sechsten Semester in Heidelberg. Sie finanziell zu unterstützen riss ein weiteres Loch in Nickys schmales Budget. René interessierte sich ja einen Dreck für seine Tochter, und Andi, der offensichtlich lieber mit Kängurus und Koalas seine Zeit verbrachte als mit seiner Nichte, taugte als Onkel auch zu nichts.
Nicky öffnete die Bahn-App auf dem Smartphone und steuerte dann das Gleis an, auf dem in einer knappen Viertelstunde ihr Zug abfahren würde.
Oben auf dem Bahnsteig war es kalt und zugig. Der böige Herbstwind trieb leere Papierchen von Schokoriegeln und zerknickte Coffee-to-go-Becher vor sich her. Ein junger Mann in schmierigen Klamotten schlurfte vorbei und bettelte sie um Geld an. Nicky drehte sich demonstrativ weg. Darin war sie geübt. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof begegnete man den Drogensüchtigen zuhauf. Gab man einmal nach und bedachte sie mit ein paar Münzen, klebten sie an einem wie Kaugummi.
Geh arbeiten, du Faulpelz, dachte sie jetzt und erschrak gleichzeitig über ihre miesen Gedanken. Normalerweise hatte sie doch eher Mitleid mit denen, die im Leben gescheitert waren. Andererseits … Wer hatte denn eigentlich Mitleid mit ihr? Niemand, wie ihr schien. Ihr kamen die Tränen.
Nicky hatte, als sie mit Pauline schwanger gewesen war, ihr Medizinstudium abgebrochen, um ganz für ihr Kind da sein zu können. René verdiente damals als Manager in einer internationalen Firma ja auch mehr als genug für sie drei. Nach der Trennung rächte es sich dann, dass Nicky keinen Berufsabschluss besaß. Seither arbeitete sie als schlechtbezahlte Sprechstundenhilfe in einer Augenarztpraxis.
Sie erinnerte sich daran, dass Tante Klara ihr vor etlichen Jahren empfohlen hatte, ihr Studium zu Ende zu bringen. Da war Pauline gerade mal zehn Jahre alt gewesen und hatte das fünfte Schuljahr eines zweisprachigen Gymnasiums besucht. René, Pauline und sie hatten auf dem Weg in den Sommerurlaub einen kurzen Zwischenstopp auf Hohenwerth eingelegt. Alle drei freuten sie sich auf ihr Ferienhaus in Dänemark. In der Situation hatte Tante Klaras Mahnung, wie wichtig es sei, auf eigenen Füßen zu stehen, Nicky nicht die Bohne interessiert. René und sie waren ein glückliches Paar mit einer tollen Tochter. Ihr Familienleben lief bestens, wozu sollte sie sich den Stress antun und neben dem Haushalt und der Erziehung von Pauline noch zur Uni hetzen?
Inzwischen musste sie ihrer Tante leider recht geben. Aber wieso war es ihrer Patentante nicht eingefallen, ihr einen höheren Anteil des Erbes zukommen zu lassen, damit sie besser zurechtkam?
Sie schluckte und trat näher an die Bahnsteigkante. Weit hinten blickten ihr die hellen Scheinwerfer der S-Bahn, die sie nach Düsseldorf bringen würde, wie ein Augenpaar entgegen. Der Zug näherte sich schnell. Hoffentlich kam der ICE in Düsseldorf gleich genauso pünktlich wie die S-Bahn hier in Neuss. Dann wäre sie in zwei Stunden zu Hause in Frankfurt.
Marlene
Marlene räumte die Kaffeetassen in die Spülmaschine und warf anschließend einen langen Blick aus dem Küchenfenster ihres Bungalows. Nur noch wenige braune Blätter hingen an den Zweigen der Hortensie. Die kleine Zierkirsche daneben war schon leer gefegt.– Genauso leer fühlte sie sich gerade.
Sie ging in den offenen Wohn-Essbereich zurück und setzte sich ans Klavier. Ihre Finger glitten wie ferngesteuert über die Tasten, während sie Beethovens Mondscheinsonate spielte. Es war seit jeher eines ihrer Lieblingsstücke. Die sanfte Melodie hatte sie schon oft getröstet und auf andere Gedanken gebracht.
Heute nicht.
Klärchen fehlte ihr so sehr. Sie hatte sie immer ihre Seelentante genannt. Tante Klara hatte Kunst und Musik geliebt und gleichzeitig über einen scharfen Verstand verfügt, ähnlich wie sie selbst. Sie beide hatten sich blind verstanden und waren sich von Marlenes Jugend an sehr nah gewesen.
Als ihre Mutter vor sechs Jahren nach einem Herzinfarkt verstarb – der Vater lebte zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr –, wurde Tante Klara noch wichtiger für Marlene. Als alleinstehende Frau ohne Kinder war sie froh über die enge Bindung zu der mütterlichen Freundin.
Klärchen hatte ihr schon immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Sie war es auch gewesen, die Marlene als junger Frau von Mitte zwanzig bei einem Besuch auf Hohenwerth geraten hatte, sich eine eigene Immobilie zuzulegen.
Marlene erinnerte sich gut an ihren verdutzten Einwand, dass die meisten Leute erst einen Hauskauf tätigten, wenn sie verheiratet waren und eine Familie gründen wollten.
»Ist das nicht der normale Lauf der Dinge? Ehe, Nestbau, Kinder? So wie bei Esther?« Ihre Schwester war zwei Jahre jünger als Marlene, doch sie hatte ihren Traummann Thomas schon geheiratet und erwartete ein Baby.
»Bist du denn normal? Oder willst es sein?«, fragte Tante Klara zurück und drehte dabei den Stiel ihres Martiniglases in der Hand.
Marlene schnappte nach Luft. Was sollte das denn heißen?, fragte sie sich. Auch sie sehnte sich doch nach einer glücklichen Beziehung, nach Kindern, nach Geborgenheit. Dass es bislang mit keinem Mann geklappt hatte, war einfach Pech. Wollte Tante Klara etwa andeuten, dass ihr dies nicht bestimmt war? Dass etwas Grundlegendes sie von anderen Frauen ihres Alters unterschied? Aber was? Plötzlich kam sie sich wie eine Außenseiterin vor.
Sie spürte, wie Tantes Klaras Hand sacht ihr Bein tätschelte. »So war das nicht gemeint«, sagte sie sanft. »Aber ich merke doch, dass du anders bist als die meisten jungen Frauen. Selbständiger, unabhängiger. Und es kann nicht schaden, sich auch finanziell unabhängig zu machen. Eine eigene Wohnung trägt maßgeblich dazu bei. Sieh mal, so wie ich lebe …« Sie machte eine raumgreifende Geste mit beiden Armen – ihr Glas war glücklicherweise leer.
Marlene sah sich in dem gemütlichen Raum um, der in Klaras Musikzimmer überging, das von dem alten Flügel beherrscht wurde. Ihr Blick fiel durch das Sprossenfenster in den Garten. Eine dichte Mischhecke umschloss die riesige Rasenfläche. Jenseits davon erstreckten sich Wald und Wiesen bis hin zum Kiesstrand der Rheininsel. Das Stampfen der Dieselmotoren der Rheinschiffe hörte man zwar nicht durch die dicken Mauern des weiß verputzten Hauses, aber immerhin doch bis in den Garten, wo Rosengehölze verschwenderisch wuchsen und Johannisbeersträucher und knorrige Apfelbäume standen. Der Ausblick – besonders bei klarem Wetter – über den Rhein auf das Siebengebirge mit dem malerischen Drachenfels war atemberaubend.
»Du lebst in einem Paradies«, konstatierte Marlene, »aber soviel ich weiß, hast nicht du das Haus gekauft, sondern dein Mann, der hier erst allein wohnte. Und nachdem er jung verunglückt war, gehörte es dir.«
»Mm«, machte Tante Klara, »ganz so war es nicht, aber das spielt jetzt keine Rolle.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Fest steht jedenfalls, dass das hier mein Reich ist. Ich kann tun und lassen, was ich will. Niemand redet mir rein.«
Marlene dachte an die Konzerte und Lesungen, die ihre Tante hier veranstaltete, und nickte langsam. »Aber so was wie dieses Haus wäre für mich doch unbezahlbar, selbst wenn ich als Lehrerin später verbeamtet werde.« Zurzeit arbeitete sie noch als Referendarin an einem Gymnasium in Kaarst und wohnte dafür zur Untermiete bei einem älteren Ehepaar. Natürlich war das nur eine Notlösung; sie lechzte nach mehr Privatsphäre. Und da kam Klärchen mit der Idee daher, sie solle sich die eigenen vier Wände gleich kaufen.
»Das ist logisch.« Ihre Tante nickte. »Aber so viel Platz brauchst du ja erst mal gar nicht. Außerdem solltest du selbstredend nicht von allem abgeschottet wie ich leben, sondern von jungen Leuten umgeben sein. Kauf dir für den Anfang eine kleine Stadtwohnung, und dann siehst du weiter. Nimm es als Kapitalanlage für die Zukunft. Ich spreche mal mit Lisbeth. Vielleicht können deine Eltern dir ein Startkapital geben. Das haben sie bei Esther und ihrem Thomas auch gemacht, hat Lisbeth mir erzählt. Und jetzt bist eben du dran, zumal du ja sogar die Älteste bist. Lass dich nicht ausbooten, nur weil du …« Sie brach ab, räusperte sich und sprach dann erst weiter: »… noch nicht den richtigen Mann fürs Leben gefunden hast.«
Marlene beschlich das unbestimmte Gefühl, dass ihre Tante eigentlich etwas ganz anderes hatte sagen wollen.
Inzwischen wusste Marlene längst, dass sie weder für die Ehe noch für eine Familie geschaffen war. Tante Klara hatte das offenbar schon früh gespürt. Sie war ein Solitär, und seit sie es sich nach einer langen schmerzhaften Zeit der Selbstverleugnung endlich eingestanden hatte, lebte es sich wesentlich unbeschwerter.
Tante Klärchens Tipp von damals war goldrichtig gewesen. Nach der kleinen Eigentumswohnung, die sie sich im Neusser Norden in einem achtstöckigen Mehrparteienhaus zugelegt hatte, kaufte sie den Bungalow in Kaarst, wo sie heute noch lebte. Das Grundstück war zwar klein, verlief jedoch in einem breiten Streifen rund um das Haus herum, so dass sich kein Nachbar an ihrem Klavierspiel und den Fingerübungen ihrer Schülerinnen und Schüler stören konnte. Plötzlich fiel ihr Tante Klaras Flügel ein. In ihrem Testament war nicht extra aufgeführt, dass sie – Marlene – ihn bekommen sollte. Das hatte Klärchen ihr aber schon vor Jahrzehnten versprochen.
Marlene wurde ganz aufgeregt. Hoffentlich machte ihr keiner der Erben den heißgeliebten Flügel abspenstig. Sie wusste genau, wo sie ihn hinstellen wollte: dorthin, wo jetzt der große Esstisch aus lackiertem Mahagoni stand, den sie sowieso nie nutzte. Sie aß entweder in der Küche oder vor dem Fernseher. Letzteres war zwar zugegebenermaßen eine kulturelle Unart, aber eben auch total bequem. Marlene lächelte. Es hatte doch viele Vorteile, wenn man allein lebte.