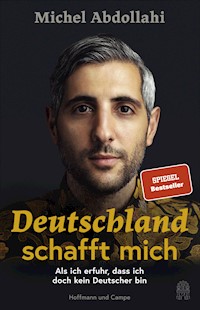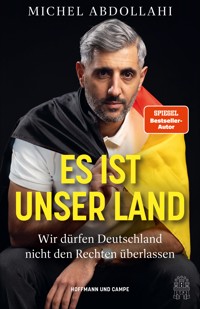
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Offener Fremdenhass, rechtes Gedankengut, das salonfähig geworden ist, eine heillos zerstrittene bürgerliche Mitte – Bestsellerautor und Fernsehmoderator Michel Abdollahi durchleuchtet die Abgründe der deutschen Gegenwart und zeichnet das Lagebild einer Gesellschaft, in der Menschen mit Migrationsgeschichte mehr und mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden. Abdollahi geht dahin, wo es wehtut und benennt Missstände deutlich und pointiert. Zugleich zeigt er auf, wie eine Wende gelingen kann hin zu einem friedvollen und vielfältigen Miteinander ohne Rassismus und Populismus. Erschreckend, erhellend, ermutigend: Michel Abdollahis Buch ist ein Geschenk für jede offene Gesellschaft, die diesen Namen auch verdient.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michel Abdollahi
Es ist unser Land
Wir dürfen Deutschland nicht den Rechten überlassen
Für Deutschland – das nicht weiß, wie das passieren konnte.Für das ich aber immer noch hoffe.
Deutschland schafft mich – ein Prolog
Es gibt Momente, die sich in die Erinnerung brennen und dort so präsent sind, als ob sie erst gestern gewesen wären. Für mich ist einer dieser Momente ein Samstagmorgen in den Neunzigerjahren. Ich saß mit meiner Mutter in der Küche, und wir sprachen über meine Einbürgerung. Ich wollte reisen, die Welt erkunden, frei sein und nicht immer nur in Deutschland hocken. Als Iraner brauchte man damals jedoch für fast jedes Land ein Visum (daran hat sich bis heute nichts geändert). Meine Schulfreunde waren schon in die Planungen vertieft: Interrail, Australien, Kibbuz. Ich dagegen hatte nur eine Option: mit meiner Oma in den Iran zu fahren.
Um endlich Deutscher zu werden, hätte ich damals meinen iranischen Pass abgeben müssen. »Das wirst du nicht machen. Das wirst du nie machen. Glaube nicht, dass man dir den nicht irgendwann wieder wegnehmen kann. Dann hast du gar nichts mehr«, sagte meine Mutter. Ich dagegen glaubte an das Grundgesetz und daran, dass die aus der deutschen Geschichte gewonnenen Grundsätze noch Bestand hatten.
Heute ist mir mehr denn je bewusst, dass wir niemals vergessen dürfen, was in diesem Land möglich war, als Macht über Menschlichkeit triumphierte. In den finstersten Jahren deutscher Geschichte – unter dem Terror des Nationalsozialismus – wurde die Staatsbürgerschaft zur Waffe. Ein Stück Papier entschied über Zugehörigkeit oder Auslöschung, über Leben oder Verfolgung. Wer nicht passte, wer widersprach, wer anders war, dem wurde die Staatsangehörigkeit entzogen. Und mit ihr: der Schutz, die Rechte, die Würde. Hunderttausenden wurde das Deutschsein aberkannt: Jüdinnen und Juden, Sozialistinnen und Sozialisten, Künstlerinnen und Künstlern, Intellektuellen – Menschen, die dieses Land bereicherten, wurden entwurzelt und entrechtet. Der Entzug der Staatsbürgerschaft war nicht bloß Verwaltungsakt – er war Teil eines unmenschlichen Systems, das Menschen vernichten wollte. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten aus der Zeit des Nationalsozialismus ihre Lehren gezogen.
»Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden.« Art. 16GG
Dieser Satz ist keine juristische Floskel. Er ist eine Brandmauer gegen staatliche Willkür. Er ist das Versprechen unserer Demokratie, dass niemand mehr aus diesem Land hinausdefiniert wird, nur weil er unbequem, anders oder unerwünscht erscheint. Wer fordert, Menschen den Pass zu nehmen, weil sie angeblich »nicht dazugehören«, rührt an den Grundpfeilern der demokratischen Verfassung. Wer den Entzug der Staatsangehörigkeit diskutiert, stellt sich gegen die Lehren aus ebenjener finsteren Geschichte – und gegen die Menschlichkeit selbst. Nein, wir verteidigen Artikel 16! Nicht aus juristischem Dogmatismus, sondern aus moralischer Pflicht. Die Zugehörigkeit zu einer demokratischen Gesellschaft darf nie wieder von Ideologie, Herkunft oder Meinung abhängig gemacht werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar – und mit ihr die Rechte, die ihm zustehen. Wer das vergisst, verrät nicht nur das Grundgesetz. Er verrät die Geschichte, die uns gewarnt hat.
Wusstest du das denn alles nicht, Mutter? Doch sie war anscheinend schlauer als ich. Oder weitsichtiger. Am 7. Januar 2025 verkündete Friedrich Merz, dass »eine Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft möglich sein« müsse. Der Rest, wann wie wo was wer, war wohl irrelevant, Auslegungssache, aber die Sachen legt ohnehin immer der aus, der am längeren Hebel sitzt.
Wenn man mich raushaben will, dann findet man schon einen Weg. Ich bin nicht so naiv, zu glauben, dass die Aussage von Friedrich Merz im Lauf der Zeit nicht noch weiter verschärft und ausgeweitet werden wird. Merz formulierte hier nur den Startschuss. Wie so oft in der Politik. Die Wahrheit ist der Bevölkerung nämlich nur scheibchenweise zuzumuten. Ich habe in meinem ersten Buch schon davor gewarnt, dass die sogenannte Brandmauer der CDU/CSU zur AfD nur ein Lippenbekenntnis ist. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber mit dem 29. Januar 2025, als die Union mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag für ihre Migrationspläne bekam, habe ich recht behalten.
Und dabei blieb es nicht. Nach der Bundestagswahl 2025, aus der die AfD als zweitstärkste Kraft hervorging, kam es innerhalb der Union zu kontroversen Debatten über den Umgang mit der Partei. Einige Unionspolitiker forderten eine offenere Haltung: Jens Spahn plädierte für einen pragmatischen Umgang mit der AfD im Bundestag. Der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Willsch stimmte bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten für einen AfD-Kandidaten. In Sachsen-Anhalt forderte der CDU-Kreisverband Harz unter Ulrich Thomas offen die Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses gegen die AfD. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer traf sich mit dem AfD-Landeschef zu politischen Gesprächen. CDU-Chef Friedrich Merz wiederum betonte die Ablehnung jeder Zusammenarbeit, ließ jedoch eine umstrittene gemeinsame Abstimmung im Bundestag geschehen. Und Julia Klöckner, die das zweithöchste Amt im Staat, das der Bundestagspräsidentin, bekleidet, warb kurz vor der Wahl auf Social Media ganz offen um AfD-nahe Wähler: »Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative: die CDU.« Die Offerte wurde zu Recht als Gleichsetzung von CDU-Inhalten mit den rechtsextremen Forderungen der AfD verstanden.
Als Kind hing in meinem Zimmer ein Bild von zwei Händen. Die eine aus Fleisch und Blut, die andere ein Skelett, beide prosteten sich mit einem Glas Whisky zu. Darunter der Schriftzug »Schluck für Schluck kommt man sich näher«. Das war eine Werbung, um vor Alkoholmissbrauch zu warnen. Warum mein Vater dieses Poster aus Deutschland mitgebracht und über das Bett seines frischgeborenen Sohnes gehängt hatte, weiß ich nicht, es hat auch nichts gebracht, ich liebe Whisky, wie er auch, aber komischerweise kommt es mir immer wieder in den Sinn, wenn ich an Union und AfD denke: Schritt für Schritt kommt man sich näher.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man auf einer Party ist, das Glas hebt und sagt: »Leute, passt auf, der Typ da drüben ist nicht nur betrunken, der reißt gleich die komplette Anlage um« – und genau fünf Minuten später liegt der DJ mitsamt Boxen auf dem Boden? Genauso fühle ich mich. Nur dass die Party Deutschland heißt, der DJ die Demokratie ist und der Typ, der alles umschmeißt, nicht aus Versehen stolpert, sondern mit Ansage durchmarschiert. Während wir zuschauen und debattieren, ob wir etwas machen sollen, und wenn ja, was.
Als Deutschland schafft mich2019 erschienen ist, meinten viele: »Michel, übertreib doch nicht. Du malst zu schwarz.« Wirklich? War das Schwarzmalerei? Oder einfach nur eine wirklichkeitsgetreue Schilderung der Lage und ein realistischer Blick in die Zukunft? Und glaubt mir, ich wäre lieber der Typ, über den alle lachen, weil sich keine seiner Prognosen bewahrheitet hat. Aber nun schreiben wir das Jahr 2025, und die Liste von damals, von fremdenfeindlichen Ereignissen in Deutschland, ist nicht nur angewachsen, sie ist inzwischen länger und erschreckender, als ich es jemals vermutet hätte.
Rechtsruck? For real! Viele haben gewarnt: Passt auf, die sitzen nicht nur am Rand. Und heute? Rechte Parolen direkt aus der »bürgerlichen Mitte«. Menschen, die vor ein paar Jahren »Ich bin ja nicht politisch« sagten, verteidigen jetzt rechtsextreme Narrative im Brustton der Überzeugung. Wenn ich mir heute meine Dokumentation Im Nazidorf anschaue – ich bin 2015 für vier Wochen nach Jamel gezogen, ein Dörfchen in Nordwestmecklenburg, dessen Bewohner größtenteils der NPD zugeneigt waren, um es höflich zu formulieren –, dann hört sich das, was der Obernazi Sven Krüger damals von sich gab, gelinde gesagt noch ziemlich freundlich an. Adolf Hitler? Den kannten einige der Neonazis in Jamel gar nicht. Wer soll das denn gewesen sein? Heute ist Hitler bekanntermaßen Kommunist. Ich glaube, er war sogar Russe und wollte Deutschland überfallen. Holocaust und Weltkrieg, alles historische Missverständnisse. Freiheitskämpfer, das war er.
AfD im Bundestag? Fakt! »Die schaffen die Fünf-Prozent-Hürde doch nie«, hieß es damals. Und heute? Sind sie zweitstärkste Kraft, nur wenige Prozentpunkte hinter der Union (je nach Umfrage auch mal vor ihr liegend!), und bestimmen die Oppositionspolitik. Und während sie wieder lauthals »Wir werden sie jagen« in die Mikrofone rufen, sitzen andere daneben und zucken mit den Schultern. In Österreich hat die rechtsextreme FPÖ sogar die Mehrheit geholt und wurde zwischenzeitlich mit der Regierungsbildung beauftragt. In Deutschland undenkbar? Dass ich nicht lache.
Die CDU koaliert mit der AfD? Kann ja mal vorkommen. Ich erinnere mich noch an die empörten Beteuerungen: »Mit uns niemals!« Ein bisschen öffentlicher Druck hier, ein paar Umfragewerte da – und plötzlich ist aus dem »Niemals« ein »Na ja, vielleicht doch« geworden. Grundsätze scheinen verhandelbar, wenn’s um die Macht geht. Wer hätte das gedacht? Spoiler: Ich (und ganz viele mit mir).
Gesellschaftliche Spaltung? Auch das ist Realität. Wir reden nicht mehr miteinander. Wir reden aneinander vorbei. Oder schreien uns an. Die einen wollen zurück in eine Zeit, die es so nie gegeben hat, die anderen gucken fassungslos zu. Und in der Mitte? Viel Schweigen. Viel Wegschauen.
Ich sitze hier und frage mich: Was muss eigentlich noch passieren? Und dann denke ich: Michel, das hast du dich doch auch schon vor Jahren gefragt. Und jetzt sind wir hier. Mit mehr Spaltung, mehr Angst, mehr »Das konnte ja keiner ahnen«. Wirklich nicht? Wir haben alle zugesehen, wie die Risse größer wurden. Haben darüber diskutiert, ob man rechte Wähler verstehen muss. Muss man nicht. Man muss sie stoppen. Punkt.
Und: Was kommt da noch? Was wartet auf uns in den nächsten Jahren, wenn wir weiter die Augen verschließen? Ein paar Ausblicke gefällig? Ich weiß, sie sind nicht schön. Aber sie sind ehrlich.
Wenn wir nichts tun, werden wir in fünf Jahren sehen, wie rechtsextreme Parteien in Landtagen stärkste Kraft werden (wie schon in Thüringen 2024 geschehen). Wir werden erleben, wie der gesellschaftliche Diskurs weiter kippt: Was heute Tabubruch ist, ist morgen »nur ehrlich gemeint«. Wir werden uns daran gewöhnen, dass Politiker bedroht, Journalisten angegriffen und Wissenschaftler diffamiert werden, und zwar noch viel drastischer als heute. Und wir werden sehr wahrscheinlich eine Kanzlerin oder einen Kanzler sehen, der mit rechtspopulistischen Stimmen regiert, ob nun aus Versehen, mit Ansage oder mit was auch immer.
Klingt weit hergeholt? Das dachte man vor ein paar Jahren mit Blick auf andere Länder auch. Schauen wir nach Ungarn: Viktor Orbán hat die Demokratie in dem Land langsam erstickt – mit angeblich demokratischen Mitteln. Er hat die Medien gleichgeschaltet, die Justiz unter seine Kontrolle gebracht. Begonnen hat das Ganze mit ein paar harmlosen Sprüchen über die »Brüssel-Diktatur«. Ganz ähnlich in Italien. Oder eben in Österreich. Von den USA ganz zu schweigen.
Populismus macht nicht an Grenzen halt. Und Radikalisierung fängt meistens leise an und endet laut. Geschichte muss sich nicht wiederholen – aber sie kann, wenn wir nichts dagegen tun.
Ich sitze hier, tippe diese Zeilen, und ganz ehrlich: Ich bin traurig. Nicht wütend. Traurig. Weil ich weiß, wie viel besser wir sein könnten. Wie viel empathischer, aufmerksamer, klüger. Aber wir verlieren uns in Banalitäten. Wir diskutieren darüber, ob »Deutschsein« ein Gefühl oder ein Pass ist, während rechte Netzwerke das Land unterwandern. Wir streiten darüber, ob geschlechtsneutrale Toiletten »zu viel« sind, während ein irregewordener Tech-Milliardär Rechtsradikalen quer über den Atlantik den Steigbügel hält.
Und was mache ich? Schreibe wieder ein Buch. Sage wieder voraus, was passieren wird. Nicht weil ich Spaß daran habe, weil ich recht behalten möchte oder meine Klugheit unter Beweis stellen will. Nein, weil ich die Lage unmissverständlich und klar benennen möchte und weil ich hoffe, dass vielleicht jemand aufwacht. Vielleicht du. Vielleicht dein Nachbar, deine Nachbarin. Vielleicht ein Bürgermeister, der merkt: Wegschauen hilft nicht.
Lasst uns ein Experiment wagen, eine Art Wette. Wir sprechen uns in fünf Jahren wieder. Dann sitzen wir zusammen, bei einem Kaffee oder einem Whisky, wahrscheinlich bei beidem. Und ich frage dich: »Hab ich es nicht gesagt?« Und du? Du wirst seufzen, lächeln und sagen: »Ja, Michel, du hast es gesagt.«
Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht dreht sich was. Vielleicht schreiben wir eine andere Geschichte. Ich wäre der Erste, der sich freut. Ehrlich.
Bis dahin: Hört hin. Schaut hin. Handelt. Und vor allem: Habt keine Angst.
Ein kurzer Ritt durch die Geschichte – zur Einstimmung
Dieses Buch ist ein Versuch, die Entwicklungen der letzten Jahre zu verstehen. Sie nicht zu überzeichnen, aber auch nicht zu beschönigen. Es ist keine einfache Geschichte, aber eine notwendige. Die Fehler der Vergangenheit lassen sich nicht rückgängig machen, aber sie können ein Warnsignal sein. Ein Warnsignal, nicht mehr wegzuschauen. Denn die Ignoranz hat ihren Preis. Er zeigt sich in erschütterten Demokratien, in der Normalisierung von Hass und in einer Gesellschaft, deren einzelne Teile immer weiter auseinanderdriften.
Diese Geschichte beginnt nicht 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Sie beginnt weit davor. Aber sie hat sich beschleunigt. Und sie endet nicht im Hier und Jetzt. Die Fragen nach Zugehörigkeit, Gerechtigkeit und Zusammenhalt werden bleiben. Die Herausforderung besteht darin, sie fair und ausgewogen zu beantworten, mit Empathie, Verstand und kühlem Kopf. Und nicht mit Schaum vorm Mund, getrieben von Panikmache und Hysterie. Denn eines ist sicher: Noch gibt es berechtigte Hoffnung, dass unsere Gesellschaft den Bestrebungen von ganz weit rechts widersteht. Aber diese Hoffnung glimmt nur noch leise, während die anderen – der Hass, die Verachtung, der Populismus – viel zu laut sind. Sie weiter zu ignorieren, wäre schlicht fatal.
Die Achtziger – Unsichtbare Gäste
Ich habe heute, dreißig Jahre später, mit meiner Mutter über den Moment von damals gesprochen. Sie zuckte nur mit den Achseln. Für uns war Deutschland das Land der Hoffnung, aber auch das Land der ständigen Prüfung. Wir mussten immer ein bisschen mehr geben, immer ein bisschen besser sein, um akzeptiert zu werden. Und stets blieb die Frage: Ist es irgendwann genug?
Die Achtzigerjahre waren geprägt von einer scheinbaren Stabilität, die viele aus der Generation meiner Eltern täuschte. Die Wirtschaft florierte, Deutschland ging es gut – und dennoch gab es Risse, die sich tief durch die Gesellschaft zogen. Die »Gastarbeiter« – ein Begriff, der schon immer irreführend war – waren längst keine Gäste mehr. Sie hatten sich eingerichtet, Häuser gebaut, Kinder bekommen. Doch diese Kinder, meine Generation, waren für viele Menschen eine ständige Erinnerung daran, dass die Idee der Homogenität in Deutschland nicht wirklich gültig war. In der Schule spürte ich das ganz unmittelbar. Während andere Kinder unbeschwert von ihren Ferien erzählten, wurde ich gefragt, ob wir »zu Hause« waren. »Zu Hause«, das war nicht Deutschland, sondern ein Land, das ich nur aus den Erzählungen meiner Eltern kannte. Es war das Land meiner Wurzeln, aber nicht meiner gelebten Realität. Das war Deutschland, aber hier hatte ich keine Wurzeln – ein Widerspruch, der sich durch mein ganzes Leben ziehen sollte. Integration war kein Begriff, der in den Achtzigern weithin geläufig war. Dahinter steckte vielmehr eine unausgesprochene Bedingung: Du kannst bleiben, solange du dich anpasst. Aber was bedeutete Anpassung? Es bedeutete, nicht aufzufallen, die Sprache fehlerfrei zu sprechen, ja sogar Gestik und Mimik der Deutschen zu übernehmen. Doch egal, wie sehr man sich bemühte, die Frage »Woher kommst du?« blieb. Sie war weniger eine Frage als eine Feststellung: Du gehörst nicht hierher.
Die Neunziger – Hoffnung und Hass
Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands begann ein neues Kapitel. Für viele war es eine Zeit voller Hoffnung. Endlich vereint, endlich eins. Die Straßen waren gefüllt mit Menschen, die feierten, lachten, sich in den Armen lagen. Auf den Titelseiten der Zeitungen stand: Wir sind ein Volk, aber unter der Oberfläche brodelte es. Denn während die einen von Freiheit sprachen, fühlten sich die anderen betrogen. Arbeitsplätze verschwanden, ganze Industrien kollabierten. Schon bald standen sich Ost und West wieder feindlich gegenüber, nicht mehr durch Mauern getrennt, sondern durch Misstrauen, Vorurteile und Enttäuschung.
In Ostdeutschland wuchs der Frust. »Ihr seid nicht die Verlierer der Einheit«, hieß es offiziell. Aber weil Fabriken schlossen, Löhne sanken und Perspektiven verschwanden, fühlten sich viele genau so: als Verlierer. Und wenn Wut keinen Ort findet, sucht sie sich ein Ventil. Dieses Ventil hieß damals: Fremde. Menschen, die anders aussahen, anders sprachen, anders waren. Der Hass brauchte keine Logik. Er brauchte nur ein Ziel.
Dieses Ventil ist bis heute geblieben. Denn Hass auf Fremde ist selten ursächlich. Er ist ebenjener Anlass für Frust, Angst und Kontrollverlust. Die wahren Probleme liegen anderswo: soziale Unsicherheit, politische Enttäuschung, gefühlte Bedeutungslosigkeit. All das traf schon in den Neunzigern auf die Ostdeutschen zu, und bis heute hat es sich nicht geändert. In vielen Teilen Ostdeutschlands ist nicht nur die Bushaltestelle verschwunden, sondern das ganze Leben. Die großen Gebietsreformen nach der Wende sollten effizient sein. Verwaltung modernisieren, Strukturen verschlanken, Geld sparen. Und sie haben geliefert – nur nicht für die Menschen. Rathäuser wurden dichtgemacht, Schulen geschlossen, Arztpraxen verlegt. Was blieb, war der Weg in die nächste Stadt. Wenn man ein Auto hatte. Wo der Staat ging, folgte das öffentliche Leben. Kein Laden, kein Schwimmbad, kein Café. Kein Ort, an dem man sich trifft, entscheidet und lebt. Ganze Dörfer wurden zu Wohnplätzen ohne Funktion – Zonen des Rückzugs und der Resignation. Die Jungen zogen weg, weil nichts mehr da war. Die Alten blieben – ohne Anbindung, ohne Stimme. Und wer blieb, bekam jahrzehntelang zu hören: »Für euch lohnt sich das nicht.«
Der Staat hat sich zurückgezogen – und damit auch Vertrauen, Zukunft, Selbstwirksamkeit. Wenn Menschen nicht mehr glauben, dass ihr Ort etwas wert ist, glauben sie irgendwann auch nicht mehr, dass ihre Stimme etwas wert ist.
Rechtsextreme haben früh erkannt, was Politik und Verwaltung übersehen haben: Die Leere im Osten ist nicht nur räumlich – sie ist emotional. Wo der Staat sich zurückgezogen hat, sind sie reingegangen. Wo der demokratische Staat sich zurückgezogen hat, zog der autoritäre Populismus ein. Nicht mit Gewalt. Sondern mit dem Versprechen: »Wir sehen euch.« Mit einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Mit Präsenz, wo niemand mehr präsent war. Statt sich gegen die Ursachen zu wenden – viel zu komplex, zu diffus und nur schwer greifbar –, richtete sich ihr Zorn auf ein Ziel, das sichtbar und schwach erscheint: die »Fremden«.
Ich erinnere mich an die Bilder von Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Flammen, Wut, ein Mob, der klatschte, während ein Asylbewerberheim brannte. Menschen warfen Steine, Flaschen, Molotowcocktails. Polizeibeamte standen daneben – überfordert, hilflos, manchmal ignorant. Im Fernsehen zeigten sie die brennende Unterkunft, in der Menschen um ihr Leben fürchteten.
Für meine Eltern waren diese Bilder ein Schock, aber auch eine Warnung. Sie begannen, ihre Worte sorgfältiger zu wählen, ihre Routinen zu ändern. Ich weiß noch, wie ich bei uns im Schrebergarten (ja, wir hatten uns schnell überintegriert) meinen Geburtstag feierte. Als wir Kinder etwas lauter wurden, holte der Nachbar dramatisch die Fahne des Gartenvereins ein und hisste die Reichskriegsflagge. MITTAGSRUHE! Ich hatte keine Ahnung, was das war, aber meine Eltern kamen dann doch lieber mit, wenn wir das Grundstück verlassen wollten. Die Angst wurde ein ständiger Begleiter.
Und Rostock war nicht das einzige Warnzeichen. Hoyerswerda 1991: Angriffe auf ein Flüchtlingsheim über mehrere Tage hinweg. Menschen sprangen aus dem Fenster, während vor der Tür wieder applaudiert wurde. Mölln 1992, Solingen 1993: Brandanschläge auf türkische Familien. Tote, Trauer, Schock. Aber auch immer wieder dieselben Sätze: »Das sind doch Einzelfälle.« – »Nicht alle sind so.« Worte, die beruhigen sollten – aber nichts beruhigten.
Der Staat spricht übrigens bis heute bei Angriffen auf Migranten gern von »Einzelfällen«. Es klingt kontrollierbar, zufällig, beruhigend, nicht systemisch – und erspart politisches Handeln. Die Gesellschaft nimmt das bereitwillig auf, obwohl sie es besser weiß. Warum? Weil es bequemer ist. Wer den Rassismus als Ausnahme sieht, muss sich nicht fragen, wo er selbst wegschaut, schweigt oder profitiert. Ja, profitiert! Wer nicht als »fremd« gilt, bewegt sich sicherer, wird seltener kontrolliert und leichter anerkannt. Man hat besseren Zugang zu Wohnungen, Jobs und Chancen – einfach, weil andere aussortiert werden. Rassismus kostet die Betroffenen Kraft – und verschafft den Nicht-Betroffenen Ruhe. Genau deshalb bleibt er oft unsichtbar: weil viele von ihm profitieren, ohne es zu merken. Der »Einzelfall« ist die Entlastungslüge – für Behörden, für Medien und für alle, die sich nicht mit der unbequemen Realität auseinandersetzen wollen.
In den Nachrichten hörte ich ständig das Wort »Asylanten«. Es war ein Wort, das mit einer Schärfe ausgesprochen wurde, die mir schon als Kind Unbehagen bereitete. »Asylanten« – das waren eben keine Menschen, sondern Fremde, Eindringlinge, Probleme. Und obwohl ich kein Asylant war, spürte ich, dass auch ich gemeint war. Meine Hautfarbe, mein Name, meine Herkunft – all das machte mich zum Teil dieser Gruppe, die man ablehnte. Dann gab es noch das Wort »Kanake«. Auf dem Schulhof fiel es beiläufig, fast schon wie ein Spitzname. Wir, die Keneks, sollen nicht überempfindlich sein, hieß es, es sei ja »nicht böse gemeint«. Außerdem kommt »Kanacke« ja aus dem Hawaiianischen und bedeutet doch nur Mensch! Eigentlich ist es ein Kompliment! Wir sind doch alle Menschen! Dann sag’s doch auf Hawaiianisch … Aber Worte bleiben. Vor allem die scharfen.
Die Politik? Schwankte zwischen Betroffenheit und Aktionismus. Helmut Kohl sprach von »braunen Rattenfängern«, aber Maßnahmen folgten nur zaghaft. Die Gesellschaft müsse zusammenhalten. Gleichzeitig wurde 1993 das Asylrecht verschärft. »Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht«, war zu hören. Als ob Schutzsuchende ein Problem wären, das man wegverhandeln könnte. Als ob Brandanschläge wie der von Solingen bedeuteten, man müsse nun weniger Hilfe gewähren, nicht mehr. Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer warnte schon damals vor einem »Verrohungsprozess« in der Gesellschaft, der durch soziale Unsicherheit und politische Sprachlosigkeit befeuert werde. Aber Warnungen verhallen schnell, wenn sie unbequem sind.
Rückblickend waren die Neunziger ein Scheidepunkt. Hoffnung und Hass lagen nah beieinander. Während ein Teil des Landes versuchte, Brücken zu bauen, rissen andere sie ein. Während rechtsextreme Gruppen wie die Skinheads Sächsische Schweiz Jugendliche rekrutierten und Neonazi-Bands Konzerte als »politische Schulungen« tarnten, sahen viele weg. »Das geht wieder vorbei«, sagten sie. Ging es nicht. Es wuchs. Es grub sich ein. In der Sächsischen Schweiz, genauer in Pirna, regiert heute übrigens der erste AfD-Oberbürgermeister mit einer Mehrheit im Stadtrat. Ich habe Freunde in der Stadt, sie raten mir aber dringend davon ab, sie zu besuchen. Germany 2025.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Neunzigerjahre den Nährboden für den aktuellen Rechtsruck gelegt haben. Das Gefühl von »Wir zuerst«, das Misstrauen gegenüber der Politik, den politischen Entscheidungsträgern, die Skepsis gegenüber »dem Fremden« – all das hat seine Wurzeln in dieser Zeit. Es ist kein Geheimnis, dass wirtschaftliche Unsicherheit, verbunden mit kultureller Überforderung, eine gefährliche Mischung ist. Und genau diese Mischung brodelte in den Neunzigern. Viele Ostdeutsche fühlten sich nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung immer mehr als Bürger zweiter Klasse. Die versprochenen »blühenden Landschaften« waren für viele gleichbedeutend mit Arbeitslosigkeit. Wenn in den Medien dann noch eine »Flut« von Geflüchteten, von Migranten, von »den anderen« suggeriert wurde, war es leicht, Schuldige zu benennen.
Auch der Westen war dagegen nicht immun. In Städten wie Hamburg, Frankfurt, München gab es Übergriffe, Attacken, Hass. Nicht immer laut, nicht immer mit Feuer und Flammen. Aber auch die leise Ausgrenzung war gewalttätig, die Blicke und Kommentare. »Integration« war ein Wort, das viel forderte, aber wenig Angebote machte. »Sie sollen sich anpassen«, hieß es. Aber was, wenn die Anpassung bedeutet, sich kleiner zu machen?
Meine Eltern verstanden die Botschaft schnell: »Seid dankbar, dass ihr hier sein dürft. Fragt nicht zu viel. Fordert nicht zu viel. Lernt, denn: Tavana bovad har ke dana bovad.« Der berühmte Vers des persischen Dichters Ferdowsi – Wissen ist Macht –, der vor der islamischen Revolution auf jedem Zeugnis geschrieben stand – egal ob für die Grundschule oder die Habilitation – und wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die iranische Gesellschaft bis heute Wissen und Weisheit als ein zentrales Gut ihres Selbstverständnisses wahrnimmt, blieb für uns das Dogma der Zugehörigkeit. Sei immer etwas besser als die anderen, dann wird man dich akzeptieren. Früh übt sich, wer eine Gesellschaft nachhaltig beeinflussen möchte, Ferdowsi. Im Iran hat es trotz Revolution geklappt. Vielleicht klappt es ja auch hier bei mir.
Wenn ich an die Neunziger zurückdenke, frage ich mich: Hätten wir damals mehr tun können? Die Entwicklungen erkennen und besser einordnen können? Die Antwort ist: Ja. Es gab Stimmen, die warnten. Menschen, die protestierten. Aber sie waren leise. Zu leise gegen das Johlen vor den brennenden Flüchtlingsheimen. Die Politik reagierte – aber oft erst, wenn es schon zu spät war. Die Medien berichteten – aber manchmal mit Worten, die eher Öl ins Feuer gossen als Aufklärung brachten. Und wir? Wir dachten: »So schlimm wird es schon nicht werden.«
Heute, Jahrzehnte später, sehen wir, was damals gesät wurde. Die Narrative von »Überfremdung«, von »denen da oben« gegen »uns hier unten« – sie sind nicht neu. Es sind alte Geister in neuen Kleidern. Die Angst vor dem anderen, vor Veränderung, vor Kontrollverlust – sie wurde in den Neunzigern genährt, und ihre Wurzeln konnten sich fest im Boden verankern.
Wenn ich heute die Debatten verfolge, die Parolen höre, die Blicke spüre, frage ich mich: Haben wir gar nichts gelernt? Oder wollen wir einfach nicht hinsehen? Die Neunziger haben gezeigt, wie schnell Hoffnung kippen kann. Wie schnell aus einem »Wir sind ein Volk« ein »Wir gegen die« wird. Die Lage, vor der wir heute fassungslos stehen, hat sich nicht aus dem Nichts gebildet. Ganz im Gegenteil, sie ist bereits seit den Neunzigern da und hat sich stetig weiter verfestigt. Die Frage ist: Was machen wir diesmal anders?
Die Zweitausender – die zweite Generation erhebt ihre Stimme
Mit der Jahrtausendwende änderte sich vieles, aber nicht alles zum Besseren. Im Grunde ging es sogar mit jedem Schritt nach vorn zwei Schritte zurück. Einer dieser Rückschläge hieß »deutsche Leitkultur«. Anfang der Zweitausender stand plötzlich diese Debatte im Raum: Brauchen wir eine Leitkultur? Unklar war, was das überhaupt sein sollte. Bier, Bratwurst und Beethoven? Pünktlichkeit und Mülltrennung? Oder doch eher: keine Kopftücher, kein fremder Akzent, bitte, danke?
Die Forderungen waren teils skurril, teils haarsträubend. Es gab Politiker, die ernsthaft darüber diskutierten, ob man Migranten zum Besuch des Oktoberfests verpflichten sollte. Damit sie sich »besser einfühlen« konnten. Als wäre eine Maß Bier die Eintrittskarte zur Integration. In Talkshows hieß es: »Man muss doch wissen, wie Karneval funktioniert, wenn man hier lebt.« Ja, klar. Und wer nicht mitschunkelt, ist ein Integrationsverweigerer. Ergo ganz Norddeutschland direkt nach Dänemark ausgliedern.
Ein gewisser Friedrich Merz stand damals in der ersten Reihe dieser Debatte. Mit der rhetorischen Eleganz eines Vorschlaghammers erklärte er, dass, wer hier lebe, sich »unserer Leitkultur unterzuordnen« habe. Unterordnen – ein Wort, das mehr nach Befehl klingt als nach einem Willkommensangebot. Es ging bei der Debatte nicht darum, ein gemeinsames Wir zu finden. Es ging darum, ein »Wir gegen die« zu manifestieren. Der Islam? Passte nicht ins Bild. Kopftücher? Provokation. Die Muttersprache in den eigenen vier Wänden sprechen? Verdächtig. Es war eine Debatte, die nicht integrierte, sondern ausgrenzte.
Warum kam diese Debatte gerade damals auf? Weil Deutschland langsam begriff, dass Migration nicht vorübergehend war. Die »Gastarbeiter« waren geblieben. Ihre in Deutschland geborenen Kinder gingen nicht zurück in die »Heimat« ihrer Eltern. Sie blieben hier, lernten hier, lebten hier, wurden erwachsen. Sie gingen auf Universitäten, wurden Lehrer, Pflegekräfte, Künstler, Anwälte – und forderten Rechte ein. Sie wollten nicht mehr nur geduldet werden. Sie wollten dazugehören. Nicht als »Ausnahmen«, nicht als »Vorzeigemigranten«, sondern als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Das verunsicherte viele. Wer jahrelang dachte, Integration sei eine einseitige Angelegenheit, bekam nun plötzlich zu hören: »Wir sind doch schon da. Was wollt ihr denn noch?« Die Leitkultur-Debatte war eine Antwort auf diese Unsicherheit – leider die falsche. Statt Gemeinsamkeiten zu betonen, suchte man nach Unterschieden. Statt Brücken zu bauen, zog man Mauern.
Merz’ Vorstoß scheiterte damals politisch. Die CDU verlor Wahlen, die Debatte versandete. Letztlich war sie zu plump, zu aggressiv und zu spaltend. Man wollte nicht als rückwärtsgewandt dastehen, während die SPD