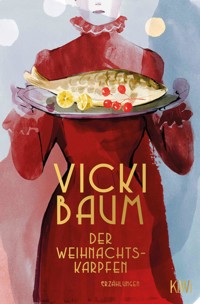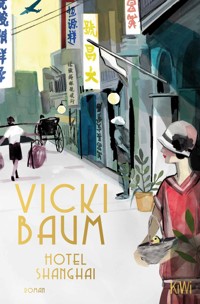9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom Berlin der 1920er-Jahre bis nach Hollywood: Vicki Baums Lebensgeschichte. Sie sei »nur eine einfache Geschichtenerzählerin« gewesen, schreibt Vicki Baum in ihren Memoiren. Wer nur wenige Seiten dieses Buches liest, begreift sofort, was für ein charmantes Understatement das ist. Baum war eine großartige Erzählerin – und ihr Leben derart angefüllt mit Außergewöhnlichem, dass es geradezu schwindelig macht. »Es war alles ganz anders« beschwört die pulsierenden Metropolen Wien und Berlin in einer explosiven Zeit des Umbruchs herauf. Und es führt vor, wie eine starke hochmoderne Frau ihren Weg geht bis nach Hollywood in einer von Männern dominierten Welt. Mit einem Vorwort von Elke Heidenreich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vicki Baum
Es war alles ganz anders
Erinnerungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vicki Baum
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vicki Baum
Vicki Baum, geboren 1888 als Tochter einer jüdisch-bürgerlichen Familie in Wien, gestorben 1960 in Hollywood. Sie war ausgebildete Musikerin und arbeitete ab 1926 als Redakteurin in Berlin. 1932 wanderte sie nach Hollywood aus, wo ihr Roman »Menschen im Hotel« verfilmt wurde. In Deutschland wurden ihre Bücher von den Nazis als »Asphaltliteratur« verfemt und verbrannt. Ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und teilweise dramatisiert und verfilmt worden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sie sei »nur eine einfache Geschichtenerzählerin« gewesen, schreibt Vicki Baum in ihren Memoiren. Wer nur wenige Seiten dieses Buches liest, begreift sofort, was für ein charmantes Understatement das ist. Baum war eine großartige Erzählerin – und ihr Leben derart angefüllt mit Außergewöhnlichem, dass es geradezu schwindelig macht. »Es war alles ganz anders« beschwört die pulsierenden Metropolen Wien und Berlin in einer explosiven Zeit des Umbruchs herauf. Und es führt vor, wie eine starke, hochmoderne Frau ihren Weg geht bis nach Hollywood in einer von Männern dominierten Welt.
Inhaltsverzeichnis
Es war alles ganz anders …
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Nachwort
Bildnachweis
Es war alles ganz anders …
Ganz anders als was? Anders als sie es sich gewünscht hätte, kann Vicki Baums Leben im Grunde nicht gewesen sein, es war ein erfolgreiches, weitgehend doch wohl glückliches Leben. Es war alles anders als in den Romanen? Natürlich war es das, und doch haben Vicki Baums Romanfiguren immer auch viel mit der Autorin und ihrem Leben, Denken, Handeln zu tun – sie gibt in diesen Memoiren zu, oft ein kleines Selbstporträt eingeschmuggelt zu haben. Und da liegt ja auch ein nicht unerheblicher Teil des Erfolges: Hier ging es um echte Menschen, nachvollziehbare Schicksale, bekannte Ereignisse und Orte, die Leser fanden sich selbst und ihre Freuden und Sorgen in Vicki Baums Büchern wieder, und das von allem Anfang an, als es noch Fortsetzungsromane in Zeitschriften waren.
Was also war alles ganz anders? Der Titel dieser unvollständigen Memoiren, die Vicki Baums Schwiegertochter Ruth aus nachgelassenen Manuskripten zusammengestellt hat, sollte eigentlich lauten: »Nicht so wichtig«. So wollte die Autorin ihre Erinnerungen nennen, der Verleger war damals strikt dagegen, fand den Titel unverkäuflich. »Doch mich selbst und auch die Welt als solche nicht zu wichtig zu nehmen«, schreibt Vicki Baum über diesen kleinen Titelstreit, »war das Leitmotiv, der Grundpfeiler meines Charakters und der Leitstern meines Lebens.«
Trotzdem drängt es sie, aufzuschreiben, was war, was wichtig war, was anders war, als man denkt. Als Glückskind hat sie sich immer bezeichnet, als »das abnormste aller Phänomene – ein halbwegs normaler Mensch. Friedfertig, fröhlich, denkbar unneurotisch, ausgeglichen, unbeschwert und stillvergnügt: so wahr mir Gott helfe, eine altmodische Person. Ich habe in meinem Leben jedes bisschen Kummer und Missgeschick durch ein bisschen Glück aufgewogen gesehen.«
Das schreibt sie mit 70 Jahren, und da beschleicht uns Leser dann doch das Gefühl, dass vieles in der Tat ganz anders war. Denn in die Wiege gelegt wurde Vicki Baum das Glück keineswegs, im Gegenteil, die Anfänge waren dazu geeignet, einen weniger starken Menschen zu zerbrechen.
Der Vater ein Hypochonder, gefühlskalt, egoistisch, unfähig zur Empathie: »Der einzige wirkliche Feind, den ich jemals hatte, war mein Vater – falls es andere gab, bemerkte ich sie jedenfalls nicht.« Die Mutter hysterisch, frustriert, nervenkrank, früh und grausam an Krebs gestorben. Die Tochter, die ein Sohn namens Viktor hätte werden sollen und dann ›nur‹ ein Mädchen namens Hedwig wurde, das man Vicki rief, allein mit der Pflege der Mutter, von der keine Liebe zu erwarten war. Eine harte Schule, aber, sagt Vicki Baum nüchtern, eine gute Schule für jemanden, der Schriftstellerin wird. Man lernt das Leben kennen. »Zuerst war die Einsamkeit etwas Trauriges«, schreibt sie, »aber nach einer Weile gehörte sie so zu mir, dass ich stark daran wurde.«
Glück sieht anders aus. Aber sie kann aus den erzieherischen Torturen und Schlägen des Vaters für sich etwas gewinnen: »Sie ließen mir eine Rhinozeroshaut wachsen, machten mich unempfindlich gegen Leiden, geistige wie seelische.« Zum Glück gilt das nicht für ihre Romanfiguren, deren verästelten Seelenschmerzen diese Autorin mit bewundernswertem Instinkt und Feingefühl nachgeht. Und sie weiß auch, dass Glück kein großer, umwerfender Dauerzustand im Leben ist, sondern dass Glück im Duft von Walderdbeeren liegt, in dem Geräusch, mit dem reifes Obst vom Baum ins Gras fällt, im Murmeln eines Baches, in der Dämmerung, die nach einer Nacht am Schreibtisch aufzieht, in dem Moment, ehe im Theater der Vorhang hochgeht. Wer das alles so intensiv empfinden kann, der hat ein Talent zum Glück, und das, sagt Vicki Baum von sich, das habe sie: Sie sei fürs Glück begabt.
Mit Wüstenfuchs Joujou Anfang der Dreißigerjahre in Berlin
Nächstes Bild >
Der größte Teil der Memoiren dreht sich um die verhunzte Kindheit, aus der dennoch so viel Kraft und Zähigkeit erwuchs. Vicki Baum hat sich hier Zeit gelassen, ihre Familie, das damalige Wien, die politische und persönliche Entwicklung in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg genau zu beschreiben. Der Grundstein für ihr weiteres Leben wurde hier gelegt. Sie schreibt ohne Lamento, es wird nicht gejammert, sie analysiert scharf und klug, und das, obwohl sie im Alter von sich selbst sagt: »Ich war und bin auch jetzt noch ein mehr gefühlsbetonter als verstandesmäßig ausgerichteter Mensch.« Immer wieder schreibt sie solche verblüffenden Sätze über sich selbst, der verblüffendste und bekannteste: »Ich bin eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte.«
Das sagt die Frau, die Millionenbestseller schrieb, weltweit übersetzt wurde, deren Bücher von einem Erfolg zum anderen flogen. Sie beharrt darauf, ihren Platz in der Literatur zu kennen, und ich, ihre begeisterte Leserin, beharre darauf: Ihr hätte ein anderer Platz gebührt, einer der literarischen Anerkennung. Auch Vicki Baum wusste: Was sich derart gut verkauft, kann in den Augen der Kritiker keine Qualität haben, obwohl schon ihre allererste Erzählung den Preis einer Jury bekam, der Thomas Mann vorsaß. Als sich Geld und Erfolg einstellten, wurden die Kritiken zunehmend ruppig, die Leser störte das aber nicht, den Broadway nicht, Hollywood nicht: Wir wissen, dass »Menschen im Hotel«, der größte Romanerfolg, dort verfilmt wurde, so dass Vicki Baum Nazideutschland und Österreich deswegen verlassen konnte und sich gerade noch rechtzeitig – ihre Bücher wurden bereits verbrannt, so wichtig waren sie dann doch! – mit ihrer Familie in Amerika niederließ und nie zurück kehrte. Auch die amerikanischen Kritiker mäkelten an ihren Büchern herum, deren Auflagen hoch blieben: Ihr Stil sei zu ornamental. »Es ist wahr«, schreibt sie in ihren Memoiren, »ich glaube es, und ich akzeptiere demütig diesen Verweis. Aber bitte, meine verehrten Damen und Herren von der Literaturbeilage, bitte ziehen Sie einmal die Welt in Betracht, in der ich aufgewachsen bin – die Umgebung, welche diese kritikwürdige, ornamentale Seite in einem jungen Wesen heranbildete, das zu einer Stadt, einem Land gehörte, wo man gerade eine Epoche mit ornamentalem Pomp zu Grabe trug.«
Ich kann an Vicki Baums Stil nichts pompös Ornamentales finden. Sie ist jemand, der ganz genau hinsieht und hinhört, der Nuancen so fein und vielfältig beschreiben kann wie nur ganz wenige Autoren, als »redselig« tut sie das ab: »Ich war und bin eine Epikerin, (…) eine redselige, ausschweifende Erzählerin.« Ihre Dialoge sind umwerfend und hollywoodreif. Auch über ihr eigenes Leben schreibt sie doch eher lakonisch, es fällt auf, dass die wirklich wichtigen Dinge in wenigen Zeilen abgehandelt werden, aber in Nebensächlichkeiten kann sie seitenlang schwelgen – und Ornament ist das nicht, eher listige Ablenkung und Verschleierung. Für Tagespolitik hat Vicki Baum einen unbestechlich klaren Blick, ihr kann man nichts vormachen. Einmal erwischt man sie in ihrer Autobiografie dabei, dass sie sehr wohl um ihre Qualitäten als Schriftstellerin wusste. Sie schreibt:
»In einem Punkt bin ich vielleicht genauso wie Schriftsteller von viel höherem Rang: Ich kann nur mit Romanfiguren arbeiten, die teils aus einem Gefühl des Mitleids, teils aus einem Sinn für das Komische entstanden sind.« Und geradezu trotzig sagt sie über die beiden Bücher, die sie für ihre besten hielt, »Ulle der Zwerg« und »Die andern Tage«: »Sie waren, wenn man mir die Vokabel verzeihen will, Literatur.« Warum aber »Menschen im Hotel« ein Welterfolg wurde, ist ihr unbegreiflich – immer wieder diese Ambivalenz der Selbsteinschätzung: Es war doch alles ganz anders? »Ich lebe, liebe und schreibe gemäß Hofmannsthals Wort aus dem Rosenkavalier ›mit leichten Händen‹.« Was leicht ist, so wird uns ja immer eingehämmert, kann nicht gut sein. Welch ein Irrtum.
Die Tröster ihrer frühen und späten Jahre sind Musik, Tanz, Schreiben. Als ganz junges Mädchen beschließt sie, Musikerin zu werden, studiert Harfe, arbeitet in großen Orchestern als Harfenistin. Das Tanzen befreit und beglückt sie ihr Leben lang, und das Schreiben wird ihr Lebensinhalt und -unterhalt: zunächst als Journalistin beim Ullstein Verlag, dann als Romanautorin. In das alles gibt sie uns interessante Einblicke. Mit ihren Liebesleidenschaften ist sie sehr zurückhaltend – nüchtern werden die Ehen geschildert, die frühe, unglückliche mit Max Prels, die zweite, langjährige mit dem Dirigenten Hans Lert, mit dem sie zwei Söhne hat. Aber es muss Lieben daneben gegeben haben, manchmal wird etwas angedeutet, und am Ende heißt es: »Am schwersten ist es wohl, die Abhängigkeit von Liebe und Geschlechtstrieb abzuschütteln; aber wenn man muss, lernt man es – wie es Millionen vor einem auch gelernt haben.« Wir wüssten vielleicht mehr darüber, hätte sie es noch geschafft, über ihre vielen Reisen zu schreiben, die sie oft ja nicht allein unternahm – doch ihr völlig unerwarteter, schneller und plötzlicher Tod nach einem eher banalen Küchenunfall ließ das leider nicht zu. Aber: »In der Liebe erfuhr man nie, was die Wahrheit war«, heißt es in ihrem Roman »Rendezvous in Paris« und: »Einer weiß so gar nichts vom anderen.« Vicki Baum erzählt viel, aber noch mehr behält sie für sich. Wir dürfen es nur ahnen. 1932 schrieb sie in einem Zeitungsartikel: »Die Bereitschaft, Opfer zu bringen, ist die Basis jeder funktionierenden Ehe, keine Ehe kann halten, wenn nicht beide etwas opfern, und ich meine nicht die ganz kleinen, täglichen Opfer, sondern die großen, herzzerreißenden.«
Das alles, so empfinde ich es beim Lesen dieser Erinnerungen, ist Sprengstoff unter einer glatten Oberfläche. Die erfolgreiche Autorin, die Musikerin, die glückliche Ehefrau und Mutter schreibt: »Ich war, alles in allem, stets eine Musikerin; als Schriftstellerin hatte ich mich (…) gar nicht gesehen, jahrelang nicht. Offen gestanden tu ich’s auch jetzt noch nicht. Nicht ganz.«
Ja, das schreibt sie, und wir spüren: Es war alles ganz anders. Sie war ein unglückliches Kind, eine unterschätzte Schriftstellerin, eine verzichtende Liebende, sie gab die Musik auf für die Familie, und so ist in aller Beherrschtheit, scheinbaren Leichtigkeit, in aller Kraft und Virtuosität um Vicki Baum ein Geheimnis von tiefer Melancholie und eine Ahnung großer Verletzlichkeit. Sie kann sich als Person noch so energisch befreien und disziplinieren: In ihren Romanen haben die Figuren keine Rhinozeroshaut, sie erschüttern uns mit ihrem Lieben, Leiden, Sehnen – und das kann nur eine selbst Erschütterte, Erschütterbare so schreiben. Liest man dieses Buch ganz genau, dann steht das Wichtigste immer beiläufig am Rande oder irgendwo dazwischen. Über das, was sie zerreißt, redet sie nicht. Als sie noch ein junges Mädchen ist und ein Mann sie während der überfordernden Pflege der Mutter auf ihre Verschlossenheit anspricht, denkt sie: »Vermutlich schlüpfte ich in diese harte, verschlossene Schale wie in einen Schutzpanzer. Ich handle noch jetzt so, wenn es mir wirklich schlecht geht. Hat man erst einmal angefangen, zu sprechen und sich zu beklagen, so wird man ein hilfloses Opfer der Selbstbemitleidung …«
In diesem Memoirenbuch lernen wir nicht nur eine faszinierende Autorin kennen, der wir immer nur ein kleines bisschen auf die Schliche kommen – wir lesen auch fabelhafte Porträts von Menschen, dichte atmosphärische Beschreibung der Zeiten vor und zwischen den Kriegen, eine glasklare Einschätzung des amerikanischen way of life, hinreißende Skizzen vom Theaterleben und dem Irrsinn von Hollywood, wo sie letztlich scheiterte »mit meinem kleinen Ameisengehirn. Ich bin für solche Komplikationen zu primitiv.« Vicki Baum erzählt uns fast alles, aber sie hält ihre Seele unter Verschluss. Und doch können wir durch kleine Risse, die sie zulässt, hineinschauen und ahnen: ja, ein glückliches, ein erfolgreiches Leben. Und doch … »Vielleicht gibt es überhaupt keine ganzen Schicksale auf der Welt, nur das Ungefähre, Anfänge, die nicht fortgeführt werden, Schlusspunkte, denen nichts voranging«, heißt es in »Menschen im Hotel«.
In Wirklichkeit also: Es war alles ganz anders.
Elke Heidenreich
1
Kurz nach meinem siebzigsten Geburtstag fuhr ich noch einmal von meinem Heim in Hollywood nach New York. Nirgendwo unterwegs, in keinem der zahllosen, kleinen Antiquitätengeschäfte an den Autostraßen, nirgendwo auf diesen langen dreitausend Meilen durch den weiten Kontinent fand ich auch nur eine einzige Antiquität, die älter gewesen wäre als ich. Da war er wieder, zusammengetragen und für den Verkauf zur Schau gestellt, der ganze verworrene, krause, fransenbesetzte und mit Quasten geschmückte Ramsch, womit die Zimmer meiner Kindheit vollgestopft gewesen waren. Die unhandlichen Küchenutensilien, die ich damals – als Vorbereitung für ein zukünftiges Hausfrauendasein – auf Hochglanz zu halten hatte; die Petroleumlampen mit dem imitierten Bronzefuß, bei deren schlechtem Licht ich oftmals Hausaufgaben gemacht habe; der rührende Kitsch aus geschliffenem Glas, Kerzenleuchter, Zierdeckchen und abscheuliche Bierseidel. In einer gottverlassenen Geisterstadt des Westens begegnete ich einer getreuen Replik der monströsen geblümten Waschschüssel mit Krug aus dem elterlichen Schlafzimmer sowie, passend im Dekor, zwei ebenso gewaltigen Nachttöpfen – für mich die ersten Symbole alles Unappetitlichen und Abstoßenden im Eheleben meiner – und aller – Eltern.
Zeitstücke nennt man diese Dinge in Amerika.
Dies Wiedersehen hinterließ mich sehr nachdenklich und brachte mich dazu, einmal bei meiner eigenen Person Inventur zu machen. Das also ist aus dir geworden: ein Zeitstück, nichts weiter. Weder hinlänglich alt oder vornehm genug, um als echte Antiquität zu gelten, noch jung genug, um in die raue, mechanisierte, schnelllebige Gegenwart zu passen. Wie es die witzige Fürstin Pauline Metternich einmal so treffend ausgedrückt hat, als man ihr zum Geburtstag gratulierte: »Meine Lieben, siebzig ist kein Alter für eine Kathedrale. Aber für eine Frau – oh, mon Dieu …«
Schön, sagte ich mir, wenn ich schon ein Zeitstück bin, dann will ich zunächst ein wenig von der Zeit erzählen, in der ich aufwuchs: vom Wien der Jahrhundertwende.
Eine graue Stadt, wundervoll grau, wie Paris, wie jede dieser sehr alten europäischen Städte, die als römische Kolonialgarnisonen angefangen haben. Gedämpfte Farben überall. Die Donau – nicht blau, wie es in Liedern heißt, sondern von trägem, schmutzigem Gelb. Mit samten-grüner Patina überzogene Kuppeln und Zwiebeltürme und alle anderen Kirchen überragend, der romanisch-gotische Stephansdom in der Mitte der Stadt: eine der ältesten und eindrucksvollsten europäischen Kirchen, um die in konzentrischen Ringen die Stadt gewachsen war, wie die Stämme riesenhafter Mammutbäume sich bilden, Ring für Ring, Jahrhundert für Jahrhundert. Als das Kirchendach mit seinem prachtvollen Doppeladler-Mosaik nach dem letzten Krieg zerbombt dastand, war es das Erste, was die Wiener wiederherstellten – mit amerikanischem Geld, wie ich vermute. Ihre geliebte Kirche und – natürlich – ihr Opernhaus. Wie alle Armen sind sie große Künstler im Überleben, meine Wiener. Was sie am Leben hält, ist weniger ein starkes charakterliches Rückgrat als eine bezaubernde Selbstironie.
Der Verkehrslärm meiner frühen Kindheit: das Klappern von Pferdehufen auf dem granitenen Kopfsteinpflaster; der flotte Trab zweispänniger aristokratischer Equipagen; die munteren Fiaker des wohlhabenden Bürgertums, der schleppende Gang müder Klepper von einspännigen Droschken. Das lustige kleine Hornsignal des hoch auf dem Kutscherbock der schwarz-gelben Postkutsche thronenden Postillions. An Sommerabenden aus unzähligen offenen Fenstern Geklimper auf verstimmten Klavieren – ein scheußliches Stück, das »Gebet einer Jungfrau« hieß, doch hier und da auch klassische Töne, ein Haydn-Quartett, eine Beethoven-Sonate, ein Lied von Hugo Wolf. Der durchdringende, nachdrückliche Warnruf der Feuerwehrtrompete: e-a! Jedes Kind in Wien kannte dieses Intervall und baute darauf seinen Sinn für Harmonie und sein musikalisches Gedächtnis auf. Heute noch, wenn ich in einem etwas chaotischen Stück moderner Musik die Orientierung verliere, finde ich mich vermittels dieser eindringlichen Feuerwehrquarte e-a! e-a! e-a! zurecht.
In den Höfen wurden ewig Teppiche geklopft – der Dienstbotenjazz des alten Wiens, und dazu kamen das vielsprachige Geschrei der Straßenverkäufer, der schrille Singsang der Marktfrauen, das mehrstimmige Rufen der Dienstmädchen aus den Luftschächten der Küchen und, zu jeder Stunde, die Kirchenglocken.
Häufig konnte man eine Karosse mit goldenen Rädern sehen, eine schlanke Gestalt in blauer Uniform darinnen, und eine weiß behandschuhte, unablässig grüßende Hand: der Kaiser! Unser Kaiser, Seine Apostolische Majestät, Franz Joseph I. Wir konnten uns als Kinder nicht vorstellen, dass außer ihm irgendwelche anderen Kaiser existieren könnten. Wir liebten ihn zärtlich – ohne die geringste freudsche Nuance –, den Vater des Landes. Die Landesmutter war bedauerlicherweise abwesend, blieb unsichtbar und war überdies wenig später tot.
Ich erinnere mich, dass wir gerade auf dem Land in der Sommerfrische waren. »Von einem Anarchisten erdolcht«, hieß es in dem druckfeuchten Extrablatt, das mein Onkel von einer Kreistagssitzung mitbrachte. Als die Schreckensbotschaft unser Dorf erreicht hatte, standen die Bewohner bestürzt vor ihren Häusern, und wir weinten alle herzzerreißend in loyalem Schmerz. Das war die erste Extraausgabe in einer unschuldigen Dornröschenwelt. Wer hätte damals gedacht, dass einmal ungezählte Extrablätter mit ihren Schrecken in unser Leben einbrechen könnten?
In Panikstimmung kehrten wir nach Wien zurück. Die Flaggen standen auf halbmast, in den herbstlichen Straßen wehte überall schwarzer Flor, die Menschen trugen Trauer. Der Laternenanzünder, der sonst am Abend im weißen Chirurgenmantel von Straßenlaterne zu Straßenlaterne ging, um das Gas anzuzünden, machte nun die Runde, um die Lampen herunterzunehmen und die Glühstrümpfe abzuschrauben. Als es dunkel wurde, zündete man das frei ausströmende Gas an, und riesige Flammen loderten hoch, flackernde Fackeln im kalten Wind. Die Leute standen barhäuptig auf den Straßen – dichte schwarze Menschenmengen –, und die gedämpften Trommelschläge des chopinschen Trauermarsches hallten durch die Luft. Ich genoss das traurige Schauspiel ungeheuer, und ich bin sicher, dass das Straßenvolk es insgesamt genoss.
Es ist seltsam, sich heute daran zu erinnern, welche Bedeutung der Kaiser für uns hatte, wie nahe er uns stand. Wir teilten sein Leid, seine Kümmernisse, von denen er mehr als genug hatte und noch mehr bekommen sollte. Es war eine Art familiären Zusammengehörigkeitsgefühls; wir respektierten den alten Mann, und jeder kannte seine große Einfalt, seine streng nach einer Seite ausgerichtete Erziehung und seine Eigenwilligkeit, und ohne Hemmungen redete man darüber. Es ist merkwürdig, dass ein Mann so aufrichtig und gleichzeitig solch eine tragische Gestalt sein kann. Es ist merkwürdig, wie viel Unheil die Aufrichtigkeit eines so netten und ernsthaften Mannes, wenn er an hoher Stelle steht, über die Welt zu bringen vermag. Während meines Lebens gab es Franz Joseph, Hindenburg, Eisenhower; wer wird der Nächste sein?
Man kann sich heute nur schwer vorstellen, wie sehr ein Volk sich nach dem Bild seines Souveräns formt. Zu meinem persönlichen Leidwesen hielt unser alter Monarch auf eiserne Strenge und steife Etikette, vielleicht aus Protest gegen eine Einwohnerschaft schlampiger, enthusiastischer Sybariten. Und ich musste deshalb, unter leichten Baumwolldecken zitternd, in ungeheizten Zimmern schlafen, auf der härtesten, dünnsten Matratze, die zur Verfügung stand. »Wenn das warm genug für den Kaiser ist, dann ist es auch warm genug für dich«, erklärte mein Vater. Mit dem Morgengrauen aufstehen, eiskaltes Wasser über meinen steifen, unterernährten Körper schütten, dann einen Becher voll blassen Kaffees und ein trockenes Brötchen zum Frühstück – genau wie der Kaiser. Und so den ganzen Tag hindurch. Ein Klosterleben.
In Wien nannte man die Toilette den Ort, »wohin der Kaiser zu Fuß geht«. Und als eine wohlmeinende Freundin mich in das Geheimnis einweihte, auf welche Weise ein Mann und eine Frau zu Kindern kommen, lehnte ich es einfach ab, ihr zu glauben. »Der Kaiser würde so etwas bestimmt niemals tun«, sagte ich, und damit war die Angelegenheit erledigt.
Das Wien, in dem ich aufwuchs, war eine bezaubernde Stadt. Vom Wienerwald umgeben, in dem es üppig blühte, lebte man eng verbunden mit der Natur. Die herrlichen Parks der kaiserlichen und Adels-Paläste waren unsere Spielplätze, ihre Springbrunnen und Teiche, Rosskastanienbäume und Fliederbüsche, die sanft geschwungenen Rasenflächen, streng angelegten Beete und gestutzten Hecken unsere intimen Freunde. Tagsüber war Wien eine lebendige Stadt, rhythmisch beschwingt, nicht in der tobenden Lautstärke von heute. Nachts wurden die Straßen still und dunkel, und alles Leben, alle Fröhlichkeit zogen sich in die Häuser zurück. Es war nicht im Mindesten das, was die Leute sich allgemein unter Alt-Wien vorstellen. Bars und Nachtklubs gab es damals noch nicht, und unter einem Touristen verstand man nicht einen Ausländer, der mit einer Reisegesellschaft unterwegs ist, sondern einen zünftigen Eingeborenen in Lederhosen, der sein ganzes Glück in möglichst schwierigen bergsteigerischen Leistungen sah.
Nicht, als ob diese ruhigen Zeiten nicht auch ihre Gefahren gehabt hätten, oh, es gab eine Menge! Petroleumlampen explodierten, desgleichen Kachelöfen – aus unerfindlichen Gründen; besonders das Prachtstück in unserem Esszimmer und mit Vorliebe dann, wenn Gäste erwartet wurden und die Tafel mit dem besten Leinen und Porzellan gedeckt war. Häuser brannten nieder, bevor die von Pferden gezogene Feuerspritze eingreifen konnte, und nicht wenige unschuldige Menschen kamen durch ungeschickte Handhabung des neumodischen Gases zu Tode. Auf den Straßen scheuten Pferde, und harmlose Passanten starben unter den Rädern der Wagen. Einmal habe ich einen solchen Unfall gesehen, allerdings – was ich damals sehr bedauerte – nur einen Auszug davon, da Mama meine Augen mit ihren Händen zuhielt. Doch ich hatte immerhin noch den Strohhut der überfahrenen Dame erspäht, wie er mit all seinen Bändern, Patentknöpfen und Kirschen die Straße hinunterrollte. Ich habe das Bild jetzt noch so klar vor Augen wie meine Hände auf der Schreibmaschine.
Eine andere Gefahr für Kinder und Erwachsene gleichermaßen verkörperte der Wiener Hausmeister – ich will ihn einmal Pitzelgruber benennen. Nicht so barsch wie ein deutscher Portier, nicht so zugänglich wie die französische Concierge, nicht so gleichgültig wie ein amerikanischer Pförtner, ist der Hausmeister ein unübersetzbares exklusives Wiener Produkt, tyrannisch und misstrauisch, angefüllt mit gehässigem Klatsch und Neid, argusäugig und mit großen Handflächen zur Entgegennahme von Trinkgeldern und Bestechungsgeschenken ausgerüstet. Herr Pitzelgruber weiß mehr über dich als du selbst. Er hält sich und die anderen gut informiert über deine Vorgänger, deine Stellung, dein Einkommen und Haushaltsgeld, deine religiöse Überzeugung, deine Ehe, deine Verwandten, Kinder, Freunde und Besucher; vor allem über die späten Besucher, denen er grundsätzlich und gründlich misstraut und die er aller Arten von moralischen, politischen und religiösen Defekten verdächtigt.
Um zehn Uhr abends verschließt er die Haustür, zu der außer ihm kein Mensch einen Schlüssel hat. Zumindest verhielt es sich so, als ich ein Kind war, und die bemerkenswerte hausmeisterliche Machtposition begründete sich darauf. Wollte man nach zehn hinein oder heraus, so hatte man zu klingeln und zu warten; einige Male zu klingeln und zu hoffen, dass er aufwachen und einen hineinlassen würde und dass die späte Stunde nicht den Ruin des Rufes bedeutete. Und während die Hand den vorgeschriebenen Obolus fest umklammert hielt, konnte man schließlich die pitzelgruberschen Filzpantoffeln zur Tür schlurfen hören, sein vorwurfsvolles Nörgeln sowie den chronischen Husten und Schlüsselgeklapper; wenn er dann die Tür öffnete, schoss einem unvermutet ein Lichtstrahl in die Augen, und man fühlte sich wie vor der Geheimpolizei.
Die Pitzelgrubers waren überzeugte Anhänger des Zweiparteiensystems. Ihre Methode des Selbstschutzes, stets beiden Seiten anzugehören, zeigte sich besonders wirksam, als sie die rot-weißen österreichischen Embleme diskret beiseiteschafften und die Hakenkreuzfahnen enthüllten, die sie in weiser Voraussicht für den Tag des Anschlusses bereitgehalten hatten.
Es lohnte sich nicht, so viele Worte auf die Spezies Pitzelgruber zu verschwenden, wenn sie nicht das Rückgrat der österreichischen Nazi-Bewegung gewesen wären, Prototypen von Hitler selbst.
Etwas anderes, woran ich mich aus dieser Zeit erinnere, ist die Sache mit dem dritten Pferd. An Sonn- und Feiertagen beförderte uns in der Regel ein Pferdeomnibus in einen kleinstädtischen Vorort, wo wir Freunde meiner Eltern, die dort eine Villa besaßen, besuchten. Heute ist das überhaupt keine Entfernung, doch damals bedeutete es eine kleine Expedition. Rumpelnd und ratternd verließ das Vehikel, von einem Pferdegespann über das Kopfsteinpflaster gezogen, zunächst das eigentliche Zentrum. Waren wir in die Mariahilferstraße eingebogen, eine geschäftige Einkaufsgegend, so wartete ich schon gespannt auf die Zeremonie, die jetzt gleich vonstattengehen würde. Wo in früheren Zeiten die Stadtmauern gestanden hatten, war eine kaum merkliche Steigung hinterblieben. An dieser Stelle nun erschien unfehlbar und für meinen kindlichen Verstand unerklärlicherweise ein uniformierter Mann, der ein Pferd aus einer schmalen Seitengasse führte. Dieses dritte Pferd wurde vorgespannt, und mit viel Wirbel und Peitschenknallen und großer Betriebsamkeit ringsum rumpelte der Omnibus weiter, und Pferde wie Kutscher strengten sich mächtig an, uns über diese kritischen fünfzehn Meter hinwegzumanövrieren; war es geschafft, so wurde das dritte Pferd wieder ausgespannt und verschwand in der Gasse.
Dieses kleine Transportdrama aus alten Tagen kommt mir manchmal in den Sinn, wenn ich von einem Wolkenkratzer oder von irgendeiner Anhöhe in die Tiefe schaue und das unwahrscheinliche Gewirr von Straßen beobachte, auf denen sich der Verkehr unseres gewaltigen Ameisenhügels Los Angeles wie von einer unendlichen Spule abwickelt. Ein gigantisches Muster von Schleifen und Kleeblättern, Überführungen und Unterführungen, achtspurigen Asphaltbändern, auf denen die Autos in entgegengesetzten Richtungen dahinkriechen, Stoßstange an Stoßstange, Tag und Nacht. Und Hubschrauber darüber, die auf die unvermeidlichen Unfälle und Verkehrsstauungen warten; hoch oben Düsenflugzeuge, die ihre weißen Spuren in den sternenlosen Himmel schreiben; und in unvorstellbaren Entfernungen von Menschenhand geschaffene Satelliten, die auf ihrer Bahn kreisen, Parabeln zeichnen, Botschaften senden oder verglühen, explodieren, spurlos verschwinden. Und noch weiter jenseits streben ungezählte unbekannte Milchstraßen immer ferneren Horizonten zu: während wir unser eigenes kleines Universum zwingen, mehr und mehr von seinen Geheimnissen preiszugeben.
Es ist zu viel – so sage ich mir selbst –, einfach zu viel, zu viel Fortschritt für den Zeitraum eines einzigen Menschenlebens. Wir sind zu schnell zu weit gekommen. Diese Welt ist nicht mehr derselbe Planet, auf dem ich geboren wurde …
Und hier werde ich immer ein bisschen schwindlig. Und furchtsam außerdem; ich fühle mich in der gleichen Weise elend und ohnmächtig wie schon als Kind, wenn ich versuchte, mir diese Dinge ohne Ende, die Unendlichkeit, vorzustellen.
Es gibt in jedem von uns bestimmte Bereiche für Ängste, deren Gegenpol bestimmte Bereiche des Mutes sind. Wir sind alle gleich konstruiert: zu fünfzig Prozent Held, zu fünfzig Prozent Feigling. Ich für meine Person bin und war immer ein Feigling, was Lärm und Geschwindigkeit angeht; und ich begegne allen technischen Apparaten einschließlich Telefon und Mixer mit leiser Angst. Sie mögen mich ebenso wenig. Und sie könnten einmal explodieren, nicht wahr?
Ich passe ganz entschieden nicht in unsere Zeit.
Auf der anderen Seite verzweifle ich dafür nicht so leicht in unangenehmen Lebenslagen. Ich fürchte mich nicht vor Krankheit und Operationen – soweit es sich um meine eigenen handelt –, ich fürchtete mich noch nie vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein in einem Haus, vor Einbrechern, Mördern und Ungeheuern. Auch nicht vor dem Tod, würde ich sagen, wenn das nicht so hochtrabend klänge …
Den ersten Schrecken, den ich in Erinnerung habe, jagte mir die Tapete in unserem Esszimmer ein.
Sie hatte ein hässliches, ekelhaftes Braun und ein schwarzes Muster. Doch ich, ein Baby auf dem Arm der Kinderschwester, kann ein Muster natürlich noch nicht begreifen. Ich kann nur zahllose kleine schwarze Kreaturen sehen, die über die Wand kriechen und, zu dichten Klumpen zusammengeballt, aufeinander zustürzen. Wer sind sie? Was werden sie mir antun. Ich fange zu schreien an, niemand weiß, warum, und die großen Gesichter der beiden Riesen, die zu mir gehören, erscheinen. Ich erkenne sie mehr an ihrem Geruch als an ihrem Aussehen. Das eine, das weich und rosig ist und manchmal mein Gesicht leckt, mag ich. Aber das andere, das mit dem stachligen Fransenvorhang über dem dunklen Loch, welches der Mund ist, kann ich nicht ausstehen. Es ist ein schrecklicher Tumult um meine Person, ihre großen Hände ziehen mich dahin und dorthin, schütteln mich, klopfen auf mir herum, rütteln mich, bis meine letzte Mahlzeit aus Haferschleim und Milch hochkommt, sauer und bitter, und ich schnell der Kinderschwester wieder ausgehändigt werde, die mich unter viel tschechoslowakischem Fluchen und Schelten in mein Gitterbett zurückträgt. Meine nächste große Angst kam im Sommer mit dem Drohnen und Zischen, Krachen und Blitzen der Feuerwerke und dem Gejohle des Volks zu Kaisers Geburtstag. Ich vermute, dass sich damals die Furcht vor Lärm und Geschwindigkeit in meinen Knochen und Nerven festsetzte.
Ich war ungefähr drei Jahre alt, als ich mich zum zweiten Male mit einem Muster aus schwarzen Punkten und Strichen beschäftigte, einem ganz anderen allerdings. Ich sitze auf dem Boden, so ernsthaft und konzentriert meinen Untersuchungen zugewandt, wie es nur Dreijährige sein können. Diesmal sind die Punkte und Striche hübsch; winzige Männchen, winzige Bilder, freundliche Winzigkeiten – sie stürzen nicht wild aufeinander zu, sondern marschieren in artigen Kolonnen schnurgerade ihre kleinen Straßen entlang. Einige sind dick, andere dünn, und bei verschiedenen handelt es sich ohne Zweifel um Erwachsene. In einem Wort, was ich vor mir habe, sind Druckbuchstaben. Die Abendzeitung. Oder vielleicht auch das Buch, das Mama auf dem blauen Sofa liegen gelassen hat. Es war als Objekt meines Forschungsdranges verboten. Ein paar Monate später, als ich mir Lesen beigebracht hatte, stellte sich heraus, dass das Buch einen absolut albernen, schwierigen Titel trug: »Problematische Naturen« von Friedrich Spielhagen. Daraus konnte man ebenso wenig schlau werden wie aus der Tapete. Es war damals, wie ich nach Jahren herausfand, ein Bestseller, ein Vorläufer billiger bürgerlicher Dekadenz. Ich entsinne mich noch, dass an irgendeiner Stelle dann beschrieben war, wie der Wind Staub und Papierfetzen durch die Straßen fegte. Es waren die einzigen Zeilen, die ich verstehen konnte, weil ich so etwas selbst schon beobachtet hatte.
Ich könnte nicht sagen, nach welcher Methode ich so früh lesen lernte – das unbeschwerte Gehirn eines kleinen Kindes begreift eben die Bedeutung von Zeichen noch sehr leicht. Jedes Kind kennt heute die Verkehrszeichen, das »Warten« und »Gehen«, das X einer Kreuzung, das S einer scharfen Kurve. Buchstaben sind vom gleichen Stoff. In meiner Kindheit lernte ich durch die Straßenschilder. Wir wohnten in der Elisabethstraße – ein langes, irgendwie verwirrendes Wort, aber nach wiederholtem Üben fand ich heraus, dass der Laut E sich mit dem Buchstaben E deckte; allerdings, um die Sache wieder zu komplizieren, trat noch ein anderes, kleineres e in Elisabeth auf. Das, so erklärte mir das Kindermädchen, verhielt sich genauso wie mit ihr, die wir die kleine Katl nannten, zur Unterscheidung von der großen Kati, die in der Küche regierte. Nach solcher Unterweisung war es eine Spielerei, in die Operngasse einzubiegen und sich vor Augen zu halten, wie der Laut O aussah: rund und in gewisser Beziehung überrascht: O? O! Meine zunehmende Geschicklichkeit im Umgang mit Buchstaben war eine Quelle großen Vergnügens für mich, obwohl ich noch nicht die blasseste Ahnung davon hatte, dass die Worte, die ich so auseinanderlegen und zusammensetzen konnte, eine Bedeutung besaßen. Das kam eines Tages wie eine Offenbarung über mich, als mir die Verse eines lustigen Bilderbuches, die ich auswendig konnte, beim Betrachten mit einem Mal ganz klar erschienen und weitaus attraktiver als die Bilder.
Inzwischen hatte ich aber mein Interesse noch auf eine andere Art winziger schwarzer Kreaturen ausgedehnt: die überall auffindbaren Ameisen.
In einem Park oder während des Sommers auf dem Land wurde ich niemals müde, dieses geschäftige kleine Völkchen zu beobachten und die Erwachsenen mit Fragen zu quälen; immer wieder wollte ich von ihnen erzählt haben – mehr, bitte, noch mehr, erzähl mir alles über sie … Ich hielt sie für schön, und sie erinnerten mich an glänzende, süße Brombeeren; meine anfänglichen Versuche, sie zu fangen und zu verspeisen, endeten allerdings, wie vorauszusehen, mit brennenden roten Flecken auf meiner Haut und lautem Gebrüll um Beistand. Nachdem mir die Ameisen auf diese Weise Respekt beigebracht hatten, wurden wir große Freunde. Ihre Häuser, Hügel und Höhlen waren so geschickt angelegt, auf ihren Wegen wimmelte es von kleinen Wanderern, und sie waren solch lustige Clowns, wenn sie versuchten, eine Beute, eine Jagdtrophäe heimzuschleppen, die zehnmal so groß war wie sie selbst. Es lohnt sich auch, sich von ihnen bei gegenseitiger Unterstützung unterweisen zu lassen, die Bruderschaft der Ameisen zu studieren. Lasse eine Ameise auf ihrem Weg Zeichen von Erschöpfung zeigen, verletzt sein oder krank, so kommt es sofort von allen Seiten angeeilt – noch ehe sie »Hilfe« sagen kann – und schleppt den leidenden Gefährten, zieht ihn, trägt ihn, befördert seine Bürde und ihn selbst zurück zum heimatlichen Hügel. Oder nimm die Mühe, welche sich die Ameisen mit jenen weißlichen Gebilden, den Puppen, geben, die wir fälschlicherweise Eier nannten. »Komm, wir spielen Erdbeben«, schlug der bucklige kleine Ziegenhirt, der beste, klügste, liebste Freund meiner Kindheitssommer, manchmal vor. »Ich such’ den Stock, und du schaust, dass du einen alten Kopfkissenbezug kriegst«, erklärte er.
Für den Fall, dass jemand ebenso klugen Freund nie besessen hat, will ich erklären, was er tun muss: Man breite den weißen Bezug neben dem Ameisenhaufen aus und erzeuge mittels eines Stockes ein ordentliches, starkes Erdbeben, eine Katastrophe, ein Unheil. Ein paar Sekunden lang herrscht Panik in dem aufgestörten Hügel, doch dann gewinnt der Instinkt für Organisation die Oberhand. Sie schaffen die Eier heraus, suchen nach einem sicheren Platz, wo sie sie deponieren können, und entdecken die einladende, friedliche Fläche. Vielleicht ist es ein angeborener Nachahmungstrieb, der sie ihre kostbaren Bündel auf den weißen Kopfkissenbezug legen lässt. Wenn man Ameiseneier braucht – beispielsweise zum Angeln, so hat man nichts weiter zu tun, als die winzigen Dinger in die mitgebrachte Tüte zu schütten.
Wenigstens verhält es sich in der Theorie so; es gelingt nicht immer. Manchmal scheuen die Ameisen, gewarnt durch den menschlichen Geruch, vor dem weißen Feld zurück und graben mit unglaublicher Geschwindigkeit neue Liliput-Zufluchtshöhlen, um ihre Nachkommenschaft darin zu betten. Wieder einmal ist die Zukunft der Spezies oder zumindest die eines Stammes gesichert. Sepp lacht mit zögerndem Respekt: »San zu g’scheit, die Krüppel!«, meint er. »Die machen an Fehler net zweimal. Müss’n schon amal a Erdbeben erlebt haben und die Eier verlor’n.«
Was aber soll ich davon halten, wenn dieselben ordentlichen, sauberen, gut organisierten und selbstlosen Ameisen, so bemüht um Nahrung und Existenz, so besorgt um die Aufzucht ihrer Nachkommenschaft, in voller Rüstung ausmarschieren, um andere Ameisenhügel, Ameisenländer, ja sogar andere Ameisenkontinente zu bekriegen? Am Abend ist das Schlachtfeld mit kleinen Leichen übersät. »Sind sie verrückt? Warum fangen sie Krieg an?«, frage ich. Sepp zuckt die Schultern. »Weil Ameisen immer Krieg g’habt haben und immer haben werden«, erklärt er weise. Das ist ein Philosoph, mein Sepp!
Es ist nicht länger zu verschweigen, dass die Fundamente meiner eigenen Weltanschauung dieser kindlichen Beschäftigung mit Ameisen entstammen.
Das Schlimme bei den Ameisen ist, dass sie nicht wissen, wie klein sie sind. Sie haben keine Vorstellung davon, wie viele Ameisenhügel es in den Wäldern gibt. Sie kennen nur ihre eigenen und vielleicht noch ein paar andere, die nahe genug liegen, um Krieg gegen sie führen zu können. Möglicherweise haben sie eine vage Ahnung von dem Dutzend Ameisenhügel auf unserem kleinen Abhang, den Sepp Afrika getauft hat. Vielleicht haben sie einmal davon gehört, dass andere Abhänge existieren, andere Lichtungen in den Wäldern um unser Dorf herum. Doch hier gerät man schon in den Bereich der Fabel. Dass es allein in dieser einen kleinen Provinz unzählige solcher Wälder gibt, dass die Welt unzählige Provinzen, andere Länder, andere Kontinente kennt und dass überall Ameisen wohnen – es muss unvorstellbar für sie sein. Ameisen werden niemals wissen und könnten mit diesem Wissen gar nicht leben, wie klein und unbedeutend sie innerhalb eines derart unermesslichen Ameisenuniversums sind.
Wie mochte Gott in den Augen der Ameisen aussehen? dachte ich weiter. Wie eine Ameise von mythischer Größe und Macht? Oder wie wir, Sepp und ich, die Erdbeben veranstalteten, die ihnen heute eine ausnehmend lange Blindschleiche als milde Gabe brachten, damit sie ihre Vorratskammern füllen konnten, um am nächsten Tag ihr Land zu zerstören und es in eine Wüste zu verwandeln? Haltet euch nicht für so ungeheuer wichtig, ihr kleinen Ameisen, ermahnte ich sie streng. Auch zu mir selbst habe ich das bestimmt viele Tausend Male gesagt, es hilft einem, das innere Gleichgewicht zu bewahren …
Die Parallele zur Menschheit leuchtete sogar mir als kleinem bezopftem Gnom aus der Grundschule ein. Und darauf ist es auch zurückzuführen, dass mir persönlich die Idee eines Gottes, der vom Himmel herunterschaut, unsinnig vorkam. Es gab noch andere Wälder, andere Länder, andere Welten dort oben. Als ich zehn war, hatte ich bereits den überheblichen Glauben verloren, dass Gott in irgendeiner Weise nach mir fragte, und ich bildete mir auch nicht ein, dass wir, die menschliche Rasse, die Krone und der Endzweck der Schöpfung seien. Ich begann mir eine eigene Vorstellung von Gott zu formen, meine eigene Religion, wenn man es so nennen will; einen Glauben an ein ewiges Gesetz und eine ausgewogene Ordnung dort oben, draußen; und an das innere Gesetz und die Ordnung, die jedes Lebewesen in sich trug, das auf dieser und auf anderen Welten lebte. Amen.
Sobald ich die Freuden des Lesens entdeckt hatte, fing ich an, um ein eigenes Buch zu betteln. Und es kam der unvergessliche Augenblick an meinem vierten Geburtstag, als ich beim Erwachen durch den grünen Tüllvorhang meines Gitterbettes das Buch auf meiner sauber zusammengefalteten Unterwäsche und meinen schwarzen Strümpfen erspähte. Auf dem Umschlag war ein Bild, und innen gab es andere Bilder, und der Titel hieß: »Gute Menschen – Edle Taten«. Ich las dieses Buch viele Jahre lang immer wieder; es hat meiner armen, vier Jahre alten Persönlichkeit großen Schaden zugefügt und mich, wie ich befürchte, in mancher Beziehung für mein ganzes Leben ruiniert.
Da gab es den Jungen, der mit seinem Finger die Bruchstelle eines Deiches zuhielt, und den jungen Griechen, der in eine Erdspalte sprang, die den Boden zerrissen hatte, damit die Götter, befriedigt durch sein Opfer, die Erde über seiner Leiche wieder schlössen.
Da war der Schweizer Held Winkelried, der mit starken Armen die feindlichen Speerspitzen ergriff und sie sich in die Brust bohrte, um so für seine Freunde eine Bresche zu schaffen. Aus jeder Seite quollen gute Menschen und edle Taten – mit den zugehörigen Illustrationen. Unerreichbare Höhen der Güte, Tapferkeit und Selbstaufopferung waren es, übermenschlich, hoch über und jenseits dessen, was man unter Pflichterfüllung verstand. Es hätte ein unerträglich dünkelhafter Tugendbold aus mir werden können, da ich begreiflicherweise nach gleicher Güte und Größe strebte und davon träumte, Babys aus brennenden Häusern zu retten oder mich scheuenden Pferden entgegenzuwerfen. Glücklicherweise besaß ich aber genügend Abwehrinstinkt und tief in mir eine gesunde natürliche Veranlagung als Gegengewicht für die engelsgleiche Märtyrerin, die ich zu werden anstrebte.
An meinen vierten Geburtstag erinnere ich mich deshalb so gut, weil ich bis dahin ein glückliches Kind war. Danach geschahen einige Dinge, die wie Wolken und dunkle Schatten über mir hingen.
Vor allem erkrankte meine Mutter. Nicht, wie ich es von mir kannte, an Masern oder Halsentzündung und hohem Fieber, sondern an etwas Unbegreiflichem, Unfassbarem.
»Sei still, deine Mama ist nervös«, wies mich die kleine Katl zurecht. »Komm, bleib bei mir in der Küche, aber mach keinen Lärm! Deine arme Mama hat heut Nacht kein Aug zutun können, und jetzt möcht’ sie ein biss’l ausruhn«, ermahnte mich die dicke, warmherzige große Katl, die ich viel lieber mochte als die kleine, mausgesichtige. »Hör gut zu, du bist jetzt schon ein großes Mädchen und alt genug, um dich anständig zu benehmen und Mama nicht verrückt zu machen«, schalt Papa, der in meinen Ängsten die Stelle des Feuerwerks, tosenden Lärms und der Esszimmertapete eingenommen hatte.
Beladen mit der Verantwortung für Mamas Nerven und Gesundheit, alterte ich beträchtlich. Und noch mehr, als im selben Jahr mein Großvater starb, der liebe, hässliche, schielende, kleine alte Jude, die einzige Person, die mir das Gefühl eingab, geliebt zu werden, mein engster Freund und Spielgefährte, der niemals zu der feindseligen Clique der Erwachsenen zu gehören schien, der mir niemals einen Tag älter vorgekommen war als ich selbst.
Es wäre sicherlich passender, wenn ich den ausgetretenen Pfaden folgte, die in Lebensbeschreibungen gewöhnlich begangen werden, und mich der Armut und des Elends rühmte, woraus ich mich nur durch Mut und Willensstärke zu erfolgreichen Höhen erhob. Das ist es aber nicht, lieber Leser. Wenn ich eine unglückliche Kindheit hatte, was tatsächlich der Fall war, so liegen die Gründe dafür nicht so greifbar an der Oberfläche. Armut und Hunger – und eigentliches Elend noch nicht einmal – kamen erst viel später (vor dem letzten Krieg gab es einen anderen Krieg, erinnern Sie sich? Und Deutschland verlor ihn); als Kind habe ich niemals bezweifelt, dass wir feine, reiche Leute waren. Ich glaube überhaupt nicht, dass ein kleines Kind jemals seine Familie für arm hält; es sei denn, man erzählt es ihm unentwegt, Eltern und Nachbarn trichtern es ihm ein, der Sinn für Neid und erbittertes Konkurrierenwollen wird frühzeitig in ihm herangezüchtet.
Das sorglose, unbekümmerte Österreich war, obgleich eine Monarchie, so demokratisch, wie Amerika es vermutlich niemals werden kann. Da gab es keine Jones, mit denen man sich messen wollte, keine so streng aufeinanderschichtende Gesellschaftsidee, wie ich sie in Amerika gefunden habe, und ganz bestimmt keine Gesellschaft, die sich nach Reichtum und Einkommen staffelte. Es waren natürlich gewisse Zeichen, die uns als solide, gute Mittelklasse auswiesen, vorhanden. Wir lebten im ältesten und zugleich besten Stadtviertel Wiens, und unsere Wohnung lag in einem protzigen Haus, dessen Erbauer sich hinsichtlich Großartigkeit am Palazzo Pitti in Florenz orientiert haben musste – mit gewaltigen Karyatiden, die nichts zu tragen hatten, großen, hohen Räumen, enormen Doppeltüren und Parkettböden, deren Glanz die beiden Katls auf die Weise erhielten, dass sie stundenlang mit gewachsten Bürsten unter den Füßen eine Art Schlittschuhlauf vollführten. Schwere, mit abscheulichen Schnitzereien verunzierte Möbel gab es da und genug schwarzen Marmor, um ein Monument daraus zu bauen. Des Weiteren hatte sich unser Heim niemals von all den riesigen Hochzeitsgeschenken erholt, den Kandelabern, Schalen und dreistöckigen Obstständern, und der Umgang mit den viel zu schweren, üppig ziselierten silbernen Bestecken war eines meiner ersten Probleme.
Jeden Morgen erschien der Friseur, um sich Mamas Coiffure anzunehmen – ein unfehlbares Zeichen von Vornehmheit. Er hieß Hering, und er sah auch so aus. Mir erschien es gar nicht ausgeschlossen, dass er aus einem Märchen entlaufen war, dünn und schleimig, mit dunklen Ringen um die runden roten Augen – ein Prinz vielleicht, der von einem Zauberer in einen Fisch verwandelt worden war? Er entzündete seinen Spiritusbrenner und setzte seine zwei Brennscheren in Tätigkeit; der Raum begann nach dem versengten Papier zu riechen, an dem er ihre Hitze erprobte, und nach rosenduftendem Haaröl, das seine Spinnenfinger zärtlich über Mamas vollendete Haarpracht verteilten. Seine Konversation mit Mama führte er auf Französisch, das er erstaunlich schnell heraussprudelte, mit Wiener Dialektfärbung allerdings. Meine Eltern sprachen beide gut Französisch, und die kleine Katl wurde sehr bald durch eine Mademoiselle ersetzt, streng nach der damaligen Erziehungsschablone. Ich weiß noch, dass ich Mademoiselle gut leiden konnte, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie sie aussah und was für ein Mensch sie war. Ich fand es herrlich, Französisch via »Ali Baba et les quarante Voleurs« zu lernen, und bald litt und triumphierte ich mit George Sands »Petite Fadette«.
Als jedoch Mamas Nervenzustand sich verschlechterte, anstatt sich zu bessern, wurden mir Mademoiselle und ihre schönen französischen Bücher entzogen. Mein Französisch hat sich nie mehr ganz von dem Schmerz und dem Schock dieses plötzlichen Verlustes erholt – zumal Mademoiselles Platz von einem grimmigen weiblichen Wachhund eingenommen wurde. Sie sah aus wie ein Polizist in Frauenkleidern, die so steif gestärkt waren, dass sie bei jeder Bewegung knisterten. Sie hatte enorme Füße, die zwischen Schlafzimmer und Küche hin und her trampelten, dass die Hängelampen ins Schwanken gerieten. Frau Spandauer hieß diese Furcht einflößende Witwe mit dem Granitkinn. »Lass mich in Frieden, ich hab keine Zeit für dich«, schrie sie mich an und presste dabei die Hände an die Schläfen, um ihre Verzweiflung zu demonstrieren. »Deine Mutter, das ist ein Fall, o Gott!« Ein paar Male sah ich sie förmlich mit Mama ringen, aber welche Chance konnte schon meine bedauernswerte, zerbrechliche Mutter gegen eine solche Elefantendame haben! Und was sollte ich machen, wenn die arme Mama mit einem nassen Handtuch geschlagen wurde, schreiend ins Schlafzimmer gestoßen oder getragen, gewaltsam ausgekleidet und zu Bett gebracht? Nach und nach begriff ich, dass Frau Spandauer nicht als Kindermädchen oder Erzieherin für mich angestellt worden war, sondern für Mama – in ähnlichem Sinn.
Mein Halt in diesen Jahren war die große Katl, meine Zuflucht die Küche, mein ganzes Glück, dass Katl mich an ihrem Liebhaber teilhaben ließ. August gehörte zu den sorgfältig ausgewählten kaiserlichen Wachsoldaten, war aufregend schön, groß und stark, und sein Schoß war der wärmste, angenehmste und weichste Platz auf Erden.
Ich glaube allerdings, dass August bei mir ein kleines Trauma hinterlassen hat: Ich habe niemals meine Empfänglichkeit für gutes männliches Aussehen überwinden können; männlicher Intellekt interessiert mich erst in zweiter Linie …
Mein Vater war ein schrecklicher Hypochonder, der dabei keinen Tag Krankheit in seinem ganzen Leben gekannt hat. Er starb, als er dreiundneunzig war, und hätte gut auch hundert werden können, wenn er nicht während des Krieges bei einem unrühmlichen Massaker in einer Stadt namens Novi Sad in Jugoslawien ermordet worden wäre.
Doch das gehört in ein anderes Kapitel.
Beim leisesten Schnupfen, den irgendwer im Hause hatte, rief Vater nach der Tasche. Diese Tasche hätte einem Arzt gehören können; sie war so abgeschabt, als sei sie niemals neu gewesen. Während Katl Vaters Sachen packte, durchmaß er mit ungeduldigen Schritten das Zimmer, die Lippen zusammengepresst und ein Handtuch als Schutz gegen Ansteckungskeime fest vors Gesicht gedrückt. Ohne den Mund zu öffnen, murmelte er mir einige strikte Mahnungen zu, die sich auf mein Benehmen bezogen, und verschwand, samt Tasche, zu seiner Mutter.
Der Vater
< Vorheriges Bild|Nächstes Bild >
So war es natürlich unvermeidlich, dass er auch auszog, als es Mama zunehmend schlechter ging. »Ich brauche meinen Schlaf, ich muss arbeiten. Wenn ich das Geld nicht verdiene, wer soll es dann?«, schrie er. »Allmächtiger Gott, diese Ausgaben! Großer Gott im Himmel, warum strafst du mich so, was habe ich getan, um eine kranke Frau zu verdienen? Hör zu, Vicki, ich kann hier nicht bleiben, oder ich verliere auch den Verstand. Das verstehst du doch, nicht wahr? Du bist jetzt ein großes Mädchen. Du verhältst dich still, bist artig und passt auf deine Mutter auf, verstanden?«
Unter der wachsenden Last der Verantwortung hörte ich förmlich meine Gelenke knarren, und mein Kopf schien manchmal dem Platzen nahe. Gewiss, ich war ein großes Mädchen. Alt, älter als irgendjemand, den ich kannte. Eine kleine alte Frau von fünf Jahren war ich, gesetzt, ernst und mit mehr Sorgen und Tugenden ausgestattet als jetzt.
Doch all mein gutes Betragen nützte nichts; Mama ging es nicht besser, sondern immer nur schlechter. Sie konnte jetzt nicht mehr schlafen, sie konnte nicht essen. Sie verlor an Gewicht, sie wurde so dünn, dass sie kaum mehr einen Schatten warf. Es gab Weinkrämpfe, Wutanfälle, konvulsivische Zuckungen und Schreie. Ihr dichtes weizenfarbenes Haar wurde dünn und trocken wie Heu, und Herr Hering kam nicht mehr. Arme Mama, sie hatte solch winzige Füße, die in ihren Puppenschuhen – von denen man nicht wusste, ob man über sie lachen oder weinen sollte – stets kalt waren; winzig kleine Hände, die sie nicht eine Sekunde stillhalten konnte. Ihre großen Augen erinnerten nun an Untertassen, wie die Augen des Hundes in »Ali Baba und die vierzig Räuber«. Niemals zuvor hatte ich Mama so verzweifelt geliebt wie zu der Zeit, als sie so zerrissen, verschroben und hässlich war. Niemals habe ich sie so verabscheut wie damals, als ich fühlte, dass sie sich mit nur einem Minimum an Selbstdisziplin und Energie davor hätte bewahren können, derartig die Fassung zu verlieren.
Die Mutter
< Vorheriges Bild|Nächstes Bild >
Wenn ich es vermeiden konnte, zu schreien oder mich sonstwie schlecht zu betragen, warum konnte sie es nicht?
Ärzte kamen und gingen, unsere Wohnung war durchtränkt mit der widerlichen Äthersüße von Paraldehyd. (Viele Jahre später begegnete ich diesem Geruch noch einmal in einer staatlichen Irrenheilanstalt. – Nein, nicht als Insasse, lieber Leser, nur als Besucherin, die einige Erkundigungen einzog!)
Von Zeit zu Zeit trat Vater in Erscheinung, um sich über die Resultate der verschiedenen ärztlichen Untersuchungen informieren zu lassen. Da gab es diese neuen Namen, von denen so viel geredet wurde: Krafft-Ebing! Der Professor! Dr. Breuer! Dr. Freud! Und immer häufiger: Inzersdorf! Vater seufzte und stöhnte und stellte schmerzliche Berechnungen in seinem Notizbuch an. Er ließ mich sogar einige dieser Zahlen addieren und multiplizieren, weil Kopfrechnen sein Hobby war und er in seinem starren Buchhaltergehirn die Überzeugung hegte, dass es für ein fünfjähriges Kind keine bessere Vorbereitung fürs Leben geben konnte als den Umgang mit sechsstelligen Zahlen. Obwohl ich inzwischen schon lange damit begonnen hatte, mir Geschichten auszudenken, fand ich auch Gefallen am Spiel mit der Mathematik. Vielleicht war ihre klare, starre Gesetzmäßigkeit ein gutes Gegengift gegen meine überhitzte Fantasie. Als ich in die Grundschule kam, ließ man mich die ganze erste Klasse überspringen. Wenn ich nicht so dünn, blass und klein gewesen wäre, dann hätten sie mich wahrscheinlich am liebsten gleich in die dritte oder vierte Klasse gesteckt – mich armes, frühreifes Kind.
Der autobiografischen Tradition entsprechend hätte ich als das bei Weitem jüngste und schwächste Kind in der Klasse den großen, rohen Scheusalen in den letzten Bänken, die sitzen geblieben und nicht nur ein, sondern zwei Jahre älter waren, als Objekt dienen müssen, das sie tyrannisierten, quälten, mit dem sie Schindluder trieben. Doch nichts dergleichen geschah. Ich war wohlgelitten und wurde gut behandelt, fast so, als ob die Klasse mich als ein spaßiges Schoßhündchen betrachtet hätte. Aber wir waren eben auch Mädchen, minderwertige Geschöpfe mit einem weichen Herz und einem Hasenhirn. Im selben Gebäude gab es zwar auch Jungen, doch ihr Bereich blieb von unserem Flügel durch schwere, niemals geöffnete Türen hermetisch abgesondert. Sie betraten die Schule von einer anderen Straße aus und verließen sie auch so, und unser sogenannter Spielplatz, ein selten abscheulicher Ort, war von ihrem durch dieselbe Art hoher Mauer, wie man sie in Filmen über Gefängnisse sehen kann, getrennt.
Auf die Gefahr hin, eine dumme, altmodische Frau genannt zu werden, muss ich bekennen, dass ich die gemeinschaftliche Erziehung von Jungen und Mädchen für etwas einseitig halte. Es ist doch kaum zu leugnen, dass Mädchen früher oder schneller heranreifen als Jungen: Sie protzen mit ihrem Geschlecht, strecken stolz ihre neuen kleinen Brüste und ihr rundes Hinterteil heraus, bemalen sich das Gesicht, sind flatterhaft, Versucherinnen, aggressiv und sich ganz ihrer Weiblichkeit bewusst – zu einer Zeit, da Jungen mindestens zwei Jahre in ihrer Entwicklung zurück sind, Kinder noch, die instinktiv nur das Bedürfnis haben, Mädchen anzuknurren und ansonsten in Frieden gelassen zu werden, zu spielen, Sport zu treiben und, vielleicht, noch zu lernen oder zu träumen. Wenn ich diese gemeinsam erzogenen, lieben jungen Tiere beobachte, deren jeweiliger Entwicklungsstand so ungleich ist, kommt mir manchmal der Gedanke, dass in diesen Jahren wohl das Rückgrat des jungen Amerikaners gebrochen wird, sodass er kaum jemals ein richtiger erwachsener Mann zu sein vermag, sondern ewig »ein Junge« bleibt. Und so sucht er dann für den Rest seines Lebens die schützende Gesellschaft von seinesgleichen, des eigenen Geschlechts, das ihm viel zu früh entfremdet wurde.
Ich ging gern zur Schule; sie war für mich ein ruhiger Hafen in sicherer Entfernung von dem häuslichen Tumult. Ich mochte meine Lehrer, und ich glaube, dass das Pädagogium – meine Schule – über ausnehmend gute Lehrkräfte verfügte. Ich hatte nicht die geringste Schwierigkeit, was das Lernen anbetraf; die Dinge rutschten mir so leicht hinunter, als ob es sich um Eis handelte; nicht dass ich gewusst hätte, wie Eis schmeckte – es gehörte zu den Genüssen, die mein Vater strikt verboten hatte. Ich war in der Regel zwanzig Minuten vor den anderen in der Schule, und in dieser herrlichen Ruhe und Einsamkeit schaufelte ich die begehrte Weisheit wie mit einem großen Löffel durch einen Trichter in meinen Kopf. Auf diese Art war ich stets frisch mit Zahlen, Daten, der Aufeinanderfolge römischer Kaiser und französischer Könige, kniffligen Deklinationen und staubbedeckten Finessen der Grammatik ausstaffiert. Was ich alles schnell wieder vergessen konnte, solange ich es nicht brauchte. Erst bei schriftlichen Arbeiten kam der Stoff in wahren Ergüssen aus mir heraus – miserabel geschrieben und mit vielen fieberhaft verstreuten Tintenklecksen verziert. Wenn der gute Direktor Moosbauer mit den lächelnden blauen Weihnachtsmannaugen drei Seiten über ein gegebenes Thema verlangte, versäumte ich nie, mit wenigstens dreißig zu erscheinen – über jedes Thema, das mich inspirierte.
Dass ich gern in die Schule ging, hat mich sicher davor bewahrt, überzuschnappen, denn mein Zuhause nahm mehr und mehr den Charakter einer Hölle an, so schrecklich, dass ich es kaum ertragen konnte. Die Ursache dafür war, dass Mama jetzt immer wieder Versuche unternahm, aus dem Fenster zu springen. Ließ Frau Spandauer sie auch nur wenige Minuten aus den Augen, so zog sie sich kichernd und lachend auf das Fensterbrett, und ich, mit Mamas Überwachung betraut, hing mit meinem ganzen Gewicht an ihren bloßen Füßen und flehte sie an, sie solle herunterkommen, sich zu mir setzen, ich hätte ihr etwas Lustiges zu erzählen, etwas sehr Nettes, sehr Interessantes, ganz Neues.
Ich kann wohl behaupten, dass man als zukünftige Schriftstellerin durch eine harte Schule geht, wenn man die eigene Mutter ständig davon abhalten muss, sich umzubringen.
Ich hatte nur eine verschwommene Vorstellung davon, was »sich umbringen« bedeutete, doch es war jedenfalls etwas Schreckliches und Grausiges.
Vielleicht hatte dasselbe Ereignis, das mir eine Ahnung von diesen Dingen gab, auch meiner Mutter die dunklen Selbstmordgedanken in den Kopf gesetzt. Wir lebten im vierten Stock, und über uns gab es nur noch die Dachkammern, in denen die Dienstboten untergebracht waren. An einem herrlichen Nachmittag glitt plötzlich ein schwerer Schatten schnell an unserem Esszimmerfenster vorbei. Katl schrie und ließ alles, was sie in der Hand hatte, fallen; dann tat es einen eigenartigen dumpfen Schlag auf dem Bürgersteig, der sich anhörte, als ob dort unten matschiges Gemüse auf eine zersprungene Trommel gefallen wäre. Katl lehnte sich aus dem Fenster und stellte das Schreien ein. Es war für ein paar Sekunden still. Dann drangen Stimmen, Rufe und das Geräusch eiliger Schritte herauf. »Sie hat sich umgebracht, o du lieber Gott im Himmel«, flüsterte Katl und schob mich vom Fenster fort. Und dann stand Mama auf einmal in der Schlafzimmertür und sagte in jener hohen, kindlichen Stimme, die so oft einen neuen Anfall ankündigte: »Sie hat sich umgebracht? Wie gut für sie.« Sie lachte; es war dieses dünne Kichern, das ich zu fürchten gelernt hatte. Schon stand sie am Fenster und beugte sich weit, weit hinaus.
Das war eine der Gelegenheiten, bei denen ich Frau Spandauer mit meiner Mutter förmlich ringen und sie schließlich durch Körpergewicht und brutale Gewalt überwältigen sah.
Die Stunde, in der sich das Dienstmädchen vom Dachgeschoss stürzte, steht noch sehr klar in meiner Erinnerung; ansonsten jedoch habe ich diese Monate nur als einen einzigen Aufruhr, einen Wirrwarr von Albträumen, im Gedächtnis. Ich liebte meine Mutter, die so hilflos, so krank und schwach war; mit verzweifelter Leidenschaft liebte ich sie, nicht wie eine Tochter, sondern fast wie ein Liebhaber. Danebenzustehen, wenn ein geliebtes Wesen leidet, und nicht helfen zu können, ist das Schwerste, was es gibt. Schwer schon für einen Erwachsenen, um wie viel härter für ein Kind, das noch nicht versteht, das sich nicht ausdrücken kann, das sich unartikuliert und verloren vorkommt, das lediglich fühlt und spürt mit den untrüglichen Sinnen eines Kindes, die noch nicht durch Gewohnheit und Erfahrung abgestumpft sind.
Wenn jemand allerdings jetzt glaubt, ich sei einer jener rührenden, leidenden kleinen Engel aus zweitrangigen viktorianischen Romanen gewesen, so habe ich das falsche Bild gemalt. Gewiss, ich war im Großen und Ganzen ein braves Mädchen, obgleich bestimmt nicht aus Neigung. Solange sich alles nur um Mamas Krankheit drehte, blieb mir einfach keine andere Wahl, als gut zu sein. Getreu den Erziehungsprinzipien jener Tage wurde ich ständig eingeschüchtert mit dem Hinweis auf den Schaden, den mein Benehmen Mamas Nerven zufügen konnte. Alle – Vater und Großmutter, die ganzen Tanten, Katl und Frau Spandauer – machten mich für jeden ihrer Anfälle und Krämpfe, für jede schlaflose Nacht verantwortlich. Ich besaß an sich schon keine dicke Haut, und die ich hatte, war durchgerieben. Doch tief innen war ich wohl mit einer ziemlich robusten Natur gesegnet, andernfalls hätten sie mich sicher zugrunde gerichtet. Die meiste Zeit lief ich mit einem sehr schlechten Gewissen herum, gebeugt unter der Last meiner aufeinandergeschichteten Sünden. Ich hatte Tagträume, seltsame, überhitzte Tagträume, die mich mit klopfendem Herzen und brennenden Wangen entließen. Ich bat den Liebhaber, den ich mit Katl teilte, mich auf seinen Schoß zu nehmen und zu küssen. Ich war frech zu Frau Spandauer. Ich hatte Geheimnisse, ich erzählte Lügen, ich bummelte auf dem Schulweg, ich las in dem verbotenen Buch von Heinrich Heine. War ich allein in der Wohnung, so verbrachte ich aufregende Minuten vor dem Spiegel – in Selbstbetrachtung versunken –, etwas besonders Sündhaftes und Verworfenes. Ich brannte vor Neugier, zu wissen, wie ich aussah. Der Spiegel flößte mir Schrecken ein, aber ich musste einfach herausfinden, wie ich wirklich aussah, nicht nur das Gesicht, sondern alles. Nackt.
Überdies war ich eine Diebin. Ich stahl Zucker aus der Speisekammer, Blumen im Park, und einmal zog ich sogar mit einer Bande Kinder los, um Äpfel aus einer Kiste vor dem Laden eines Gemüsehändlers zu stehlen. Der Gemüsehändler erwischte uns dabei, und die anderen Mädchen rannten kreischend fort; ich ließ meinen Apfel fallen, eins der Mädchen trat darauf, und was übrig blieb, war ein schöner, gestohlener Apfel – zerquetscht auf dem Bürgersteig. Wie das Dienstmädchen, deren tödlichen Fall ich zwar nicht gesehen, aber gehört hatte. Danach gab ich das Stehlen auf. Ich lieh mir lediglich noch einmal Mamas weiße Atlasschuhe aus, die sie als Braut getragen hatte. Doch mit den hohen Absätzen verlor ich die Balance und fiel in den Spiegel der Eingangshalle; er zerbrach, und ich hatte eine klaffende Wunde an der Stirn. Alles sehr schlimme Dinge für Mamas Nerven, und alles meine Schuld, meine Schlechtigkeit, meine Sünde. Das Schlimmste war, dass ich begann, mich für verworfen, für hoffnungslos schlecht zu halten; schlecht zu sein, war befreiend. »Wenn du so weitermachst, wirst du auf einem Misthaufen enden«, drohte mein Vater. »Aber das kommt davon, wenn man schmierige Bücher liest! Hör gut zu, wenn ich dich noch einmal mit diesen schmutzigen Sachen von Heine erwische, dann bekommst du eine solche Tracht Prügel, dass du eine Woche lang nicht mehr sitzen kannst …«
Unterdrückung erzeugt Rebellion. Ich bedauerte nicht, Heine zu lesen, und war ganz gewiss nicht gewillt, damit aufzuhören, nur weil Vater ein brutaler, ungebildeter Schwachsinniger war. In dem roten Lederbuch mit Goldschnitt gab es Worte, die wie ein Blitzstrahl wirkten, der einen mitternächtlichen Himmel durchzuckt:
Aus meinen großen Schmerzen
Mach’ ich die kleinen Lieder …
Ich hatte schon oft überlegt, wie jemand es anfing, kleine Lieder aus großen Schmerzen zu machen. Blass und zitternd vor Trotz erklärte ich: »Ich lese auch künftig, was mir gefällt. Du verstehst Heine einfach nicht und mich und Mama – du hast von nichts eine Ahnung, jetzt weißt du’s!« Vater zog mich in die Dachkammer, damit Mama nicht gestört wurde, und gab mir eine methodische Abreibung. Darüber hinaus wurde mir befohlen, nicht zu heulen, keine roten Augen zu zeigen und Mama nicht ahnen zu lassen, was geschehen war. Aber ich befand mich sowieso jenseits aller Tränen. Noch bevor ich sieben war, hatte ich meine Tränen schon so lange zurückgehalten, dass ich die Fähigkeit zu weinen ganz verloren hatte.
Ich gewann sie nicht mehr zurück. Noch heute wie in meiner Kindheit macht mich Schmerz nur erstarren, stundenlang zittern, und ich habe dabei ein Gefühl, als ob die frostige Hand eines Toten mein Herz umklammert hielte.
Um dieselbe Zeit entwickelte ich mich zur ausgewachsenen Zynikerin, zur Pessimistin und Agnostikerin en miniature. Anlass für diese geistige Revolte war ein zweifellos teures Ölgemälde im grünen Salon meiner Großeltern, auf dem drei Objekte in prächtigen Farben und mit kunstvoll ausgeführten Details dargestellt waren. Auf einem grünen Samtkissen saß ein Baby, dessen nackte Beine und ein Teil seiner runden Hinterbacken sehr rosa und fett unter dem süßen, viel zu kurzen Hemdchen hervorsahen. Das kleine Kleidungsstück war nicht einmal lang genug, um den Nabel des Säuglings zu bedecken, und all dieses fette und rosige Fleisch war mit solch offensichtlichem Genuss gemalt, dass sich mir die Haare im Genick sträubten in dem unbewussten Empfinden, etwas Indezentes, Verbotenes zu sehen. Doch andererseits hätten meine Großeltern sicherlich nichts Anstößiges jedermann zur Ansicht aufgehängt. Ich suchte deshalb nach dem tieferen Sinn dieser Zurschaustellung, dem Symbolismus, sozusagen. Das wonnige Wesen hielt ein Goldfischglas zwischen seinen Beinen und bedeckte damit gerade die unanständigsten und am meisten die Neugier erregenden Teile, sodass man nicht wusste, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Doch nun kam noch das Irritierendste und Mysteriöseste: Mit sehr ernstem Gesichtsausdruck ließ dieses Baby eine goldene Uhr an der Kette ins Wasser hängen, und der Goldfisch warf einen prüfenden Blick darauf, als ob er sehen wollte, wie spät es war.