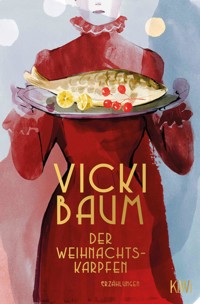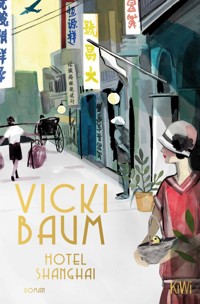9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine fantastische Wiederentdeckung der legendären Grande Dame des Gesellschaftsromans: Vicki Baums »Zwischenfall in Lohwinckel« erstmals als E-Book. Eine Autopanne mit Folgen: Drei mondäne Berliner kommen auf der Landstraße von der Fahrbahn ab und stranden im provinziellen Lohwinckel – der Auftakt eines vergnüglichen Reigens, der die Herzen der Lohwinckler in Wallung und die Ordnung der Stadt ins Wanken bringt. »Zwischenfall in Lohwinckel« ist ein meisterhaftes Beispiel für Vicki Baums erzählerisches Können, das kluge Gesellschaftsanalyse mit bester Unterhaltung verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Vicky Baum
Zwischenfall in Lohwinckel
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vicky Baum
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vicky Baum
Vicki Baum, geboren 1888 als Tochter einer jüdisch-bürgerlichen Familie in Wien, gestorben 1960 in Hollywood. Sie war ausgebildete Musikerin und arbeitete ab 1926 als Redakteurin in Berlin. 1932 wanderte sie nach Hollywood aus. In Deutschland wurden ihre Bücher von den Nazis als »Asphaltliteratur« verfemt und verbrannt. Ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach dramatisiert und verfilmt worden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Vicki Baums großer Provinz-Roman erzählt von einer folgenreichen Autopanne: Drei mondäne Berliner kommen auf der Landstraße von der Fahrbahn ab und stranden in der Kleinstadt Lohwinckel – der Auftakt eines vergnüglichen Reigens, der die Ordnung der Stadt ins Wanken und die Herzen der Lohwinckler in Aufruhr bringt. Peter Karbon, Reifenfabrikbesitzer und Lebemann um die vierzig, landet im Haus des verschrobenen Landarztes Dr. Persenthein und verfällt dessen junger Gattin Elisabeth; seine Freundin, die bildschöne Schauspielerin Leore Lania, weckt die Sehnsüchte des Ladenbesitzers Herrn Markus und des verarmten Landadel-Geschwisterpaares von Raitzhold; und Franz Albrecht, deutscher Boxweltmeister im Mittelgewicht, das Interesse der Fabrikantengattin Frau Profet … Von Vicki Baum mit sanfter Ironie erzählt, führen die amourösen Verwicklungen allen Beteiligten die Beschränkungen ihrer Lebensumstände vor Augen, lassen sie träumen, Versuchungen nachgeben und den Aufstand proben, bis sich am Ende nach einem Brand die gewohnte Ordnung wieder durchsetzt. Oder auch nicht.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1929/1939 by Vicky Baum
© renewed 1957 by Vicky Baum
© 1996, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Gisela Goppel / 2 Agenten
ISBN978-3-462-30303-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Weil das Haus so alt war …
Peter Karbon saß in dem Lehnstuhl …
Um den Saal von Oertchens Gastwirtschaft …
Wir weisen darauf hin, dass in diesem Roman stellenweise eine rassistisch geprägte historische Sprache verwendet wird.
Weil das Haus so alt war, gingen die Dielen in Doktor Persentheins Schlafzimmer schräg abwärts; das war eines von den Dingen, die Frau Persenthein Kummer machten. Die Betten standen schräg abwärts, und wenn man müde war, sackte man im Traum immer zum Fußende hinunter; das machte den dünnen Schlaf der Arztfrau noch leichter zerreißbar. Manchmal träumte sie von einer schiefen Fläche, auf der sie mit ungeheurer Angst ins Abgleiten gekommen war. Wenn die Nachtglocke in den Traum einbrach und sie herausholte, dann wusste sie nicht, ob sie geschlafen oder die Angst und das Gleiten im Halbwachen erlitten hatte. Sie griff in das Bett nebenan, es war leer. Sie drehte das Licht an und sah auf die Uhr. Halb drei Uhr morgens. Sie hörte das Kind in der Kammer atmen, während sie ihr großes Wolltuch umnahm und die hölzerne, knarrende, wunderliche Treppe hinuntertappte. Die Klingel an der Haustür wurde ungeduldig und dringlich. Im Ordinationszimmer brannte Licht. Elisabeth Persenthein trat auf Zehenspitzen ein, bevor sie hinging, die Haustür zu öffnen.
Doktor Persenthein lag mit den Armen und dem Kopf über der ›Münchner Medizinischen Wochenschrift‹ und war eingeschlafen. Durch sein helles, seidendünnes Haar schimmerte die Lampe auf die Kopfhaut. Der Sterilisator fing einen Reflex auf, sein Nickel spiegelte winzig den schlafenden Doktor noch einmal: die Müdigkeit in den Schultern, die großen Hände, deren Haut vom vielen Waschen rau und gesprungen war, die langen Finger mit den kurz geschnittenen Nägeln.
»Kola –«, sagte Elisabeth ins Zimmer hinein, gerade laut genug, um den Mann zu wecken, aber nicht so laut, dass er erschrocken wäre. Er reagierte sogleich.
»Ich schlafe nicht«, sagte er prompt. »Es ist noch nicht spät. Ich muss nur noch den Artikel zu Ende lesen –«
Auf Derartiges pflegte Frau Persenthein nicht zu antworten. Auseinandersetzungen über durcharbeitete Nächte hatte sie sich abgewöhnt. Sie lächelte – frisch und ermunternd, wie sie meinte. Aber da auch sie müde war, und da die gespannte kleine Falte über ihrer linken Braue zuckte, war das ganze Lächeln eine etwas trübe und angestrengte Veranstaltung. Die Klingel forderte.
»Ein Patient. Ich mache auf«, sagte Frau Persenthein. Doktor Nikolaus Persenthein wusch sich mechanisch die Hände. »Immer bei Nacht. Diese Kaninchen! Die Tasche –«, sagte er.
Gewöhnlich war der Mensch, der mitten bei Nacht zum Doktor kam, ein Mann, ein abgehetzter und aufgeregter Arbeiter aus der Vorstadt Obanger oder ein Bauer aus einem der Dörfer hinter dem Düßwalder Forst, den die Frauen vom Krankenbett weg zum Arzt gejagt hatten. Seit drei Leute an der Grippe gestorben waren, holten sie den Doktor, wenn jemand fieberte und hustete, sie holten ihn etwas zu spät, aber sie holten ihn, und dann war ihnen auch jede Tages- und Nachtzeit recht. Frau Persenthein nahm den konfusen Bericht entgegen, während Doktor Persenthein schon das Motorrad aus dem Verschlag herausschob. Sie schaute die Tasche nach – »Omnadin? Spritze? Physostigmin?« – fragte Persenthein, der die Windjacke überzog und sich übertrieben wach gebärdete. Die Frau ließ die Tasche zuschnappen und machte sie am Motorrad fest. Vor dem Haus schauerte ein kühler Dämmerungswind an ihre bloßen Füße. Persenthein knurrte unfreundliche Dinge zu dem Mann, der mit beleidigtem Gesicht dabeistand und das üble Befinden seines Kranken zu Hause übertrieb, um die nächtliche Expedition zu rechtfertigen. Obwohl Doktor Persenthein sich beeilte, dauerte der Abmarsch lange, denn er war ein überaus langsamer Mensch. Er bastelte noch am Motorrad herum. Er knöpfte die Windjacke noch einmal auf und zu und suchte etwas. Er öffnete die Tasche nochmals und revidierte ihren Inhalt. Schließlich schlug die Kirchenuhr drei, und das Motorrad mit dem knurrenden Doktor und dem gekränkten Mann auf dem Soziussitz knatterte durch das Stadttor und davon. Elisabeth konnte zurückkehren in das Schlafzimmer mit den schrägen Dielen und dem entzweigerissenen Traum. Dass die Dielen schräg waren und die Betten abwärts standen, kam davon, dass Persentheins in einem uralten Fachwerkhaus wohnten. Eigentlich war es gar kein Haus, sondern nur ein Anhängsel des alten Stadtturms, welcher der Angermann hieß. Das Doktorhaus wurde das Angermannshaus genannt, und sie zahlten dem Magistrat von Lohwinckel nur achthundert Mark Miete dafür. Die Hinterwand war noch ein Stück der alten Stadtmauer, aus Steinen gefügt, zwischen denen die Jahrhunderte den Mörtel lose gemacht hatten. Sooft unten ein Auto durch das Stadttor in Lohwinckel einfuhr, begann das ganze Angermannshaus zu beben. Diele, Treppe und Deckengebälk stießen Seufzerlaute aus, die leise Wehklage sehr alten Holzes, das ein paar Hundert Jahre lang Lasten getragen hat. Frau Persenthein konnte in solchen Augenblicken, sonderbar starr und gesammelt, still stehen, das Beben in den Mauern mitspüren und dem merkwürdigen Klang im Gebälk nachhorchen. Ein wenig Mörtel rann dann herunter, zwischen dem Fachwerk hervor und auf die Dielen. Frau Persenthein weckte sich auf, holte das Staubtuch aus dem Verschlag, kniete hin und wischte das kleine Mörtelhäufchen fort.
»Gebense Obacht, Mutter«, pflegte der Arbeiter Lungaus zu sagen, den sie oben in der Bodenkammer wohnen hatten, »gebense Obacht, einmal kracht uns die ganze Bude überm Kopf zusammen.« Frau Persenthein war neunundzwanzig, und Lungaus war achtundfünfzig und konnte die Frau nicht leiden, aber er nannte sie Mutter. »Im Dach hat es die ganze Nacht geknorzt –«, verkündete er mit düsterer Miene, wenn Frau Persenthein ihm sein Frühstück gab. Sie dachte zuweilen eine halbe Minute über seine Prophezeiungen nach, und dann sagte sie: »Nein, Lungaus, das hält, glaube ich.«
»Wenn ich sage –«, erwiderte Lungaus, der krank und von ungeduldiger Natur war.
»Lassen Sie nur, Lungaus. Die Mauer hat ein paar Hundert Jahre gehalten, die hält auch uns noch aus. Nur der Mörtel ist ein bisschen lose«, schloss Elisabeth solche Dialoge, trug Lungaus’ Milchtasse in den Spülstein, wischte geduldig das bisschen kalkigen Staub auf, den das Morgen-Bahn-Auto aus den Fugen geschüttet hatte, und brachte das Staubtuch in den Verschlag.
»Das Haus ist ein Luder, ein tückisches«, behauptete Lungaus und kam ihr nachgetappt in die Küche. An den nackten Füßen trug er Doktor Persentheins alte Pantoffeln, Doktor Persentheins verflossene Hosen beulten sich mit Flicken über seinen spitzen Knien, und um den ganzen Menschen hing stets ein bitterer Geruch. Nasses Laub im späten November riecht so. Elisabeths Nerven waren immer ein wenig irritiert, wenn die Kleidungsstücke ihres Mannes an Lungaus’ Körper durch die Wohnung gespensterten. Trotzdem sagte sie freundlich: »Ja, da haben Sie recht. Das Haus hat es in sich.«
Das Haus nämlich, winklig und vertrackt, machte unendliche Arbeit, es war schwer in Ordnung zu halten, schwer zu lüften, schwer zu heizen. Es kostete wenig Miete, fraß aber auf hinterhältige Weise eine Menge Geld auf. Reparaturen gab es immer und immer. Elektrisches Licht hatte man legen, dann eine Wasserleitung einbauen lassen – der Doktor brauchte fließendes Wasser im Ordinationszimmer. Und als man fließendes Wasser hatte, gab es keine Ruhe, bevor er nicht im Keller eine Art kleiner Badeanstalt errichtet hatte: Salzbäder für rachitische Kinder, Kohlensäurebäder – und zuletzt sogar eine Art Inhalatorium. Die ganze Bevölkerung der Vorstadt Obanger vergnügte sich in diesen Bädern, sie kosteten den Arzt eine Menge, und die Krankenkasse zahlte so gut wie nichts dafür. Aber Kola war ein Sonderling, und die Bäder gehörten zu seiner Idee, einer Idee, von der noch die Rede sein wird … Lungaus nahm Platz auf der Kohlenkiste, ließ die Beine baumeln, die Pantoffeln fielen von ihnen ab wie reife Früchte, und die großen Zehenballen kamen zum Vorschein; er schaute zu, wie die Frau Feuer im Herd ansteckte.
»Kleinholz müsste man mal wieder machen«, bemerkte er.
»Ja, das wäre gut, Lungaus«, sagte Elisabeth ermunternd.
»Ich befinde mir mittelmäßig«, erwiderte Lungaus darauf abweisend. Elisabeth seufzte und erschrak. »Lungaus – Sie haben doch nicht – wie? Im weißen Schwanen? Etwas gegessen? Wurst? Salzbrezeln? Nein? Getrunken? Geraucht? Mir müssen Sie die Wahrheit sagen – ich bekomme ja auch die Anschnauzer vom Doktor, nicht Sie! Haben Sie?«
»Ach wo –«, sagte Lungaus ungewiss, was Elisabeth wenig befriedigte. Sie schaute Lungaus genau und forschend an – er sah eigentlich nicht schlecht aus. Seine Lippen zeigten die richtige Farbe, und um den Hals hatte er ein wenig zugenommen. »Wo ist überhaupt das Rehle?«, fragte Lungaus streng, während Elisabeth noch vor dem widerspenstigen Herdfeuer kniete und den blauen Qualm des feuchten Holzes einatmete.
»Das Kind ist natürlich mit dem Doktor auf Visite«, antwortete sie hustend.
»Natürlich. Immer mit dem Kind mang die Grippe in aller Herrgottsfrühe«, sagte Lungaus, ehrlich erbittert, denn alle Liebe seines vertrockneten Lebens hatte sich auf das fünfjährige Rehle konzentriert.
»Sie wissen ja, das ist so seine Idee –«, sagte Elisabeth, und dabei hatte sie ein stechendes Gefühl an der Nasenwurzel, als kämen gleich Tränen. »Ja, das ist die Idee«, wiederholte Lungaus und angelte Kolas Pantoffeln herbei. »Ich sage ja: Lieber an die Anatomie verkaufen, da ist man doch tot und spürt’s nicht. Aber das Versuchskarnickel sein bei lebendigem Leib – da kann eins ja –«
»Na, Ihnen geschieht doch wahrhaftig nichts. Sie hat er doch gesund gemacht«, sagte Elisabeth, während er schon zur Küchentür schlappte und dort stehen blieb. »Was krieg ich um neun?«, fragte er gereizt.
»Bananenmus. Sowie das Feuer brennt, mach ich’s zurecht«, sagte Elisabeth. »Sie haben es auch nicht leicht«, beschloss Lungaus und verschwand. Elisabeth blieb vor dem Herdloch zurück, war aber zu eigensinnig, um zu weinen. Sie brauchte beinahe zehn Minuten, um sich durchzubeißen, aber dann wurde sie vergnügt. Dass dieses Pantoffelgespenst, dieses Hauskreuz Lungaus, dieser Leidenskelch in ihrer Ehe, auch noch Mitleid mit ihr hatte, war eine durch und durch komische Angelegenheit. Als sie das Bananenmus anrührte, konnte sie bereits darüber lachen.
Sie bewachte das Feuer, wusch das Frühstücksgeschirr, schälte Mohrrüben für Lungaus’ Mittagessen – denn Lungaus bekam eine ausgetüftelte Diät und lebte von Extrakten aller Naturprodukte –, sie rieb ihre braun gewordenen Finger mit Bimsstein, zankte ein wenig mit dem kleinen Tagesmädchen, das zu spät daherkam wie immer. Es gehörte auch zu Elisabeths Kümmernissen, dass Lungaus die Bodenkammer bewohnte, dass man keinen Platz für ein richtiges Dienstmädchen hatte – und so recht besehen auch kein Geld – und dass man von den verschiedenen ›Aufwartungen‹, die mal fünfzehn Jahre alt waren und mal achtundsechzig, häufig im Stich gelassen wurde.
Sie ging ins Ordinationszimmer zu ebener Erde und begann dort Ordnung zu machen. Sie zählte die abgerauchten Zigarrenenden, seufzte ein bisschen und lachte dann, denn Doktor Persenthein war zwar ein wütender Gegner des Nikotins, aber ein leidenschaftlicher Raucher. Sie ging ans Telefon, nahm die Morgentemperatur von Fabrikbesitzer Profets zweitem Jungen zur Kenntnis – 38,2 – und trug sie in den Block ein. Sie zündete die Spiritusflamme unter dem Sterilisator an, legte Wäsche und einen frischen Kittel für Kola heraus und rieb den Operationsstuhl blank, während Spekula, Klemmen und Trichter kochten. Sie blieb fünf Minuten an der Medizinischen Wochenschrift hängen und blätterte in dem aufgeschlagenen Artikel über ›Sepsis-Prophylaxe bei Verletzungen der Landarbeiter‹ mit dem gierigen und leidend suchenden Ausdruck, den andere Frauen für ihre Rivalinnen haben. Sepsis-Prophylaxe! Das kostete nun Kolas Schlaf und Nächte. Das Haus bebte, Mörtel rann herab. Das Neun-Uhr-Bahn-Auto kam von der Station zurück. Elisabeth quälte sich mit dem Bananenmus die Treppe hinauf in Lungaus’ Bodenkammer. »Die Bananen wachsen mir schonst zum Plaise raus, Mutter«, bemerkte Lungaus, der auf dem Bett lag und das Fenster geschlossen hatte. »Los, raus, spazieren gehen!«, sagte sie nur. »Dass der Doktor Sie nicht faulenzend findet, wenn er heimkommt.«
»Bei diesem Wetter«, entgegnete Lungaus voll Vorwurf. Elisabeth blickte durch das schräge Bodenfenster hinaus, es ging nicht nach der Stadtseite, sondern nach der Vorstadt Obanger. Eine Eberesche, die dahinten aus der Stadtmauer wuchs, stand krumm im Wind. Der Himmel hing voll zerrissener Wolken, ein heftiger Regen war vorbei, und neuer Wasserdunst sammelte sich in einer dunkelgrauen Wand, die über den Rußfahnen der Fabrik in der Ebene stand. Und Kola draußen, mit Rehle auf dem Soziussitz –
Das Telefon klingelte in der Diele, lang, lang, lang: Ferngespräch. Elisabeth nahm zur Kenntnis, was ihr mitgeteilt wurde. Nachher stand sie einen Augenblick vor der Muschel und biss auf das Gelenk ihres rechten Zeigefingers – das tat sie immer, wenn etwas Schlimmes kam. Sie ging ins Ordinationszimmer und trug die Nachricht ein:
Telefonanruf des Krankenhauses Schaffenburg. Doktor Schroeder lässt mitteilen, dass dem Knecht Jakob Wirz der linke Arm abgesetzt werden musste, handbreit unterhalb des Schultergelenks.
Sie überlegte einen Augenblick, und dann malte sie rasch einen kleinen Kreis neben diese Meldung in den Block. Das war ein Geheimzeichen. Das bedeutete seit langen Zeiten ein Kuss. Das bedeutete: Armer Kola! Und: Mach dir nicht zu viel Kummer. Und: Ich bin da, Elisabeth, und ich möchte dich trösten –
Übrigens liebte Doktor Persenthein es durchaus nicht, wenn solche Liebeszeichen wie Sonnenkringel in seinen Büchern herumflirrten. Und als Elisabeth noch eine Minute so da stand in einer ihrer nachdenklichen Erstarrungen und sehr deutlich das kochende Summen im Sterilisator hörte und sehr deutlich den alten dicken Band Aristoteles neben den Stapeln von Fachzeitschriften auf dem tiefen Fensterbrett sah – da kam sie sich unaufrichtig vor mit ihrem runden Siegel neben der schlechten Nachricht. Es war nur eine Formalität und nicht als echtes Gefühl gespürt; nicht mehr mit dem saugend-schmerzlichen Zerren gespürt, das die Liebe dem Herzen antut – nein! Und Elisabeth nahm den Radiergummi, löschte den Kuss wieder weg und ließ den verpfuschten, vergifteten und amputierten Arm des Jakob Wirz unbeschönigt und allein im Block stehen.
Als sie in die Diele hinauskam, saßen da schon Leute, eine Frau aus Düßwald samt Kind, Lieschen vom Gut mit ihrem Mittelohr und ein magerer Arbeiter von miserablem Aussehen, der mit stumpfem Ausdruck seine Mütze drehte.
»Tag, Herr Lingel«, sagte Elisabeth. »Na, geht’s denn schon wieder los mit Ihnen?«
»Das ist schon so mit der Bleivergiftung – das sitzt alle paar Monate wieder in den Knochen«, sagte der Mann geduldig.
»Na – der Doktor muss gleich hier sein«, sagte Elisabeth und wanderte die Treppe hinauf. Diagnose auf Bleivergiftung konnte sie nun sozusagen schon ohne ihren Mann stellen; es war eine Lohwinckler Spezialkrankheit, die man sich in Profets Akkumulatorenfabrik ohne Weiteres holen konnte. Manche erwischten sie nach drei Monaten und rückten beim Doktor an mit dem schwärzlichen Streifen am Lippensaum, glanzlosen Augen und den gewissen Schmerzen im Magen. Andere arbeiteten fünfundzwanzig Jahre bei Profet, ihr Jubiläum wurde im ›Anzeiger für Stadt und Land‹ gefeiert, und sie blieben dabei munter und gesund wie die Kaulquappen.
»Disposition«, sagte Doktor Persenthein, der in der Hast der Praxis die Gewohnheit angenommen hatte, von den meisten Sätzen nur das Subjekt auszusprechen. Übrigens war er keine resignierte Natur, dieser Doktor Persenthein, er war ein Kampfhahn erster Ordnung, und nachdem er einige Zeit in Lohwinckel praktiziert hatte, machte er sich nicht nur über die Bleivergiftung her, sondern auch über die Disposition dazu. Er tastete mit seinen Gedanken vor wie mit einer Sonde, bis er auf die Idee stieß, auf seine Idee. Mein Gott, ein junger, nicht übermäßig geschickter Landarzt, Doktor eines Marktfleckens von siebentausend Seelen – was sollte ihm die Idee? Sie machte ihn fremd, alt, voll Kanten und Beulen, sie stellte ihn mitten in ein Vakuum, eine luftleere, unmenschliche Einsamkeit, diese Idee, die er hatte oder die ihn hatte. Seit Doktor Persenthein sich mit dem Denken eingelassen hatte, war das Angermannshaus eine Art Fegefeuer geworden …
Frau Persenthein ging in die Küche und begab sich ans Kochen. Das war in diesem Haus eine verzwickte Angelegenheit, eine Beschäftigung, der etwas von leiser Verrücktheit anhing. Da war Lungaus’ teure und merkwürdige Diät; Gemüse, Obst, rohe Eier, merkwürdiges, selbst gebackenes Brot, lauter Dinge, die unendliche Mühe machten und die er nur unter Protest hinunterwürgte. Rehle, das Kind, bekam Ähnliches, nur ein wenig anders, gerade so viel anders, dass man es extra zubereiten musste. Kola hingegen brauchte Fleisch, viel Fleisch, gebraten, scharf gewürzt, starken Kaffee nachher, an überanstrengten Tagen auch ein Glas Wein. Alles, was er für tief ungesund und verderblich hielt, brauchte er selber in großen Mengen, sonst machte er schlapp und war in der Drei-Uhr-Sprechstunde müde und ohne Konzentration. Elisabeth selber hatte keinerlei Diätwünsche – wenn es nur billig war und keine Mühe machte. Sie und das Dienstmädchen aßen, was da war, was übrig blieb, und eine Menge Kartoffeln dazu. Die Kartoffeln wurden in dieser prinzipienerfüllten Küche stets in der Schale gekocht, die Schale enthielt etwas, dessen Namen Elisabeth immer vergaß und das für den Aufbau nötig war. Sie stand über den Spülstein gebückt und scheuerte mit einer kleinen Bürste die Kartoffeln blank, bekam davon schwarze Finger, aber allmählich war sie es müde geworden, sie wieder mit Bimsstein zu waschen. Die Fersen taten ihr ein bisschen weh, auch die Schulterblätter. Sie kletterte nachher in den Keller hinunter und inspizierte das Mädchen, das die beiden Baderäume sauber machte. Es roch hier medizinisch, nach Lysoform, nach jodhaltigen Salzen, nach Kresolseifenlösung. »Katrinchen hat wieder alles versaut«, sagte Elisabeth lächelnd.
Katrinchen war eine dicke, ehrwürdige Spinne, die ihre Hängematten in alle Winkel hängte. Elisabeth fegte sie weg, es tat ihr immer ein wenig leid, Katrinchens Wohnstätten zu zerstören. Hier unten lag man stetig im Kampf gegen ein Gewimmel von lebenshungrigen Kreaturen: Mäusen, Schwaben, kleinen, namenlosen Tierchen, die wie lebendig gewordene Stahlnägelchen aussahen und in den Badewannen wohnen wollten. Oben war indessen die Vormittagsordination schon in Gang gekommen, die Diele roch nach Menschen, nach Pfeifentabak, sie war voll herbstnasser Stiefelabdrücke. Kolas Windjacke hing nass am Haken, er war heimgekommen, ohne dass Elisabeth ihn gesehen hatte. Im Verschlag hockte Rehle und putzte das Motorrad.
Rehle trug Hosen, eine Art Overall, den Elisabeth nach den Anweisungen eines Modealbums geschneidert hatte und der nicht übermäßig geglückt war. In Lohwinckel addierte man dieses Kleidungsstück zu den übrigen Verrücktheiten des Doktorhauses und nahm es übel. Aber da Rehle nun einmal immer hinten auf dem Motorrad draufsaß, die kurzen Ärmchen um den Magen ihres Vaters geschlungen, und da Kola darauf bestand, sie bei seinen Visiten durch alle Dörfer und Häuser der Umgebung mitzuschleppen, war dieser kleine blaue Overall eher praktisch als verrückt zu nennen und verdiente die Feindschaft der Lohwinckler nicht ganz.
»Puß, Mutter«, sagte das Rehle, ohne aufzuschauen, als Elisabeth ihre leise schmerzenden Schulterblätter für einen Augenblick an den Türpfosten des Verschlages lehnte. ›Puß‹ war Rehles Grußform aus der Zeit, da sie noch klein war. Inzwischen hatte sie sich zu einem erstaunlich selbständigen Menschen entwickelt, zu einem Mädchen, das für ihre fünf Jahre viel zu lang war, zu große Hände und Füße hatte.
»Na? Haselmaus?«, fragte Elisabeth. Rehle hatte viele Namen; alles, was braun und glatt war, passte: Rehle, Haselmaus, Nüsschen, Spitz. Aber Rehle war Zärtlichkeiten abgeneigt.
»Schön dreckig, was?«, sagte sie und hielt Nase, Hände und Stiefel ins Licht, das durch eine Luke in der Stadtmauer hereinsickerte.
»Nasse Füße?«, fragte Elisabeth. »Natürlich«, sagte Rehle. Elisabeth zog ihre Hand wieder zurück, mit der sie Rehle gern gestreichelt hätte, dann überließ sie das Kind sich selbst. Nasse Füße gehörten zu Rehle, und Schuhe wurden nicht gewechselt. Das war ein Teil von Kolas Erziehungsprinzipien, ein Teil seiner Idee, ein Teil von seinem Kampf gegen die Disposition …
Elf Uhr. Zurück in die Küche. Das dritte Frühstück für Lungaus: Milch mit dem Saft einer Apfelsine – die der Kaufmann Heinrich Markus zu dieser Jahreszeit für viel Geld aus der Kreisstadt kommen lassen musste. Das Wohnzimmer aufräumen. Kolas Notizen im Schlafzimmer sammeln, bevor das Mädchen sie wegwirft. Zweites Frühstück für Rehle. Eine Tasse Tee für Kola in die Ordination tragen, wo gerade ein schreiendes Kind an den Mandeln gepinselt wird. Rehles Kammer in Ordnung bringen.
Aber Rehles Kammer war in Ordnung. Rehle hatte sich selbständig gemacht, sie lag unter ihrem Gitterbett und wischte den Boden auf, Fenster und Türen standen offen, es war hübsch zugig und kühl hier, aber ordentlich. Die Puppen lagen in Reih und Glied und waren alle krank, sie hatten Verbände um Kopf, Arm und Bein, wirkliche Verbände aus wirklichem, wenn auch durchaus nicht mehr sterilem Mull, und die Lieblingspuppe Erika hielt außerdem ein Thermometer unter die Achsel geklemmt, ein weißes Stückchen Holz, auf dem ein roter Strich das Quecksilber vorstellt und ein für alle Mal neununddreißig Grad als Temperatur vermerkt ist. Denn Rehle kann schon Ziffern schreiben, aber achtunddreißig ist zu schwer, siebenunddreißig zu uninteressant, weil fieberfrei, und vierzig zu hoch und gefährlich.
»Nachher gehe ich zum Schlachter, einholen«, meldete Rehle mit erstickter Stimme unter dem Bett hervor. »Du bist ja brav«, sagte Elisabeth. »O ja«, erwiderte Rehle sehr selbstsicher.
In Rehles Gegenwart fühlte Elisabeth sich immer ein wenig überflüssig, dieses Kind stand so fest in seinen kleinen nassen Stiefeln, zeigte kein Gefühl, wollte kein Gefühl. Frau Persenthein tauchte wieder in der Wirtschaft unter und hatte reichlich zu tun bis fünf Minuten vor eins. Da fuhr gerade das Postauto zum zweiten Mal zur Bahn, das Haus zitterte pünktlich, Mörtel fiel aus der Wand; Elisabeth schoss mit dem Essen zu Lungaus in die Kammer und dann ins Schlafzimmer, um den Küchengeruch von den Händen zu waschen. Sie hatte früher einmal hübsche Hände gehabt und war noch immer ein bisschen eitel darauf. ›Früher einmal!‹ Das hatte für die neunundzwanzigjährige Elisabeth einen Klang, als wenn sie achtundsiebzig wäre. Sie schaute gedankenleer in den Spiegel, während sie die Küchenschürze abband. Es war ein kleiner, alter Spiegel, der in Scharnieren schräg gestellt werden konnte; man sah nicht alles auf einmal in seiner grünlichen Tiefe, sondern hübsch eins nach dem andern: jetzt das Gesicht, schmal, mit der kleinen Falte überm linken Auge; die Lippen etwas zu breit und etwas zu blass; die Haare mochten angehen, sie waren wie die von Rehle, glatt und hellbraun. Dann der Hals, etwas zu lang, etwas zu mager. Dann Schultern und Brust – nun ja! Elisabeth fand sich nicht hübsch. Sie fand, dass sie eine Figur hatte wie Sigismunde von Raitzold auf dem Steinsarkophag in der Lohwinckler Kirche, Sigismunde, die vierhundert Jahre alt und auch nicht hübsch war, während Kola dem unternehmenden heiligen Georg auf dem Angermannsturm ähnlich sah –
Sie ging zum Fenster des Wohnzimmers und schaute zum Angermann hinauf. Der heilige Georg ritt mit eingelegter Lanze gegen den Drachen los, er sprühte Mut und der Drache Feuer, und beide waren aus Holz. Elisabeth hatte den heiligen Georg schon geliebt, als sie noch ein kleines Mädchen war und an der Hand ihres Vaters, des Gymnasialdirektors Burhenne, unter dem Angermann durchspaziert war. Später fand sie, dass der heilige Georg so aussah wie Schiller. Und noch etwas später bemerkte sie, dass der junge Doktor Persenthein so aussah wie der heilige Georg …
Sie ging hinunter, klopfte dreimal an die Tür des Ordinationszimmers und flüsterte: »Kola, du musst essen kommen. Es wird sonst zu spät.«
»Sofort«, sagte der Doktor drinnen. Sofort bedeutete bei Kola noch eine Viertelstunde. Elisabeth ging wieder hinauf, der Tisch war gedeckt, sie öffnete für einen Augenblick das Piano, schlug ein paar Töne an und horchte ihnen mit geöffnetem Mund nach, bis sie verschwebt waren.
Das Auto kam von der Bahn zurück, das Haus zitterte, Mörtel fiel. Oben hörte man Rehle einen hellen Streit mit Lungaus führen. Unten schlurrten die Stiefel der letzten Vormittagspatienten zur Haustür. Elisabeth trat wieder ans Fenster. Sie musste nachsehen, ob Doktor Persenthein wirklich dem heiligen Georg ähnlich sah.
›Nein‹ – dachte sie, während sie die Suppe austeilte; ›er sieht ihm gar nicht mehr ähnlich.‹
Doktor Persenthein, das ist ein Mann von achtunddreißig Jahren, ein großer, magerer Mensch mit schweren, breiten Schulterknochen und einer hellen Haut, unter der an überanstrengten Tagen die Adern bläulich durchschimmerten. Das Haar tritt über der Stirn in zwei tiefen Ecken zurück und wird dünn. Die große Nase hat einen kühnen, schmalen Sattel, der Mund mit den breiten Zähnen nimmt viel Platz ein, von den tief gekerbten Mundwinkeln zur Nasenwurzel läuft eine Falte von heftigem und angespanntem Charakter.
Doktor Persenthein, Sohn eines mittleren Beamten, der etwas Besseres als der Vater werden sollte, studierte Jus, kiebitzte ein wenig in den Hörsälen der medizinischen Kollegs, blieb dort hängen, sattelte um, setzte gegen Familie, Tod und Teufel den Willen zur Medizin durch, der sich langsam in ihn hineingefressen hatte. Studium in zwei kleinen Städten mit zwei großen Universitäten, Physikum, Staatsexamen, Promotion. Anatomie, Physiologie, Histologie, Pathologie, Bakteriologie. Dissertation über die Hypernephrom-Metastasen der Knochen. Der Weltkrieg. Volontärarzt an dem großen neuen Krankenhaus der Halbmillionenstadt Markenheim. Die ersten Fehldiagnosen. Die ersten Kunstfehler. Die ersten letalen Ausgänge. Herzschlag während der Narkose. Warum? Luftembolie bei einer ganz kommunen Kropfoperation – warum? Verblutung nach einer Gallenblasennaht – warum? Solche Dinge passierten nicht etwa ihm, dem kleinen Volontär, sondern dem großen, weltberühmten Chirurgen, dem Geheimrat, der Kapazität ersten Ranges. Der kleine Volontär Persenthein durfte nur dabeistehen, Objektträger halten oder Klammern zureichen. Die ersten Zweifel an der Gottähnlichkeit der Chefärzte und an der Allmacht der Medizin tauchten auf, verschwanden aber wieder, als er Assistenzarzt am Krankenhaus in Schaffenburg wurde und alle Hände voll zu tun bekam. Er klapperte sich durch die Abteilungen des nicht großen Spitals durch, kam in ein paar Sackgassen theoretischer und experimenteller Natur, hatte einen siebenmonatigen Hormonrappel durchzumachen, währenddessen er die täglichen Pflichten vernachlässigte, aber bei vielen Tiersektionen eine sichere Hand bekam. Er war währenddessen zu der gynäkologischen Arbeit weitergeschoben worden, es war eine Art von laufendem Band, das den jungen Arzt durch die verschiedenen Zweige einer universellen Ausbildung durchtransportierte. In Abteilung G – Gynäkologische – war es auch, wo er auf Elisabeth stieß, die Säuglingsschwester werden wollte und ein Zimmer mit neunzehn Neugeborenen zu betreuen hatte.
Er ergriff das Gefühl für dieses große, gotisch lange, schmale und klare Mädchen so heftig und hielt es so eigensinnig fest wie einige Jahre früher die Leidenschaft für die Medizin. Er sauste kopfüber in Verlobung und Ehe hinein und fand sich wieder mit der jungen Praxis in Lohwinckel, die er von einem toten Onkel seiner Frau ererbte. Er war Ehemann, Bürger, Mieter des Angermannshauses, an dem er alsbald zwei Tafeln befestigen ließ. ›Dr. Nikolas Persenthein, praktischer Arzt und Geburtshelfer‹ stand auf der einen. Auf der andern: ›Ich bin in … und komme um … zurück.‹ War Doktor Persenthein in eins der Dörfer gerufen und hing diese Tafel ausgefüllt am Haustor, dann erweckte das bei allen den Anschein von stärkstem Beschäftigtsein und bewegter Praxis.
Damals also sah er aus wie der heilige Georg, er hatte das Gefühl, von allem ein bisschen zu können und nichts ganz, und in den vielen schwankenden Stunden der nächsten zwei Jahre war ein großer Stoß von Fachbüchern und Zentralblättern, in denen man nachschlagen und Rat holen konnte, sein kräftigster Trost.
Zuerst holte man ihn nur, wenn es nicht anders ging, bei Geburten beispielsweise, wenn es nicht glatt verlief und die Hebamme nicht allein fertig wurde. Nach dem zweiten Jahr hatte er die Wendung auf dem Fuß und den Kristellerschen Griff schon ziemlich sicher im Handgelenk, und es passierten ihm weniger Dammrisse. Zu Rehles Geburt allerdings schaffte er Elisabeth vorsichtshalber nach Schaffenburg, sie machte nicht viel Geschichten und Doktor Schroeder auch nicht, es dauerte neun Stunden, und das Kind wog die vorschriftsmäßigen sechseinhalb Pfund. Als Rehle drei Monate alt war, begannen die ersten Meinungsverschiedenheiten über die sachgemäße Aufzucht dieses gesunden Säuglings, den beide übermäßig liebten, jeder auf seine Weise, Elisabeth zärtlich und zart verträumt und Kola Persenthein mit dem aggressiven Fanatismus, der alle seine Gefühle bestimmte. Elisabeth hatte das Ihre im Säuglingsschwesternkurs gelernt. Aber Doktor Persenthein hatte sich eine ganz persönliche Meinung zusammengedacht – Rehles Geburt fiel ungefähr in die Zeit, da zum ersten Mal und noch verwischt seine ›Idee‹ auftauchte –, und er blieb Sieger. »Mein Kind soll aufwachsen wie das Reh im Walde«, erklärte der Doktor seinem erschrockenen Schwiegervater, dem Gymnasialdirektor Burhenne. Davon bekam das Rehle seinen Namen und seine Richtung. Da man den Menschen nicht vor Gefahren für seine Gesundheit beschützen kann, muss man ihn an Gefahren gewöhnen und seine Disposition darauf einstellen, mit Gefahren fertigzuwerden – behauptete Doktor Persenthein. Demgemäß wuchs Rehle auf wie ein Bärenjunges oder wie ein Eskimokind. Hitze und Kälte, Schnee und Sonne, Nässe und Zugwind wurden gegen das kleine Etwas losgelassen, das mit drei Monaten nackt in den Spielwinkel gelegt wurde und dort allein und überraschend früh die Menschenkünste des Krabbelns, Sitzens, Gehens und Stehens lernte. Mit zwei Jahren war das Rehle narbenbedeckt wie ein Krieger, aber sehr vertraut mit allen kantigen, spitzigen, schneidenden, brennenden und sonst wie schmerzenden Dingen des täglichen Lebens und sehr geschickt darin, sie fortan zu meiden. Sie beroch alles, fraß alles und vertrug alles. Sie wurde groß und stark, sie verschaffte sich gelegentlich eine kleine Gehirnerschütterung, aber nie einen Schnupfen. Als sie drei Jahre alt war, klemmte Doktor Persenthein diese seine Tochter hinten auf das neu gekaufte Motorrad und nahm sie mit zu den Kranken, die er besuchte. Er setzte sie nach einem ausgerechneten und gut gesteigerten Verfahren der Bekanntschaft mit allen möglichen Bakterien aus, von der infektiösen Erkältung, deren Erreger unbekannt ist, bis zum populären Loefflerschen Bazillus, der die Diphtherie verursacht. In ganz tollen Augenblicken war Doktor Persenthein davon überzeugt, dass Rehle auch eine Röhre voll Streptokokken schlucken könne, ohne krank zu werden. Merkwürdigerweise blieb Rehle gesund. Das war kein wissenschaftlicher Beweis für Doktor Persentheins Theorie; aber er hatte manchmal Lust, es als Beweis anzusehen. Es gibt für den Menschen, der sich einer Idee verschreibt, solche schwindligen, absturznahen Augenblicke.
Elisabeth hätte die Himmelangst um ihr kleines Mädchen in dieser Zeit nicht ausgehalten, wenn sie nicht fromm gewesen wäre. Sie beredete die Sache mit Gott und der Madonna, sie huschte manchmal von Einkaufsgängen weg in die kleine, alte katholische Kirche, kniete neben dem Sarkophag der Sigismunda von Raitzold nieder und ließ sich beruhigen und trösten. Der Doktor schwor auf die Kraft seiner Idee. Elisabeth schwor auf die Kraft ihres Betens. Und das Rehle gedieh.
Die Leute von Lohwinckel ließen sich inzwischen von ihrem verrückten Doktor behandeln, aber sie hielten nichts von ihm, und im Laufe der Jahre wurde aus einer lächelnden Missachtung bissige Feindschaft.
Die Bevölkerung von Lohwinckel ist nicht gesünder oder kränker als der Durchschnitt in anderen kleinen Städten. Sie verzeichnet den normalen Prozentsatz an Rachitis, Tbc und S, sie hat ihre jährliche Grippezeit und ihre steigenden und fallenden Kurven für Keuchhusten, Masern, Scharlach und Diphtherie. Halsweh, Ohrenschmerzen und beginnende Magengeschwüre versucht man ohne Arzt loszuwerden. Mit Rheumatismus läuft man zum Apotheker Behrendt. Blinddärme fahren nach der Kreisstadt, wenn sie sich’s einigermaßen leisten können. Was bleibt, sind einige Knochenbrüche, die Geburten, die Kinderkrankheiten, die Krankenkassenpraxis. Und die Bleikrankheit.
In Lohwinckel verschaffte man sich die Bleikrankheit in Profets Akkumulatorenfabrik. Das war die einzige Fabrik des Ortes, sie stand am Rand der Vorstadt Obanger, mit unfreundlich gelbgrauen Mauern, und beschäftigte eine Menge Arbeiter. Bei diesen Arbeitern hatte Doktor Persenthein einen Durchschnitt von achtundzwanzig Prozent errechnet, die der Krankheit verfielen. Er vertiefte sich in die Literatur über diese Berufskrankheit, die in der Maske vieler anderer Krankheiten auftrat, als Nervenleiden, als Blutarmut, mit Krämpfen, Schmerzen, Magen-, Darm-, Leberleiden. Er studierte die Statistiken der großen Akkumulatorenfabriken, bei denen alles und jedes zum Schutz der Arbeiter geschah. Dort hatte man die Krankheit auf ein Nichts, auf ein halbes Prozent heruntergebracht. Aber Profets Fabrik mit ihren schlechten Anlagen, mit ihren notdürftig umgebauten Werkräumen einer früheren Färberei, mit ihren achtundzwanzig Prozent Bleikranken war die reine Giftbude. Man konnte nicht einmal Herrn Profet allein dafür verantwortlich machen, denn ihm wieder waren die Hände gebunden, solange Herr von Raitzold auf Grund und Boden saß und jedem Fabrikneubau und jeder Erweiterung seinen Dickkopf entgegensetzte. Die Arbeiter ihrerseits, diese Kaninchen, waren achtlos und fahrlässig im Umgang mit dem Gift und taten so, als müsse jeder Obangerer über kurz oder lang bleikrank werden. Der Doktor sah dem eine Zeit lang zu, dann nahm er den Kampf auf.
Doktor Persenthein begab sich auf die Suche nach einer Therapie gegen die Bleikrankheit.
Er fand in den nächsten drei Jahren sechs erprobte und zwei neue Behandlungsmethoden, die nichts halfen. Die Lohwinckler wurden skeptisch – aber nicht so skeptisch wie Doktor Persenthein selber, der aufhörte zu schlafen, der fieberhaft gereizt und unfreundlich in der Gegend herumknatterte, der rote Augenränder bekam und dessen germanischer Langschädel sich unter dem Ansturm von Gedanken, Sorgen und experimentellen Fehlschlägen ausbuckelte und einbuchtete wie eine Küste in der Brandung. Die Patienten fürchteten sich vor ihrem Arzt, was ungünstig auf ihr Befinden einwirkte, und Elisabeth fürchtete sich auch. Sie hatte Angst vor dem trotzigen Kummer, der oft in seinen Augen wohnte, vor seinem harten Auffahren bei Nacht, vor der Ungeduld in seiner Stimme. Das Hinhorchen, Hinspähen, Hinwarten auf seine Stimmung fraß ihr die Nerven weg, manchmal zitterte die Furcht körperlich fühlbar als eine kleine Kälte ihr Rückenmark entlang. Sie hätte den Mann gern in die Arme genommen, eingebettet, weich gemacht, ruhig gemacht. Aber gerade das konnte er nicht brauchen. Er stand im Kampf gegen eine Stadt, im Kampf gegen die Krankheit, zuletzt sogar im Kampf gegen die eigene Wissenschaft. Er musste hart und ruhelos bleiben.
Nun hatte er seit drei Jahren den Arbeiter Lungaus im Angermannshaus, das widerspenstige und streitsüchtige Objekt seiner medizinischen Experimente und das Zentrum, um das seine Gedanken kreisten. Es war zwanzig Minuten nach fünf, Schluss der Sprechstunde, und der Dunst aller ängstlichen und kranken Menschen, die den Nachmittag lang hier vorbeidefiliert waren, machte die Luft im Ordinationszimmer schwer.
»Anziehen«, sagte Doktor Persenthein und wusch sich die Hände. Lungaus kroch in seine Kleidung zurück.
Der Doktor schichtete Lungaus’ Krankenblätter zusammen, sie gaben fast eine kleine Broschüre ab. »Sie sind also jetzt gesund, Lungaus«, sagte er.
»Na –?«, erwiderte Lungaus zweifelnd und angelte nach seinem Hosenträger.
»Doch. Sie bleiben weiter bei mir im Haus und unter Aufsicht, aber Sie fangen wieder zu arbeiten an. Ich habe mit Herrn Profet gesprochen.«
»Will er mir denn wieder nehmen?«
»Ich habe ihn gebeten. Er tut es mir zuliebe.«
»Ihnen? Er kann Ihnen doch nicht riechen.«
»Vielleicht hat er Respekt vor mir, seit ich ihm den Gewerbe-Inspektor in die Fabrik gehetzt und die neue Staubabsaugevorrichtung durchgesetzt habe«, sagte Persenthein ausführlich. Merkwürdigerweise reizte ihn die störrische und unzufriedene Art von Lungaus immer zu längeren Gesprächen.
»Wegen der«, sagte Lungaus denn auch prompt. »Davon ist noch keiner weniger krank geworden.«
»Schön. Dann tut er es, weil er neugierig ist, wie das mit Ihnen weitergeht. Schließlich hat Herr Profet allerhand Interesse daran, ob wir mit der Bleikrankheit fertigwerden oder nicht.«
»Nein. Bestimmt nicht«, erklärte Lungaus sogleich. »Das letzte Mal hat es mir nach vier Monaten auch wieder gehabt.«
»Abwarten«, erwiderte der Doktor, der genauso unfreundlich sein konnte wie Lungaus.
»Dann will ich nicht in die Bude zurück. Dann will ich aufs Gut, wenn Sie mir schon durchaus gesundschreiben wollen«, sagte Lungaus und setzte sich auf den Untersuchungsstuhl, als wenn er nun viel Zeit für eine gründliche, erfrischende Auseinandersetzung vor sich wüsste. Der Doktor stieß ungeduldig mit dem Fuß gegen den weißen Eimer mit Watteabfällen.
»Aha«, sagte er. »Aha. Jetzt wollen Sie aufs Gut. Sonst kann man euch zureden wie Waldeseln, und die Raitzolds können sich die Beine ablaufen, sie kriegen keine Leute aufs Gut. Alle wollt ihr in die Fabrik. Aber wenn ihr mal auf der Nase gelegen habt mit Blei in den Knochen wie Sie vor drei Jahren, dann wollt ihr aufs Gut. Nee. Jetzt müssen Sie in die Fabrik zurück. Darauf kommt’s mir ja jetzt gerade an.«
»Zwingen kann mir keiner«, sagte Lungaus. Doktor Persenthein sprang auf und rannte dreimal rund um den Untersuchungsstuhl. Dann rückte er so nahe auf Lungaus zu, dass der Angst bekam und die Schulterblätter einzog.
»Mensch«, sagte Persenthein. »Jetzt hören Sie mal zu. Sie werden in die Fabrik zurückgehen, und Sie werden gesund bleiben, das sage ich Ihnen. Sie vergessen wohl, was wir miteinander abgemacht haben, bevor ich Sie ins Haus genommen habe. Sie vergessen wohl, wie und wo ich Sie aufgelesen habe? Man hat Sie durchgebracht, man hat Sie gesund gemacht, drei Jahre Arbeit, was, Arbeit, drei Jahre Leben hat man an Sie gehängt, bis man Ihren Kadaver so weit gebracht hat, sich zu besinnen, sich zu wehren. Unser ganzes Geld hat man an Sie gehängt, die Frau hat sich abgeschunden für Sie wie ein Tier, bewacht hat man Sie, Schweinereien haben Sie uns gemacht, gelogen haben Sie, alle Notizen hat man dreimal anfangen müssen, weil Sie heimlich saufen gegangen sind, die Befunde von einem Jahr haben Sie mir über den Haufen geschmissen durch Ihre Schwindeleien. Ein volles Zuchthaus bewache ich lieber als einen Menschen wie Sie, der genau nach der Vorschrift leben soll. Jetzt hat man Sie endlich so weit, jetzt soll die Probe aufs Exempel gemacht werden, da möchten Sie auskneifen. Das können Sie mir nicht antun, Lungaus –«
Lungaus schaute zum Doktor hinüber. Persenthein stand jetzt am Fensterbrett und hatte mit den Händen das Holz hinter sich gefasst. Es sah ein wenig aus, als hielte er sich dort fest, um nicht mit den Fäusten loszugehen. Lungaus spürte etwas in sich zerren, das er nicht erkannte; er wusste nicht, dass es Dankbarkeit war.
»Sie meinen’s ja so weit gewiss nicht schlecht«, brummte er. »Aber wenn Sie glauben, das ist ein Vergnügen, so Kuhfutter fressen und das Versuchskarnickel abgeben und Blutprobe jeden Monat und alles. Da hab’ ich mir oft gedacht: ›Wärste doch lieber gleich krepiert, als dir an den Doktor zu verkaufen‹, hab’ ich mir gedacht –«
Persenthein stieß sich vom Fenster ab zum Schreibtisch und blätterte in den Aufzeichnungen über den Fall Lungaus. Er hatte einen Weg gefunden, Doktor Persenthein, er hatte eine Idee, eine grundlegende, erschütternde Idee. Aber er hatte keine Möglichkeiten zu experimentieren, kein Laboratorium, keine Klinik, kein Menschenmaterial. Er hatte nichts als diesen einen, einzigen Lungaus, der sich an einem völlig verlorenen Punkt seiner Existenz hatte bereitfinden lassen, Doktor Persentheins neue Theorie am eigenen Leibe und unter strengster Bewachung durchzuführen. Die Notizen über Lungaus kannte er auswendig, Lungaus war der Extrakt seiner Arbeit, sein Beweis, sein Triumph. Den Organismus Lungaus hatte er Schritt für Schritt neu aufgebaut, umgeändert, umgestimmt und alle Widerstandskräfte gegen Gift und Krankheit in ihm wach gemacht. Kristalle von Erkenntnissen hatten sich um diesen Fall Lungaus angesetzt. Nicht nur die Bleikrankheit war verschwunden, sondern auch der Schützengrabenrheumatismus und eine offene Flechte am Fuß. Es musste einen Punkt der absoluten Gesundheit geben, von dem aus Krankwerden überhaupt unmöglich war. Doktor Persenthein, praktischer Arzt und Geburtshelfer in Lohwinckel, hatte nicht weniger vor, als diesen Punkt zu finden. Er war ziemlich allein, dieser Doktor Persenthein. Er hatte ein paar Sätze im Aristoteles zu Freunden und ein paar Ansichten, die er in einem umkämpften Buch gefunden hatte: Die Krise der Medizin. Nun ja. Und das Rehle. Und dann noch den renitenten Lungaus – – –
»Die Leute sagen überhaupt, Sie sind verrückt, sagen die Leute«, bemerkte Lungaus in das Schweigen hinein. Er hatte den Doktor betrachtet und dabei gedacht: ›Er hat manchmal Augen wie ein Hund.‹ Und damit meinte er das Durchscheinende in Persentheins Blick, während der den Fortlauf der Befunde las und summierte. ›Is auch ein Hund‹, dachte Lungaus ferner und tat seine unfreundliche Äußerung.
»Diese Kaninchen –«, sagte Persenthein nur wegwerfend; es war sein Sammelname für die Bewohner von Lohwinckel und Umgebung. »Was für einen Zauber wollen Sie denn nu gemacht haben, dass mir das Blei nicht mehr schaden soll und das Bein heil bleiben und alles?«, fragte Lungaus. Persenthein war ins Lapidare zurückgekehrt.
»Umgestimmt. Die Disposition geändert. Verstanden?«, sagte er.
»Nicht die Bohne«, sagte Lungaus.
»Also Mensch, passen Sie auf. Es kriegen doch nicht alle Leute Bleikrankheit, nicht wahr? Warum? Die Disposition ist nicht danach. Aber es kriegen auch nicht alle Leute Tbc, und wenn sie noch so viel Bazillen einatmen. Klar? Grippe kriegen viele, aber manche kriegen’s eben doch nicht. Rehle kriegt’s nicht. Sie werden’s jetzt auch nicht mehr kriegen. Wieso? Die Disposition, das ist es. Die Krankheit kann ich nicht ändern, die ist da, die atmen Sie ein, die fressen Sie, die saufen Sie, die hängt sich an Sie auf Millionen Arten. Aber Sie kann ich ändern, Sie verstehen? Den Menschen kann man ändern. Die Disposition muss man ändern können, das ist es. Ich kann’s noch nicht ganz, aber da ist ein Weg, passen Sie auf. Da ist etwas, das Aristoteles die vollkommene Harmonie nennt. Ein Mensch, der krank werden kann, dem fehlt diese Harmonie; ein gesunder Mensch, der krank wird, der war nicht gesund. Ein gesunder Mensch ist der, der überhaupt nicht krank werden kann. Ist das einfach?«
Lungaus überlegte das. »Haben Sie schon so ’nen Menschen gesehen?«, fragte er und zog die alten Hosen hoch. Persenthein überlegte auch. »Nee. Mediziner sehen überhaupt keine gesunden Menschen, nicht mal leidlich gesunde. Da steckt die Rechenfehler. Sie kriegen auf der Universität viermalhunderttausendachthundertzweiundsechzig verschiedene Krankheiten erklärt und gezeigt. Aber den Professor möcht ich mal sehen, der seine Studenten hinführt und sagt: ›Hier haben Sie einen gesunden Menschen. Bitte, betrachten Sie die Symptome genau!‹ Na. Wenn ich Geheimrat wäre–«
Persenthein fiel in Gedanken. Er baute ein unsinniges, kleines, totgeborenes Luftschloss. Er saß seit Langem an einer Arbeit über den Fall Lungaus – und über noch ein paar relativ überzeugende Fälle in Obanger, die sich einigermaßen seinen verwickelten Lebensvorschriften unterzogen hatten. Nun gut. Diese Arbeit musste einmal fertig werden. Sie ging an die Universitäten, an die medizinischen Gesellschaften. Die Arbeit wurde gedruckt. Die Arbeit machte Aufsehen. Es kamen Kapazitäten nach Lohwinckel, um an Ort und Stelle seine Erfolge nachzuprüfen. Persenthein konnte sich eine Kapazität in Lohwinckel – wo abends die Ziegen durch den Ort getrieben wurden und hinter der Kirche noch der Ententümpel lag – nicht vorstellen. Aber da er einmal beim Fantasieren war, ließ er eben einige Kapazitäten kommen, nachprüfen und staunen. Dann kam die Berufung. Dann kam –
»In die Fabrik geh ich nicht. Und dass Sie mir gesundschreiben, ist ’ne richtige Gemeinheit, ist das«, sagte Lungaus.
Persentheins Luftschloss knallte eilig zusammen und hinterließ den bitteren Geschmack fruchtlosen Ehrgeizes an seinem Gaumen. »Schlechte Luft hier«, murmelte er. »Schluss, Lungaus.«
Lungaus verließ den weißen Emailrand des Untersuchungsstuhles. »Also?«, fragte er an der Tür.
»Also. Montag wird in der Fabrik angetreten«, erwiderte Persenthein nur. Er konnte hart hinschlagen mit seinem Willen, wenn es sein musste. Lungaus kannte ihn.
»Schön, Montag also«, antwortete er deshalb gehorsam und verzog sich augenblicklich. Draußen stand schon die Frau in der Diele, wartend und mit forschendem Gesicht. »Wie ist er denn?«, fragte sie leise.
»Scharf, Mutter, scharf«, sagte Lungaus geduckt.
»Sie müssen jetzt baden, Lungaus, damit wir nachher die Wannen sauber machen können«, sagte Elisabeth und ließ sich nichts anmerken. Ein böser Tag mit der Meldung von Jakob Wirz’ amputiertem Arm im Block.
»Sind keine von den Kaninchen mehr unten?«, fragte Lungaus, der von Persenthein gelernt hatte, die Feindschaft der Lohwinckler mit grimmiger Verachtung zu erwidern.
»Nur noch zwei. Nur hinunter mit Ihnen. Das Essen ist schon fertig für Sie«, sagte Elisabeth, nahm sich zusammen und trat ins Ordinationszimmer ein. Sie hatte in letzter Zeit die Gewohnheit angenommen, sich einen kleinen Ruck zu geben, bevor sie Kola unter die Augen kam; aber das wusste sie nicht. Kola war gerade dabei, einen Abstrich postfertig zu verpacken und an das Hygienische Institut in Schaffenburg zu adressieren. »Kann ich schon Ordnung machen?«, fragte Elisabeth und öffnete das Fenster. »Ach – Luft –«, sagte Kola zerstreut; er hatte abwesende Augen, und es war ersichtlich, dass er Elisabeth nicht bemerkte. Er stand auf, wusch sich die Hände und begann mit finsterer Miene einen seiner kleinen Rundläufe um den Untersuchungsstuhl.
»Müde?«, fragte die Frau, bekam aber keine Antwort.
»Man müsste mal –«, sagte Persenthein drei Minuten später und ohne Zusammenhang.
»Ja. Soll ich Schroeder anrufen?«, fragte sie sofort, denn sie war so zu Hause in seinen Gedanken, dass sie keine Wegweiser brauchte.
»Ich möchte am liebsten von dieser versauten Geschichte mit dem Wirz nichts mehr hören«, antwortete er. »Ja. Kannst anrufen«, setzte er nach einem Augenblick hinzu, während dessen Elisabeth ihn angesehen hatte. Mitleid war in ihrem Blick und die Angst, das Mitleid zu zeigen. Während sie an der altmodischen Telefonkurbel drehte, holte er das Krankenblatt des Jakob Wirz hervor und begann es, heftig rauchend, zu studieren.
»Wann willst du essen?«, fragte die Frau, während sie darauf wartete, dass das Ferngespräch mit dem Krankenhaus in Schaffenburg gemeldet würde.
»Ach lass. Ganz schnuppe.«
Elisabeth trug den Abfalleimer hinaus, vor der Tür draußen seufzte sie ein bisschen, und dann kam sie wieder zurück. Es war nicht abwechslungsreich, was geschah, nein, und man verstand, dass der Mann ungeduldig wurde. Aber aus was bestand die Ehe, wenn nicht aus diesen Fragen: Bist du müde? Wann willst du essen? Warum schläfst du nicht? Es waren die ewigen, unveränderlichen Fragen der Frau an den Mann von Urzeiten her. Elisabeth schaute Persenthein von der Seite an, spähend, besorgt, mitleidig und ein klein wenig aufsässig; er spürte den Blick und empfand ihn als Last, er jagte ihn mit einem kleinen Zucken seiner Schultern von sich weg. Elisabeth ließ sogleich von ihm ab, ging zum Schreibtisch hinüber und entschloss sich zu etwas Unangenehmem.
»Willst du jetzt das Wirtschaftsbuch durchsehen, Kola?«, fragte sie, und das klang schuldbewusst.
»Du weißt doch –«, sagte er auffahrend. Elisabeth machte den Mund ganz fest zu und wartete. Sie kannte ihren Mann so genau, dass er nicht mehr nötig hatte, deutliche Sätze an sie zu wenden.
»Nein, heute. Morgen ist wieder etwas anderes los. Hilf mir doch beim Rechnen. Ich brauche eben Geld –«, murmelte sie vorsichtig.
»Wenn ich Geld hätte, würde ich dir’s geben. Geld!«, murmelte der Doktor zurück, der sich über eine Rekordspritze hergemacht hatte, die er in Äther wusch. Der Narkosegeruch stieß an Elisabeths Nasenflügel und verhing sich in ihrem Haar.
»Wofür denn?«, fragte Persenthein hinterher.
»Ich muss endlich bei Markus bezahlen.«
»Der wartet auch noch. Ich muss auch warten. Vielleicht entschließt sich Herr Profet gelegentlich, die Arztrechnung in Ordnung zu bringen. Dann kommt Markus dran.«
»Und ich habe bei Raitzolds erinnert – du warst im August täglich auf dem Gut –«
»Raitzolds haben selber nichts.«
»Du stehst so komisch mit dem Fräulein – Raitzolds brauchen nie zu bezahlen.«
»Komisch? Gar nicht komisch. Sie ist ein Prachtmensch, das kannst du glauben.«
»Mit Röhrenstiefeln –«
»Schön, mit Röhrenstiefeln. Lass doch den Lohwinckler Tratsch.«
»Über uns tratschen sie ja auch«, sagte Elisabeth betrübt. Persenthein grunzte nur. Er hatte die Telefonmuschel ins Auge gefasst wie einen Feind und wartete.
»Also kein Geld?«, fragte Elisabeth. »Was soll ich denn nur bei Markus sagen – mir ist das so peinlich –«
Wenn Persenthein an seiner Frau die schwache Ähnlichkeit mit Herrn Gymnasialdirektor Burhenne, ihrem Vater, wahrnahm – und diese Ähnlichkeit trat in Momenten besonderer Sorge und Abspannung zutage –, dann wurde er ungeduldig. »Peinlich –!«, flüsterte er, was gereizter klang, als wenn er es geschrien hätte. »Peinlich!«
»Das macht deine Stellung nur noch schwerer, wenn die Leute wissen, dass wir beim Kaufmann Schulden haben.«
»Woher wissen sie’s denn? Erzählt der Jude das herum? Ich dachte, er ist anhänglich.«
»Das braucht der gar nicht zu erzählen. Sie wissen’s eben. Sie sagen nämlich –«
»Was denn? Sie sagen, dass ich verrückt bin. Sie sagen, dass ich Magenkatarrh nicht von Scharlach unterscheiden kann und dass der Kreisarzt kommen musste, weil mir drei Leute an Grippe gestorben sind. Was die alles sagen –«
»Sie sagen, Markus gibt uns alles billiger, weil er in mich verliebt ist. Und dann kann ich nicht einmal bezahlen. Das ist doch mehr als peinlich.«
»Na also. Wenn er verliebt ist, kann er doch warten«, beschloss Persenthein plötzlich zufrieden. Elisabeth schluckte erst einmal eine kaum greifbare Enttäuschung hinunter, dann fing sie an zu lachen.
»Standesbewusstsein hast du wohl nicht?«, sagte sie und ging auf ihn zu. Es gab noch immer Momente, in denen er ihr Gehen, Kommen, ihr Nähertreten und Bei-ihm-Sein spürte, als Glück spürte, als eine Freude, eine Schwingung. Sie erkannte sogleich die Lockerung in seinen Mundwinkeln.
»Nein. Nicht die Spur«, sagte er zugleich als widerspenstige Antwort. »Vielleicht hättest du mit dem teuren Pantostat noch warten sollen?«, sagte sie, als sie bei ihm angelangt war; sie lächelte dazu, es war ihr nicht ernst damit.
»Ja, sag das nur deinem Seelenfreund. Ich habe zu viel Geld in meinem Laden investiert, sag ihm das; darum kann ich jetzt die Kolonialwarenrechnung nicht bezahlen. Einen Apparat für Bluttransfusion muss ich auch bald haben, so viel ist sicher. Frau Melkin hätte ich am Leben halten können – bis sie mich nach Obanger zu so etwas holen, sind die Frauen immer schon ganz ausgeblutet. Ich habe mir eine kleine Liste von Blutspendern angelegt, alle Blutgruppen, beste Ordnung, wie in einer Klinik, nur der Apparat fehlt. Kostet nicht einmal viel –«
Bevor noch Frau Persenthein ihren Gedankengang gegen den Apparat kundgeben konnte, kam das Telefongespräch aus Schaffenburg. Elisabeth warf einen scheuen Blick auf Persenthein, dessen Gesicht sich zu einer gleichgültigen Maske zusammenriss, während er die Muschel abnahm, und glitt aus der Tür.
»Sei still, Rehle«, flüsterte sie draußen. Es war ganz finster in der Diele, und sie spürte das Kind dort mehr, als sie es sah. »Kola hat ein Ferngespräch.« Sie setzte sich auf die Wandbank, die sonst den Patienten gehörte, und zog das Kind an sich.
»Wegen des Mannes, der sich in den Finger gehackt hat?«, flüsterte Rehle.
»Ja. Was weißt denn du davon?«, fragte Elisabeth verwundert.
»Ich war doch mit auf dem Gut, wie er’s verbunden hat. Erst hat’s geblutet, dann hat’s aufgehört. Der Mann hat gelacht dabei. Kola hat gesagt: ›Der ist nicht so wehleidig wie Rehle.‹ Ich bin aber gar nicht wehleidig. Wie ich in die Fensterscheibe gefallen bin, hab’ ich bloß wegen der Scheibe geweint, dass sie kaputt war, es hat auch nicht arg wehgetan. Schade, wenn der Mann totgehen muss, nicht?«
»Der geht doch nicht tot«, flüsterte Elisabeth flehend in Rehles warmes Haar. Weil es dunkel war, gestattete sie sich, ihren Mund in diese Wärme zu legen.