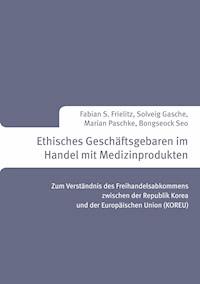
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch leistet einen grundlegenden Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Konzeption von Freihandelsabkommen. Das Freihandelsabkommen zwischen der Republik Korea und der Europäischen Union aus dem Jahr 2015 hat mit der Regelung zum "ethischen Geschäftsgebaren" einen neuen Rechtsbegriff in Freihandelsabkommen der EU eingeführt. Seine Bedeutung ist bisher ungeklärt. Die Studie identifiziert Parameter für das Verständnis dieser Rechtsregel im Medizinproduktehandel sowie im Gesundheitswesen in ökonomischer und rechtlicher Hinsicht. Erarbeitet werden grundsätzliche Elemente eines modernen Freihandelsregimes nach dem Konzept der Corporate Social Responsibility.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORWORT
Das Freihandelsabkommen zwischen der Republik Korea und der Europäischen Union aus dem Jahr 2015 hat mit der Regelung zum „ethischen Geschäftsgebaren“ einen neuen Rechtsbegriff in Freihandelsabkommen der EU eingeführt. Seine Bedeutung ist bisher ungeklärt. Die Verfasser haben im Rahmen eines von der DFG geförderten Forschungsprojektes zur Anbahnung einer bilateralen wissenschaftlichen Kooperation Inhalt und Tragweite des Begriffes untersucht. Die Ergebnisse dieses Projekts werden mit dieser Publikation vorgestellt.
Das Freihandelsabkommen bezieht „ethisches Geschäftsgebaren“ explizit auf das Gesundheitswesen. Die Studie konzentriert sich zunächst darauf, Parameter für das Verständnis dieser Rechtsregel im Medizinproduktehandel sowie im Gesundheitswesen in ökonomischer und rechtlicher Hinsicht zu identifizieren. Dabei werden Grundlagenfragen im ethischen und medizinethischen Diskurs und ihre jeweilige Bedeutung in den betroffenen Kulturkreisen aufgeworfen. Die Untersuchung adressiert ferner, ob und inwieweit „ethisches Geschäftsgebaren“ über den besonders schützenswerten Bereich des Gesundheitswesens hinaus eine umfassendere Bedeutung für das grundsätzliche Verständnis des Prinzips vom Freihandel in bilateralen Abkommen entfaltet.
Die Verfasser bedanken sich bei der DFG für die Unterstützung bei der Anbahnung eines bilateralen Forschungsprojektes und der dadurch etablierten Kontakte der Universität Hamburg und der Universität zu Lübeck mit den koreanischen Forschungseinrichtungen der Seoul National University, der EWHA Womans University und der Youngsan University.
Hamburg im Mai 2017
Fabian S. Frielitz, Solveig Gasche, Marian Paschke, Bongseock Seo
GLIEDERUNG
Medizinproduktehandel und ethisches Geschäftsgebaren
KOREU FHA und ethisches Geschäftsgebaren
Grundlagen
KOREU FHA im Überblick und Kontext
Zielsetzungen, Inhalte und Elemente
Europäische Perspektive
aa) Allgemeine Zielsetzungen
bb) Besonderheiten für Arzneimittel und Medizinprodukte
cc) Ethisches Geschäftsgebaren
Koreanische Perspektive
aa) Grundsätzliche Erwägungen
bb) Ausgewählte besondere Aspekte des Arzneimittel- und Medizingerätehandels
Vergleich mit dem Recht der WTO und anderen Freihandelsabkommen
Recht der WTO
Vergleiche in Bezug auf den Medizinproduktehandel
Vergleich mit dem KORUS FHA
Ökonomische Rahmenbedingungen und Zulassungsverfahren des Medizintechniksektors am Beispiel des Handels zwischen Deutschland und Korea
Wachstumsmarkt „Medizintechnik“
Zulassungsverfahren für Medizinprodukte
Zulassung in Deutschland und Europa
Zulassung in Deutschland und Europa
Funktion und Bedeutung
Demografische Entwicklung
Medizintechnikunternehmen in Deutschland
Medizintechnikunternehmen in Südkorea
Zusammenfassung
Ethisches Geschäftsgebaren als neuer und konkretisierungsbedürftiger Rechtsbegriff
Geschäftsgebaren in ethischer Verantwortung
Politisch-philosophischer Diskurs
Handelspolitischer Diskurs auf der Ebene der EU
Zusammenhang mit dem Corporate Social Responsibility-Diskurs
Medizinethischer Diskurs
Ethisches Geschäftsgebaren als ausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff des KOREU FHA
Übersicht zu Art. 1 und Art. 4 Annex 2-D
Exegese des KOREU FHA-Textes
Art. 1 Buchstabe e) Annex 2-D
Art. 4 Abs. 1 Annex 2-D
Zwischenergebnis
Ethisches Geschäftsgebaren als Ausdruck von „Responsible Trading“
Grundlagen
Sozialwissenschaftliche Bezüge
Materiellrechtliche Bezüge - Verantwortung und Haftung
Innenhaftung
Außenhaftung
Systematische Einordnung
Responsible Trading mit Medizinprodukten im Rahmen des KOREU FHA
Ethisches Geschäftsgebaren im Kontext von Responsible Trading
Zwischenergebnis
Fazit
Herausforderungen und Ergebnisse
Ausblick
Anlage 1: KOREU FHA, Anhang 2-D (deutsche Fassung)
Anlage 2: KOREU FHA, Anhang 2-D (englische Fassung)
LITERATURVERZEICHNIS
INTERNETQUELLEN
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
A. Medizinproduktehandel und ethisches Geschäftsgebaren
Der internationale Handel mit Arzneimitteln und Medizinprodukten wird von ökonomischen Erwägungen geprägt. Übergreifende Wohlfahrtsvorstellungen finden in den Handelsbeziehungen der Partner von Arzneimittel- und Medizinproduktegeschäften regelmäßig keinen Niederschlag. Das Geschäft ist für die Partner gelungen, wenn die wirtschaftlichen Ergebnisse stimmen. Ob und dass sich das Geschäft gesamtgesellschaftlich bzw. im Sinne des betroffenen Gesundheitssektors wohlfahrtssteigernd auswirkt und die Verhältnisse insbesondere im Gesundheitswesen befördert, wird als Resultante des wirtschaftlich erfolgreich abgeschlossenen Geschäfts erwartet, regelmäßig aber nicht näher reflektiert.
Der vom Freihandelsabkommen zwischen Korea und der EU (KOREU FHA) betroffene Medizinproduktehandel stellt insofern eine Besonderheit dar, als das Abkommen – wohl erstmals in der Geschichte von Freihandelsabkommen der EU und Koreas – Wohlfahrtsvorstellungen explizit thematisiert. Das KOREU FHA regelt in seinem Anhang zum Arzneimittel- und Medizinproduktehandel explizit eine Pflicht zu ethischem Geschäftsgebaren.
Die vorliegende Publikation hat sich - auf der Grundlage eines angebahnten entsprechenden Forschungsvorhabens - zum Ziel gesetzt, die Bedeutung von komplexeren wohlfahrtsökonomischen Herausforderungen des bilateralen Handels mit Arzneimitteln und Medizinprodukten im Gesundheitswesen sowie in den Bereichen von Bildung und Gesellschaft, von Ausbildung und Beruf und von Gesundheitsversorgung und –finanzierung in Betracht zu ziehen und zu analysieren. Insbesondere sollen sachgerechte Rahmenbedingungen für Handelsbeziehungen und Lieferverträge über Arzneimittel und Medizinprodukte unter dem geltenden Freihandelsabkommen identifiziert und gesundheitsökonomische und wohlfahrtssteigernde Elemente im Liefer- und Zielland ermittelt und in ein modernes Transaktionsmodell für die bilateralen Handelsbeziehungen von Korea und Deutschland integriert werden.
Es soll insbesondere auch der Frage nach der Bedeutung der im KOREU FHA verankerten Pflicht zu ethischem Geschäftsgebaren nachgegangen werden, verbunden mit der Zielvorstellung, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Entfaltung ethischen Geschäftsgebarens und dessen Implementierung in die Handelsbeziehungen insbesondere für Arzneimittel und Medizinprodukte der modernen Hochleistungsmedizin zu erarbeiten.
Untersucht werden soll auf der Grundlage der Analyse des Konzepts der Corporate Social Responsibility auch, ob mit dem rechtsverbindlichen Terminus „ethisches Geschäftsgebaren“ ein übergreifender Ansatz eines hier so genannten „responsible trading“ adressiert und damit ein die Freihandelskonzeption des internationalen Wirtschaftsrechts ergänzendes rechtswissenschaftliches Verständnis internationaler Handelsbeziehungen angebahnt wird. Mit seiner Verankerung im KOREU FHA könnte ein „responsible trading“-Konzept den normativen Rahmen für eine am Gemeinwohl orientierte Entwicklung des bilateralen Handelsrechts für Arzneimittel- und Medizinproduktehandel bzw. den internationalen Handel überhaupt neu justieren.
B. KOREU FHA und ethisches Geschäftsgebaren
I. Grundlagen
Mit dem Abschluss von Freihandelsabkommen legen die Vertragspartner untereinander fest, dass bestehende Handelshemmnisse abgebaut und keine neuen Handelshemmnisse errichtet werden.1 Freihandelsabkommen sind regelmäßig Abkommen, die den Handel zwischen den Vertragsparteien des Abkommens betreffen und ihn regelmäßig zu fördern und stärken beabsichtigen, ohne eine Zollunion zu errichten.2 Im bilateralen Verhältnis zwischen den Vertragspartnern wird – ggfs. über bestehende multilaterale Verpflichtung hinaus3 - die Autonomie der Handelspolitik zugleich völkerrechtlich verbindlich eingeschränkt4 und auf eine Liberalisierung des Marktzugangs und der Handelsbeziehungen festgelegt.5 Mit dem Abbau tarifärer und nichttarifärer Handelshemmnisse gelten Freihandelsabkommen regelmäßig als wichtiger Schritt zu einer engeren wirtschaftlichen Integration zwischen den beteiligten Ländern.6
II. KOREU FHA im Überblick und Kontext
Zwischen der EU und Korea gilt das nach der Ratifikation der Parlamente am 13. Dezember 2015 in Kraft befindliche Freihandelsabkommen sowie das seit dem 1. Juni 2014 in Kraft befindliche Rahmenabkommen andererseits. Die Kapitel des Freihandelsabkommens greifen die entsprechenden Regeln des WTO-Rechts, insbesondere die des GATT 1994 auf und ergänzen bzw. variieren diese für den Bereich des bilateralen Handels zwischen der EU/Deutschland und Südkorea. Zur Komplexität des ohnehin schon umfänglichen rechtlichen Umfelds für den Handel mit Medizingeräten und Investitions- und Handelsgeschäftsentscheidungen in den Beziehungen zwischen Korea und der EU/Deutschland gehört der Annex 2-D des Freihandelsabkommens. In ihm finden sich besondere Regelungen für den Handel mit Arzneimitteln und Medizinprodukten.
Im Mai 2007 wurden in Seoul die Verhandlungen zu dem Freihandelsabkommen aufgenommen. Nach acht offiziellen Gesprächsrunden wurde das FHA am 15. Oktober 2009 von beiden Seiten paraphiert. Am 16. September 2010 genehmigte der Rat das FHA, und das Abkommen wurde am 6. Oktober 2010 am Rande des EU-Korea-Gipfeltreffens in Brüssel offiziell unterzeichnet. Das Europäische Parlament stimmte dem FHA am 17. Februar 2011 zu. Nachdem das Freihandelsabkommen (Präferenzabkommen) zwischen der Republik Korea und der Europäischen Union (EU) auch vom koreanischen Parlament ratifiziert worden ist, ist das Abkommen am 1. Juli 2011 in Kraft getreten. Dieses Abkommen wurde durch ein neues Rahmenabkommen zwischen der EU und Korea7 aktualisiert und ersetzt;8 dieses ist am 1. Juni 2014 in Kraft getreten.9
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Republik Korea ist das erste seiner Art, das die EU mit einem asiatischen Partner abgeschlossen hat.10 Zugleich dürfte es für die EU das bis dahin ehrgeizigste und umfangreichste Freihandelsabkommen im Rahmen europäischer Handelspolitik sein. In einem Zeitraum von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens werden rund 99 % aller Zölle in der EU und Korea wegfallen. Rund 70 % der Zölle wurden bereits zum 1. Juli 2011 aufgehoben werden.
Das Abkommen beinhaltet Bestimmungen über Investitionen, sowohl für Dienstleistungs- als auch Industriesektoren, und umfasst wichtige Bereiche wie den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums und das öffentliche Beschaffungswesen. Darüber hinaus wurden für Sektoren wie die Automobil-, die Arzneimittel-, die Medizinprodukte und die Elektronikindustrie besondere Verpflichtungen vereinbart, um nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen oder um ihre Einführung zu verhindern. Die Exporteure von Arzneimitteln und Medizinprodukten sollen von der größeren Transparenz bei der Preisfestsetzung profitieren, u. a. von ausführlichen, bindenden Vorschriften zur Transparenz von Erstattungsfestsetzungen und von der Option, eine solche Preisfestsetzung von einem Gericht prüfen zu lassen.
Das neue Abkommen koppelt, wie die meisten EU-Präferenzabkommen, die Zollvergünstigungen an den Ursprung der Waren. Dabei orientieren sich die Ursprungsregeln im Wesentlichen am Muster der Ursprungsprotokolle wie sie derzeit in den Paneuropa-Mittelmeer-Abkommen vorgesehen sind. Sie sind aber im Einzelfall auf ihre Einhaltung zu überprüfen. Spezielle Ursprungsregelungen, die von den anderen Abkommen abweichen, sind aus Rechtsgründen nicht ausgeschlossen.
Das Abkommen sieht einige bedeutende Neuerungen vor. So basieren die Zollvergünstigungen des Abkommens formal nicht mehr auf der Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1. Stattdessen kann bis zum Lieferwert von 6.000 Euro jeder EU-Exporteur auf seinen Handelsrechnungen für Südkorea die vom Text her bekannte Präferenz-Ursprungserklärung abgeben, jeweils unter der Voraussetzung, dass es sich um EU-Ursprungsware handelt. Liefersendungen mit einem höheren Warenwert können unter Präferenzbedingungen nur noch im Verfahren des „Ermächtigten Ausführers (EA)“ abgewickelt werden. Dies gilt für Lieferungen nach Südkorea ebenso wie für Bezüge von dort.
Im sogenannten "Tariff Schedule of Korea" finden sich die Zollsätze, die für den Import in Korea maßgeblich sind. Zur Prüfung des Zollsatzes in diesem Zusammenhang muss auch der Annex 2-A (elimination of customs duties) hinzugezogen werden. Die bislang geltenden Zollsätze (Base Rate) werden je nach Ware im Laufe von zum Teil mehreren Jahren reduziert. Der Annex 2-A (elimination of customs duties) gibt darüber Aufschluss.
Insgesamt schafft das Freihandelsabkommen für die betroffenen Einrichtungen und Personen in Korea und Deutschland neue rechtsverbindliche Grundlagen, die von den Handelspartnern zum wechselseitigen Vorteil genutzt werden können.
1. Zielsetzungen, Inhalte und Elemente
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea ist nicht allein und nicht einmal in erster Linie ein dem Handel mit Arzneimitteln und Medizinprodukten gewidmetes Abkommen. Es ist vielmehr als sektorübergreifendes Abkommen konzipiert, das zahlreiche Wirtschaftssektoren berührt und mannigfache Elemente aufweist. Es ist aber auch ein Abkommen, das explizit dem Handel mit Arzneimitteln und Medizinprodukten ein eigenes Kapitel widmet. Das Abkommen und sein Annex zum hier besonders interessierenden Sektor des Arzneimittel- und Medizinproduktehandels (Annex 2-D) sind für beide Seiten gemeinsam und überstimmend verbindliche Rechtstexte. Diese werden möglicherweise aus der jeweiligen regionalen Perspektive anders wahrgenommen und gewürdigt. Dies erhellt insbesondere die später noch näher zu behandelnde, unterschiedlich ausgeprägte ökonomische Bedeutung der Handelsbeziehungen im Arzneimittel- und Medizinproduktebereich zwischen beiden Abkommenspartnern.11 Nachfolgend soll analysiert werden, ob und inwiefern über die ökonomische Betrachtung hinaus in der EU und in Korea mit dem Abkommen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt werden bzw. in den jeweiligen Räumen von Wirtschaft und Gesellschaft eine besondere Wahrnehmung seiner Inhalte und Elemente erfolgt.
a) Europäische Perspektive
aa) Allgemeine Zielsetzungen
In der EU wird das Freihandelsabkommen mit der Republik Korea als das „erste einer neuen Generation von FHA“ angesehen.12 Es soll aus europäischer Perspektive europäischen Unternehmen den Zugang zu den dynamischen Märkten in Asien erleichtern und eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer weiteren Liberalisierung der Handelsbeziehungen übernehmen, die auf multilateraler Ebene derzeit nicht für erreichbar angesehen werden.
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Korea ist nicht nur das erste Freihandelsabkommen mit einem asiatischen Partnerland, es ist auch das umfassendste Freihandelsabkommen, das die EU bis dato ausgehandelt hat. Es sieht vor, dass Einfuhrzölle auf nahezu alle Waren beseitigt werden; nahezu sämtliche Zölle werden innerhalb von fünf Jahren abgebaut. Der Handel mit Dienstleistungen, unter Einschluss der Telekommunikation, Umweltdienstleistungen, Versand, Finanz- und Rechtsdienstleistungen, wird für sämtliche Erbringungsarten weitgehend liberalisiert. Die „Einzigartigkeit des Abkommens“ zeigt sich nach der Bewertung durch den EU-Handelskommissar sowohl in seinem Geltungsbereich als auch darin, wie rasch der Abbau der Handelshemmnisse erfolgen soll.13 Am Ende der Übergangszeiträume werden nahezu alle Einfuhrzölle zwischen den beiden Volkswirtschaften abgebaut sein. Dementsprechend werden für den Handel mit Waren und Dienstleistungen weitreichende Wachstumsperspektiven eröffnet, deren Wert auf über 19 Mrd. EUR geschätzt werden. Die Zielsetzung des Freihandelsabkommens ist deshalb aus europäischer Perspektive in erster Linie die eines verbesserten Marktzugangs zu dem koreanischen Markt, der die Stellung der EU-Handelspartner Lieferanten auf dem koreanischen Markt weiter festigen soll.14
Nicht zuletzt im Hinblick auf die erhebliche Bedeutung des Abkommens für sämtliche Wirtschaftssektoren hat das Abkommen bereits besondere Aufmerksamkeit nicht nur im politischen Raum gefunden. In rechtswissenschaftlichen Studien wird vor allem die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Korea vor dem weltwirtschaftlichen Ordnungsrahmen des Rechts der WTO gewürdigt.15 In anderen Stellungnahmen wird die wirtschaftlich-rechtliche Bedeutung des Handels zwischen beiden Staaten unter besonderer Betonung des Handels im Bereich von Arzneimitteln und Medizinprodukten hervorgehoben.16
Aus rechtlicher Sicht ist hervorzuheben, dass in Artikel 1.1 des Abkommens, der dessen Zielsetzungen und allgemeine Begriffsbestimmungen regelt, die Konzeption des Abkommens aufgegriffen und dementsprechend in erster Linie ökonomische Zielsetzungen angeführt werden. In Art. 1.1. Buchstabe a) wird die „beiderseitige Liberalisierung und Erleichterung des Warenverkehrs“ und – in Buchstabe b) die „beiderseitige Liberalisierung und Erleichterung des Handels mit Dienstleistungen und Investitionen“ genannt. Außerdem wird die „Förderung des Wettbewerbs in den Volkswirtschaften der Vertragsparteien, insbesondere in Bezug auf die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen“ (Buchstabe c)) und die „weitere Liberalisierung der Märkte für das öffentliche Beschaffungswesen nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit“ (Buchstabe d)) genannt. Damit bewegt sich das Freihandelsabkommen auf den bekannten Pfaden der Marktzugangsliberalisierung.
Zu den heute weitgehend allgemein anerkannten wirtschaftlichen Zielsetzungen des Abkommens gehören auch die Regelungen, die den „angemessenen und wirksamen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums“ (Buchstabe e) sowie die „Förderung der harmonischen Entwicklung und Ausweitung des Welthandels durch Beseitigung von Handelsschranken und Schaffung von Rahmenbedingungen, die der Verstärkung der Investitionsströme dienlich sind“ (Buchstabe f)), zum Gegenstand haben.
In demselben Artikel finden sich dann aber auch – und dies sind traditionell wenig bekannte - neu entwickelte Regeln, die nichtökonomische Zielsetzungen zum Inhalt haben. So regelt das Abkommen in Art. 1.1 Buchstabe g) eine „Festlegung auf die Weiterentwicklung des internationalen Handels in dem Bestreben, dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung näher zu kommen und zu gewährleisten, dass die Vertragsparteien dieses Ziel auf allen Ebenen ihrer Handelsbeziehungen zur Geltung bringen, in dem Bewusstsein, dass nachhaltige Entwicklung ein übergeordnetes Ziel darstellt“. Diese Nachhaltigkeitsmaxime wird ergänzt durch Umwelt- sowie Arbeits- und Gesundheitsschutzkomponenten. In Art. 1.1 Buchstabe h) heißt es, dass die „Förderung ausländischer Direktinvestitionen ohne Abschwächung oder Reduzierung der Normen in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsrecht oder Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz bei der Anwendung und Durchsetzung des Arbeits- und Umweltrechts durch die Vertragsparteien“ erreicht werden soll.
Diese nichtökonomischen allgemeinen Zielsetzungen des Abkommens werden in dem Text des Freihandelsabkommens in besonderer Weise und regelungstechnisch differenziert ausgestaltet. Die Nachhaltigkeitsmaxime soll auf allen Ebenen der Handelsbeziehung zur Geltung gebracht werden. Sie wird allerdings auf das Ziel der Weiterentwicklung des internationalen Handels festgelegt und damit inhaltlich konditioniert. Die Zielsetzungen im Bereich des Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind demgegenüber regelungsgegenständlich begrenzt; sie beziehen sich allein auf den Bereich der Förderung ausländischer Direktinvestitionen, sind dann aber inhaltlich nicht in besonderer Weise determiniert und insbesondere nicht an die Entwicklung des internationalen Handels gebunden.
Aussagen zu ethischem Geschäftsgebaren finden sich in den Regelungen zu den allgemeinen Inhalten und Zielsetzungen des Abkommens nicht. Sie finden sich auch nicht in den sektorspezifischen Regelungen betreffenden Anlagen des Abkommens. Sie haben vielmehr erstmals und allein im Anhang 2-D und den dort getroffenen Regelungen für den Bereich des Arzneimittel- und Medizinproduktehandels Eingang in den Text des Abkommens gefunden.
bb) Besonderheiten für Arzneimittel und Medizinprodukte
Arzneimittel und Medizinprodukte gehören zu den wichtigsten, wettbewerbsfähigen Exportgegenständen der EU. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2016 Medizinprodukte und Medizintechnik im Wert von ca. 26 Mrd. EUR exportiert, dies entspricht rund 22,4 Prozent der gesamten Exporte der deutschen Gesundheitswirtschaft.17 Im Bereich des Arzneimittel- und Medizinproduktehandels dürften nichttarifäre Hemmnisse, insbesondere Preisfestsetzungs- und Kostenerstattungsvorschriften, für EU-Exporteure die größten Hindernisse bei der Ausfuhr nach Korea darstellen.
Nicht anders als in vielen EU-Mitgliedstaaten setzen auch in Korea die Gesundheitsbehörden die Arzneimittelpreise fest. In der EU bestehen nach Auffassung der Kommission Bedenken hinsichtlich der Transparenz dieses Prozesses; entsprechendes gilt für die Möglichkeit, im Falle einer negativen Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. Darauf reagiert das Freihandelsabkommen dadurch, dass es eine größere Transparenz für das koreanische Regulierungssystem im Allgemeinen und für die Vorschriften und Entscheidungen Koreas hinsichtlich der Preis- und Erstattungsfestsetzung im Besonderen einführt. Das Abkommen misst der Einhaltung internationaler Normen und Verfahren bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften größere Bedeutung bei und durch eine gemeinsame Begriffsbestimmung für Arzneimittel und Medizinprodukte in der EU und Korea soll die Rechtssicherheit erhöht werden.
Das Abkommen regelt dies in einem speziellen Anhang (Annex 2-D), der den Handel mit Arzneimitteln und Medizinprodukten betrifft. Neben den allgemeinen Bestimmungen des Abkommens werden darin spezielle Marktzugangsregeln für den Zugang zu innovativen Medizinprodukten geschaffen. Artikel 3 des Anhangs 2-D sieht bestimmte Transparenzregeln vor und die Parteien des Übereinkommens haben eine Zusammenarbeit der Regulierung des betroffenen Sektors vereinbart.
Der Rechtsbegriff „Medizinprodukte“ wird in Art. 6 Ziff. 2 Freihandelsabkommen Annex 2-D umfänglich definiert. Medizinprodukte sind danach
„alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe oder anderen Gegenstände, die vom Hersteller zur Anwendung beim Menschen für die Diagnose, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten bestimmt sind. Auch Software, die vom Hersteller in das Gerät eingebaut wird und für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlich ist, gilt als Medizinprodukt.“
Annex 2-D des Freihandelsabkommens ist in dem erklärten Bewusstsein geschlossen worden, mit den Übereinkommensinhalten die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dem entsprechend heißt es in Art. 1 Annex 2-D: „Die Vertragsparteien sind sich der Unterschiede zwischen ihren Gesundheitssystemen bewusst, teilen jedoch das Ziel, im Interesse einer ständigen Verbesserung der Gesundheit ihrer Bevölkerung die Entwicklung qualitativ hochwertiger Arzneimittel und Medizinprodukte, sowohl patentierter Erzeugnisse als auch von Generika, zu fördern und den Zugang zu ihnen zu erleichtern.“
Hinsichtlich der mit dem Annex 2-D zu Arzneimitteln und Medizinprodukten verfolgten speziellen Zielsetzungen heißt es in den in Art. 1 niedergelegten „Allgemeinen Bestimmungen“ des Anhangs, dass die Vertragsparteien ihre grundsätzliche Einigkeit über die Bedeutung folgender Ziele bekräftigen:





























