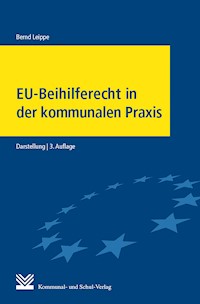
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kommunal- und Schul-Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Für die Kommunen ist die Befassung mit dem oftmals ungeliebten Beihilferecht heute eine zwingende Notwendigkeit. Die Abhandlung "EU-Beilhilferecht in der kommunalen Praxis" gibt den Kommunen einen Überblick über die Grundzüge des Beihilferechts. Die vorliegende 3. Auflage berücksichtigt neben einer allgemeinen Aktualisierung die umfangreichen Bekanntmachungen der Kommission zum Begriff der Beihilfe und zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen. Erläutert werden verschiedene direkte Zahlungen der Kommunen an ihre Beteiligungsunternehmen unter beihilferechtlichen Aspekten. Ferner wird auf einzelne typische kommunale Tätigkeitsbereiche wie Krankenhäuser, Wirtschaftsförderung, ÖPNV, Kulturförderung u.a. näher eingegangen. Zudem werden praktische Lösungsansätze zum Aufspüren von Beihilfetatbeständen aufgezeigt. Die bei der Ausgestaltung von sog. Betrauungsakten sich ergebenden steuerlichen Aspekte und Risiken werden beschrieben und steuerrechtliche Lösungen für die Praxis vorgestellt. Die Kommune selbst wie auch deren Unternehmen und Einrichtungen können von zwei Seiten mit dem Beihilferecht in Berührung kommen: sowohl als Geber als auch Empfänger von Beihilfen. In beiden Fällen ist die Gefahr ungewollter Rechtsverletzungen hoch. So haben künftig auch die Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Risiken aus beihilferelevanten Sachverhalten aufzudecken, sodass entsprechende Rückstellungen belastend in die Passivseite der Bilanz eingehen. Soweit Geschäftsführer derartige Risiken übersehen, liegt eine Verletzung der ihnen obliegenden Sorgfaltspflicht vor, die am Ende sogar zu einer Haftung führen kann. Die Darstellung versteht sich als eine Handreichung für den kommunalen Praktiker und gibt den Kommunen ein
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EU-Beihilferechtin der kommunalenPraxis
Darstellung
von
Bernd Leippe
Dipl.-Finw., Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor a. D.,Essen
3. Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© Copyright 2014 Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG · Wiesbaden
3. Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
Satz: C.H.Beck.Media.Solutions · Nördlingen
ISBN 978-3-8293-1337-7eISBN 978-3-8293-1400-8
Inhaltsübersicht
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1.Einführung in das Beihilferecht
1.1Die Situation in den Kommunen
1.2Überblick über die Rechtsvorschriften
1.3Weiterführende Arbeitshilfen für die Praxis
1.4Überblick über das Beihilfeverfahrensrecht
1.4.1Verfahrensablauf
1.4.2Vorläufiges Prüfverfahren
1.4.3Förmliches Prüfverfahren
2.Beihilfetatbestände nach Art. 107 AEUV
2.1Merkmale des Beihilfebegriffs
2.1.1Begünstigung
2.1.2Unternehmen
2.1.2.1Allgemeine Grundsätze
2.1.2.2Ausübung hoheitlicher Befugnisse
2.1.2.3Stellungnahme der Kommission zu einzenen Tätigkeitsbereichen
2.1.3Staatliche Mittel
2.1.4Selektive Förderung
2.1.4.1Allgemeine Grundsätze
2.1.4.2Materielle Selektivität
2.1.4.3Regionale Selektivität
2.1.5Eignung zur Verfälschung des Wettbewerbs
2.1.6Beeinträchtigung des Handelns zwischen den Mitgliedstaaten
2.2Die Wismar-Entscheidungen
3.Freistellungsentschedung/Freistellungsbeschluss und weitere Freistellungsmöglichkeiten
3.1Grundsätzliches
3.2Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)
3.3Altmark Trans-Entscheidung
3.4Monti-Paket
3.5Almunia-Paket
3.5.1Freistellungsbeschluss/DAWI-Beschluss
3.5.2Trennungsrechnung
3.6De-minimis-Beihilfen
3.6.1De-minimis-VO/Allgemein
3.6.2De-minimis-VO/DAWI
3.7Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)
3.7.1Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes
3.7.2Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen
3.7.3Investitionsbeihilfen für lokale Infrastrukturen
3.7.4Häfen und Flughäfen
3.7.5Vereinfachungen
3.8Vergleichende Übersichten und Schaubilder
3.9IDW-Prüfungsstandard PS 700
4.Beihilferelevanz in der kommunalen Praxis
4.1Krankenhausfinanzierung
4.2Wirtschaftsförderung
4.3Kulturförderung
4.4Öffentlicher Personennahverkehr
4.5Kommunalbürgschaften
4.5.1Bürgschaftsmitteilung 2008
4.5.2De-minimis-VO/Allgemein
4.5.3De-minimis-VO/DAWI
4.5.4Freistellungsbeschluss
4.5.5Zusammenfassende Übersicht
4.6Verlustausgleichszahlungen
4.7Cash-Pool-Systeme
4.8Flughäfen
4.9Förderung der Infrastruktur
4.10Tierkörperbeseitigung
4.11Sonstige Tätigkeitsbereiche
4.11.1Förderung lokaler Dienstleistungen
4.11.2Soziale Sicherheit
4.11.3Bildung und Forschungstätigkeit
5.Identifizierung von Beihilfen in der Praxis
6.Lösungsansätze für einen Betrauungsakt
7.Beihilferecht unter steuerlichen Aspekten
7.1Ertragsteuerliche Aspekte
7.2Umsatzsteuerliche Aspekte
7.3Lösungsansätze
8.Betrauungsmodelle
8.1Betrauungsakt als Zuwendungsbescheid
8.2Betrauungsakt durch Gemeinderatsbeschluss und gesellschaftsrechtliche Weisung
8.3Betrauungsmodell des Landkreistages Baden-Württemberg
8.4Betrauungsregelung der Landeshauptstadt München
9.Fazit
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Die öffentliche Hand und ihre Unternehmen müssen sich verstärkt mit dem Europäischen Beihilferecht befassen, da die Finanzierung ihres Leistungsspektrums nicht von den allgemeinen Wettbewerbsregeln ausgeschlossen ist. Ohne Zuschüsse und Ausgleichszahlungen kann insbesondere die defizitäre Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand dauerhaft nicht vorgehalten werden. In der Praxis spielt daher das Beihilferecht eine zunehmende Rolle, was eine Befassung mit den Veränderungen der beihilferechtlichen Rahmenbedingungen, Rechtsprechung und Kommissionsentscheidungen sowie den steuerlichen Aspekten erforderlich macht.
Vor diesem Hintergrund erkennt die kommunale Landschaft nach und nach die Bedeutung des Europäischen Beihilferechts. Inzwischen beschäftigen sich nicht wenige Kommunen damit, in ihrem Bereich die Erfordernisse des Beihilferechts europakonform umzusetzen. Um was geht es beim Europäischen Beihilferecht? Das Europäische Beihilferecht verbietet generell die Gewährung von Beihilfen aus öffentlichen Haushalten zur Begünstigung einzelner Unternehmen, um Wettbewerbsverzerrungen am Markt zu verhindern. Dabei ist der Beihilfebegriff so umfassend definiert, dass jedwede Begünstigung davon erfasst wird.
Mit diesem Beitrag soll den Kommunen ein Überblick über die Grundzüge des Beihilferechts gegeben werden. Dabei werden verschiedene direkte Zahlungen der Kommunen an ihre Beteiligungsunternehmen unter beihilferechtlichen Aspekten gewürdigt. Ferner wird auf einzelne typische kommunale Tätigkeitsbereiche wie Krankenhäuser, Wirtschaftsförderung, ÖPNV, Kulturförderung u. a. näher eingegangen. Zudem werden praktische Lösungsansätze zum Aufspüren von Beihilfetatbeständen aufgezeigt. Die bei der Ausgestaltung von sog. Betrauungsakten sich ergebenden steuerlichen Aspekte und Risiken werden beschrieben. Denn es ist äußerst komplex, einerseits die beihilferechtlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen und andererseits ungewollte Steuerbelastungen zu vermeiden. Hierzu bedarf es einer sorgfältig durchdachten steuerlichen Gestaltung. Mit dieser Abhandlung werden steuerlich unverfängliche Lösungen für die Praxis vorgestellt.
Es ist unerlässlich, dass sich die Bedeutung und die Grundsätze des Europäischen Beihilferechts in das Bewusstsein der Verantwortlichen im kommunalen Bereich einprägen. Denn die Kommune selbst wie auch deren Unternehmen und Einrichtungen können von zwei Seiten mit dem Beihilferecht in Berührung kommen: sowohl als Geber als auch Empfänger von Beihilfen. In beiden Fällen ist die Gefahr ungewollter Rechtsverletzungen hoch. So haben künftig auch die Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Risiken aus beihilferelevanten Sachverhalten aufzudecken, so dass entsprechende Rückstellungen belastend in die Passivseite der Bilanz eingehen. Soweit Geschäftsführer derartige Risiken übersehen, liegt eine Verletzung der ihnen obliegenden Sorgfaltspflicht vor, die am Ende sogar zu einer Haftung führen kann.
In diesem Sinne versteht sich der vorliegende Beitrag als eine Handreichung für den kommunalen Praktiker. Möge er dazu beitragen, die Scheu vor dem komplexen Beihilferecht abzulegen, um vor Ort beihilfekonforme Lösungen zu erarbeiten.
Nach nur 15 Monaten seit Veröffentlichung der 2. Aufl. im April 2016 wurde erneut eine Neuauflage erforderlich. Hier zeigt sich das inzwischen gewachsene Interesse der öffentlichen Hand an Praxishilfen zum Beihilferecht. Die vorliegende 3. Aufl. berücksichtigt neben einer allgemeinen Aktualisierung die umfangreichen Bekanntmachungen der Kommission zum Begriff der Beihilfe und zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen.
Essen, im August 2017
Der Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Benne Kommunaler Betrauungsakt für öffentliche Dienstleistungen, ZKF 2016 S. 270
Blumenberg/Haisch Die unionsrechtliche Beihilfeproblematik der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG, Finanzrundschau 2012 S. 12
Bode Steuerliche Begünstigungen als staatliche Beihilfe i. S. d. Art. 107 AEUV – Folgerungen für die Praxis der Fachgerichte, Finanzrundschau 2011 S. 1034
Bulla Der Defizitausgleich bei Krankenhäusern der öffentlichen Hand bleibt beihilfekonform – Zu den Voraussetzungen und Grenzen der Krankenhausversorgung als DAWI, KommJur 2015 S. 245
Burgi Die Handlungsformkategorie des Betrauungsakts im EU-Beihilferecht, EuZW 2017 S. 90
Busson/Kirchof/Müller-Kabisch Beihilfenrechtskonforme Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge, KommJur 2014 S. 88
Cordewener EU-Beihilfeverbot und nationale Unternehmensbesteuerung, FR 2016 S. 756
Detig Die Anwendung der EU-Bürgschaftsmitteilung 2008 auf kommunaler Ebene – EU-beihilfekonforme Ausgestaltung der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur, KommP spezial 1/2012 S. 30
Deuster/Seidenspinner Reform des Monti-Kroes-Pakets – Neue Regeln für die Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, IR Energie, Verkehr, Abfall, Wasser 2012 S. 52
Dobler Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband, Geschäftsbericht 2007, EU-Beihilfe und kommunale Wirtschaftsförderung – erläutert an Fällen aus der kommunalen Praxis –
Dornhauser Beihilfekontrolle in kommunalen Beteiligungsunternehmen – Die Bedeutung des IDW-Prüfungsstandards 700, KommP spezial 1/2012 S. 19
Duschner Risikoanalyse Beihilfenrecht, GemH 2013 S. 226
Duschner/Lang-Hefferle/Scharpf Das Modell der Landeshauptstadt München für die Umsetzung der Freistellungsentscheidung der EU-Kommission für Beihilfen, Bayerische Verwaltungsblätter 2010 S. 364
Duschner/Lang-Hefferle Beihilfekonforme Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften – Entspricht das Münchner Betrauungsmodell auch den Anforderungen des neuen Beihilfepakets der EU-Kommission („Almunia-Paket“)?, GemH 2012 S. 63
Eckerle Steuerliche Aspekte des IDW PS 700 vom 7. September 2011 – Hinweise auf steuerliche Fallstricke bei Umsetzung der beihilferechtlichen Vorgaben, KommP spezial 1/2012 S. 23
Fischer DAS ALMUNIA-PAKET Keine Neuerungen für den Dritten Sektor beim EU-Beihilfenrecht, Stiftung&Sponsoring 2013 S. 32
Frenz Grundstücksverkäufe der öffentlichen Hand, DÖV 2016 S. 819
Gehler Reform des EU-Beihilferechts: Überarbeitetes „Altmark“-Paket verabschiedet – Kommission schlägt unter anderem neue spezifische De-minimis-Verordnung für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vor, KommP spezial 1/2012 S. 26
Gyulai-Schmidt Das neue DAWI-Paket im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Gewährleistung sozialer Dienste, KommP spezial, 2/2014 S. 62
Haberkamm Tagungsbericht Speyerer Europarechtstage – Aktuelle Fragen des europäischen Beihilferechts, KommJur 2010 S. 452
Halsdorfer Beihilfen im Kulturbereich – Pragmatische Lösungen in Sicht? Ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungen aus Brüssel, KommP spezial 1/2012 S. 35
Haubner Die Auswirkungen des Almunia-Pakets auf Public Private Partnerships, EuZW 2013 S. 816
Heinbuch/Käppel Das Verhältnis des Beihilfenrechts zum Vergaberecht nach dem „Almunia-Paket“ – Der Versuch einer Abgrenzung, KommP spezial 1/2012 S. 12
Heise Krankenhausfinanzierung und Beihilferecht – das Krankenhauswesen zwischen Gemeinwohlverpflichtung und Wettbewerb, EuZW 19/2015 S. 739
Herrmann Wann sind Beihilfen auf lokaler Ebene (nicht) geeignet, den zwischenstaatlichen Handel zu beeinträchtigen? KommJur 2016 S. 201
Hey EU-Beihilfen und Steuervergünstigungen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede, StuW 2015 S. 331
Hirsbrunner/Litzenberger Ein bisschen Almunia im Monti-Kroes-Paket? – Die Reform der beihilferechtlichen Vorschriften betreffend Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, EuZW 2011 S. 742
Hochreiter Die beihilferechtlichen Hürden der öffentlichen Finanzierung von Infrastruktur, EWS 2015 S. 301
Holtmann Staatliche Beihilfen: EuG bestätigt Beihilfenqualität der Sanierungsklausel, EWS 2016 S. 61
Holtmann Die unterschiedliche Wertigkeit (kommunaler) Infrastrukturen in der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung für staatliche Beihilfen, EuZW 2016, 927
Hölzlwimme Die neue De-minimis-Verordnung der EU-Kommission, Ein weiterer Beitrag zur Modernisierung des EU-Beihilferechts, KommP spezial, 2/2014
Jaeger Fehlstellungen im Verhältnis von Steuer- und Beihilferecht: Ein Plädoyer für mehr Ausgewogenheit, EuZW 2012 S. 92
Jennert EU-Beihilferecht für Kommunen und kommunale Unternehmen, KommP spezial 1/2012 S. 2
Jennert/Ellenrieder Unternehmensbesteuerung im Lichte des EU-Beihilferechts, EWS 2011 S. 205
Jennert/Manz Kommunalbürgschaften und EU-Beihilferecht, ZKF 2009 S. 217
Jung Aktuelle Entwicklungen im Beihilfenrecht – Die 6. Jahresfachkonferenz der Europäischen Akademie für Steuern, Wirtschaft & Recht: „EU-Beihilfenrecht in deutscher Praxis“, IR Energie, Verkehr, Abfall, Wasser 2011 S. 332
Käppel/Scheider/Tschirmer EU-Beihilfenrecht und kommunaler Haushalt, EWS 2015 S. 310
Karpenstein/Corcilius Staatliche Beihilfe kraft Rechtsform – Gewährt die Gewährträgerhaftung stets einen wirtschaftlichen Vorteil? EuZW 2016 S. 654
Kaufmann/Bertels Staatliche Finanzierung von Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft im Kreuzfeuer des EU-Beihilferechts, WPg 2015 S. 824
Kronawitter Leitfaden zur Anwendung der EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den Binnenmarkt auf Leistungen der Daseinsvorsorge, ZKF 2011 S. 145, 175
Leippe Umsatzsteuerrisiken aus EU-Beihilfen, ZKF 2011 S. 217
Leippe EU-Beihilfen in der kommunalen Praxis (Rechtsrahmen-Risiken-Lösungsansätze), dStG 03–2013
Leippe EU-Beihilferecht auf dem neuesten Stand, dStG 06–2014
Leippe EU-Beihilferecht – Update 2015, dStG 08–2015
Leippe Beihilfereport 2016 – Modernisierung des Beihilferechts und Förderung von Infrastruktur, dStG 07–2016
Leippe Aktuelle Übersicht zum kommunalen Beihilferecht, ZKF 2016 S. 55
Linke Die staatliche Finanzierung öffentlicher Personenverkehrsdienste, EuZW 2014 S. 766
Löding-Hasenkamp Trennungsrechnung bei selbständigen Forschungsinstituten – Aktuelle Praxishinweise, ZStV 2016 S. 145
Lotze/Smolinski Bedeutung des beihilferechtlichen Durchführungsverbots bei Verträgen der öffentlichen Hand, ZKF 2014 S. 62
Musil Europäisches Beihilferecht und nationales Steuerrecht, FR 2014 S. 953
Pauly/Jedlitschka Die Reform der EU-Beihilferegeln für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und ihre Auswirkungen auf die kommunale Praxis, DVBl 20/2012 S. 1269
Przybilla Tagungsbericht 3. Speyerer Europarechtstage: Aktuelle Fragen des Europäischen Beihilferechts (26. – 27.9.2011), KommJur 3/2012 S. 92
Quardt/Wolters Die „implizite staatliche Bürgschaft“ – zur fehlenden Insolvenzfähigkeit von Eigenbetrieben im Lichte des Beihilfenrechts, KommJur 2016 S. 327
Risch Europäisches Beihilferecht und neues kommunales Haushaltsrecht, DVBl 2014 S. 219
Risch Europäisches Beihilferecht, Komm-Jur 1/2015 S. 10
Risch Steuerrecht und Europäisches Beihilferecht – Die Wahl zwischen Skylla und Charybdis? BWGZ 2015 S. 443
Schiffers Hochschulbesteuerung: Steuerliche Implikationen der Trennungsrechnung nach EU-Beihilferecht, DStZ 2015 S. 271
Schmidt Staatliche Cash-Pool-Systeme als Problem des Beihilfenrechts, Die Öffentliche Verwaltung 2013 S. 928
Schroeder EU-Beihilfenverbot und Staatlichkeit der Mittel, EuZW 6/2015 S. 207
Schuhmacher Die zunehmende Bedeutung der Rechtsdurchsetzung durch Wettbewerber im Bereich des EU-Beihilfenrechts – Erhöhte Risiken für Kommunen und kommunale Unternehmen, KommJur 5/2012 S. 179
Soltész Die Rechtsprechung der Unionsgerichte zum Beihilferecht im Jahre 2011, EuZW 2012 S. 179
Soltész Die Rechtsprechung der Unionsgerichte zum Beihilferecht im Jahre 2012, EuZW 2013 S. 134
Soltész Die Entwicklung des europäischen Beihilferechts im Jahre 2013, EuZW 3/2014 S. 89
Soltész Die Entwicklung des europäischen Beihilferechts im Jahre 2014, EuZW 4/2015 S. 127
Soltész Die Entwicklung des europäischen Beihilferechts in 2015, EuZW 3/2016 S. 87
Soltész Die Entwicklung des europäischen Beihilferechts in 2016, EuZW 2017 S. 51
Soltész/Wagner Wann werden „Altbeihilfen“ zu „Neubeihilfen“? – Anmeldepflichtige Umgestaltung bestehender Beihilfen und Verlust des Bestandsschutzes, EuZW 2013 S. 856
Sonder Europäisches Beihilfenrecht in der kommunalen Praxis – eine Einführung anhand von fünf Fällen, KommJur 2013 S. 121
Stöbener de Mora Überall Beihilfen? – Die Kommissionsbekanntmachung zum Beihilfebegriff, EuZW 2016 S. 685
Tepfer Steuerliche Aspekte von Betrauungen, KommP spezial, 2/2014 S. 76
Tölle/Jennert/Hillesheim/Hauptmann Zum Umgang mit beihilferechtlichen Risiken bei öffentlichen Unternehmen, Die Wirtschaftsprüfung, 22/2012 S. 1187
Uhlenhut Gemeindliche Finanzierung von Infrastrukturen und das Beihilfenverbot, GemH 2015 S. 64
de Weerth Neues zur „Selektivität“ im EU-Beihilferecht, Der Betrieb 2017 S. 275
Wienbracke EU-Beihilfenrechtliche Restriktionen der kommunalen Wirtschaftsförderung, dgh 2016 S. 199
Wittig Das Beihilferecht wird erwachsen – Höhere Aufgriffsrisiken im Beihilferecht durch neue Rechtsprechung und Vorschriften – auch im Verkehrsbereich, KommP spezial 1/2012 S. 43
1. Einführung in das Beihilferecht
1.1 Die Situation in den Kommunen
Innerhalb der Kommunen findet zwischen der Kernverwaltung und ihren oftmals zahlreichen Beteiligungsunternehmen/Eigengesellschaften allgemein ein intensiver Leistungs- und Zahlungsverkehr statt. Das gilt insbesondere für den sog. steuerlichen Querverbund, innerhalb dessen Stadtwerke-Gewinne mit Verkehrs-Verlusten verrechnet werden, so dass die Stadtwerke-Gewinne letztlich unversteuert bleiben. In der kommunalen Landschaft finden sich aber auch weitere „Konzerne“ mit entsprechenden Leistungs- und Zahlungsbeziehungen. Ganz allgemein kann festgestellt werden, dass die Zahlung von Verlustausgleichen aus dem Kernhaushalt an dauerdefizitäre Unternehmen eine unzulässige Beihilfe darstellt. Zu solchen Zahlungsempfängern zählen z. B. Krankenhäuser, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen in Trägerschaft einer gemeindlichen Eigengesellschaft.
Es ist nach wie vor so, dass den Kommunen etliche unwirtschaftliche Tätigkeitsbereiche überlassen bleiben, die dauerhaft nicht profitabel betrieben werden können. Wenn dem nicht so wäre, hätten sich längst Privatunternehmen für den Betrieb interessiert. Zumeist handelt es sich um Tätigkeitsbereiche, an denen die Bürger ein besonderes Interesse haben, weil sie in ihrer Gemeinde derartige Angebote im Kultur-, Sport- oder Freizeitsektor erwarten. Zudem handelt es sich oftmals auch um Einrichtungen der sog. Daseinsvorsorge, also um Einrichtungen, die die Grundbedürfnisse der Einwohner einer Gemeinde decken sollen, wie z. B. der Öffentliche Personennahverkehr. Die Kommune ist in vielen Fällen gehalten, die unvermeidbar erwirtschafteten Defizite auszugleichen. Und hier greift nun das Beihilferecht. Derartige Ausgleichszahlungen stellen nach dem Beihilferecht Subventionen dar, die als unverdienter Vorteil geeignet sind, den Wettbewerb am Markt zu verfälschen. Das ist dann die im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung sich ergebende Beihilfeproblematik.
Anders ist der Bereich der nichtwirtschaftlichen Betätigung zu sehen. Hierzu zählt die klassische Hoheitsverwaltung, wie z. B. das Schulwesen, die Ordnungsverwaltung, die Einrichtungen der Sozialhilfe usw. Bei diesem Tätigkeitsbereich handelt es sich nicht um ein Unternehmen mit der Folge, dass auch kein Wettbewerb besteht. Damit gibt es auch keinen Beihilfebezug, so dass die Problematik des Europäischen Beihilferechts ausgeblendet werden kann.
1.2 Überblick über die Rechtsvorschriften
Das Europäische Beihilferecht postuliert in Art. 107 Abs. 1 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV), Inkrafttreten am 1.12.2009, ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008 S. 47) ein grundsätzliches Beihilfeverbot:
„Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
Nach Art. 108 Abs. 2 und 3 AEUV kann aber die Kommission Beihilfen nach ihrer Notifizierung, d. h. Anmeldung, genehmigen. Das Beihilfeverbot gilt ferner nicht, wenn eine Vorschrift die Gewährung einer Beihilfe ausdrücklich erlaubt (Erlaubnisvorbehalt).
Das in der kommunalen Praxis sich auftuende Problem besteht nun darin, dass auf der einen Seite nach Europarecht ein eindeutiges Beihilfeverbot besteht, auf der anderen Seite sich für die Kommunen aber die Notwendigkeit ergibt, defizitäre kommunale Tätigkeiten insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge finanziell zu bezuschussen.
Die für Ausgleichszahlungen einschlägigen gesetzlichen Regelungen des Beihilferechts befanden sich zunächst in den Art. 86 bis 89 EGV (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft – EG-Vertrag; kurz: EGV oder EG) vom 25.3.1957, konsolidierte Fassung, ABl. EG Nr. C 325 vom 24.12.2002 S. 33). Im Rahmen der Lissaboner Verträge wurden sie dann inhaltlich unverändert in die Art. 106 bis 109 AEUV übernommen.
Der EuGH hat zur Frage der Anwendung dieser Rechtsvorschriften mit seinem Urt. vom 24.7.2003 in der Rechtssache „Altmark Trans“ (– Rs C-280/00 –, NJW 2003 S. 2515) eine erste Klärung herbeigeführt. Gegenstand der Rechtssache war folgender Sachverhalt: Der Landkreis Stendal erteilte der Altmark Trans GmbH Genehmigungen zur Beförderung mit Omnibussen und gewährte Zuschüsse, die die Kosten der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen decken sollten. Ein mit ihr im Wettbewerb stehendes Unternehmen (die NVGA) erhob Klage bei den deutschen Gerichten und trug vor, dass die Altmark Trans Zuschüsse erhalte, die mit den Gemeinschaftsvorschriften für staatliche Beihilfen unvereinbar seien. Daraufhin hat das BVerwG den EuGH gebeten, sich zur Rechtsnatur dieser Zuschüsse zu äußern. Der EuGH konkretisierte in seiner Entscheidung die Voraussetzungen, bei deren Erfüllung derlei Mittelzuwendungen bereits tatbestandlich nicht unter das grundsätzliche Beihilfeverbot des Art. 87 Abs. 1 EG fallen und damit auch keiner Anmeldung bei der EU-Kommission bedürfen:
– Das begünstigte Unternehmen ist durch einen verbindlichen Rechtsakt (z. B. Gesetz, Konzession, Verwaltungsakt oder Vertrag) mit der Erbringung gemeinwohlorientierter Leistungen betraut und diese Leistungen sind im Einzelnen klar definiert.
– Die Parameter, anhand derer die durch die Zuwendung auszugleichenden Kosten der Leistungserbringung berechnet werden, wurden vor der Betrauung nach transparenten und objektiven Kriterien festgelegt.
– Die Ausgleichszahlungen sind auf die Kosten für die Erfüllung der Daseinsvorsorge-Verpflichtungen einschließlich eines angemessenen Gewinns beschränkt.
– Das Unternehmen, welches die Leistungen erbringt, wurde entweder im Wege einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt oder die Ausgleichszahlungen werden auf der Kostenbasis eines durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens berechnet, welches angemessen mit Personal und Sachmitteln ausgestattet ist (Benchmark).
Allerdings sind die Ausführungen des Urteils nicht dazu bestimmt und geeignet, den Kommunen präzise Orientierungshilfen für eine beihilfekonforme Ausgestaltung der Mittelzuwendungen zu ermöglichen. Insbesondere das 4. Kriterium (Benchmark) ist in der Praxis nur schwer zu erfüllen.
Vor diesem Hintergrund erließ die EU-Kommission im November 2005 ein Maßnahmepaket, das sog. „Monti-Paket“ (Entscheidung vom 28.11.2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden, ABl. EU L 312/67 vom 29.11.2005), das einen Rechtsrahmen für die Gewährung von finanziellen Zuwendungen der Kommunen für Leistungen der Daseinsvorsorge aufzeigt. Das Monti-Paket besteht aus drei Dokumenten:
– Freistellungsentscheidung: Danach sind Ausgleichszahlungen der Kommunen für Leistungen der Daseinsvorsorge, obwohl es sich begrifflich um Beihilfen handelt, unter bestimmten Voraussetzungen von der Notifizierungspflicht nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV befreit.
– Gemeinschaftsrahmen: Er beinhaltet einen die Kommission in ihrer Verwaltungspraxis selbst bindenden Rechtsrahmen und beantwortet die Frage, wie die Kommission im Falle der Notifizierung voraussichtlich entscheiden würde.
– Transparenzrichtlinie: Sie beinhaltet die Pflicht zur getrennten Buchführung für alle Unternehmen mit Ausgleichszahlungen, die Daseinsvorsorgetätigkeiten und andere Tätigkeiten im Wettbewerb zu privaten Marktteilnehmern ausüben.
Vereinfacht gesagt übernimmt das Monti-Paket die Altmark-Trans-Kriterien ohne das Benchmark-Merkmal.
Im Jahr 2011 kündigte die EU-Kommission ein neues Paket zu Beihilfevorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) an und legte zunächst einen Entwurf vor. Als endgültiges Ergebnis eines reformierten Monti-Pakets wurde dann am 20.12.2011 das sog. „Almunia-Paket“ (Beschl. vom 20.12.2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind, K (2011) 9380 vom 20.12.2011) veröffentlicht, das am 31.1.2012 in Kraft trat. Das Almunia-Paket beinhaltet:
– Freistellungsbeschluss K (2011) 9380/DAWI-Beschluss: Er ersetzt die bisherige Freistellungsentscheidung und beschreibt die Voraussetzungen für die Befreiung von DAWI-Beihilfen, die als mit dem Binnenmarkt vereinbar eingestuft werden können und folglich von der Notifizierungspflicht befreit sind.
– EU-Rahmen K (2011) 9406/DAWI-Rahmen: Er tritt an die Stelle des Gemeinschaftsrahmens und enthält die Regeln für die Prüfung von Ausgleichsleistungen für DAWI, die staatliche Beihilfen darstellen und nicht nach dem DAWI-Beschluss von der Anmeldepflicht befreit sind. Diese Beihilfen müssen bei der Kommission angemeldet werden und können für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, wenn sie die im DAWI-Rahmen festgelegten Voraussetzungen erfüllen.
– Mitteilung K (2011) 9404/DAWI-Mitteilung: Hier finden sich Erläuterungen für DAWI relevante beihilferechtliche Schlüsselbegriffe wie staatliche Beihilfe, Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und wirtschaftliche Tätigkeit sowie der Zusammenhang zwischen den Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen und den Beihilfevorschriften.
Der wichtigste Unterschied zwischen DAWI-Beschluss und DAWI-Rahmen besteht darin, dass Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, die von dem DAWI-Beschluss erfasst werden, nicht bei der Kommission angemeldet werden müssen. Sind die im DAWI-Beschluss genannten Voraussetzungen erfüllt, kann der betreffende Mitgliedstaat den Ausgleich unverzüglich gewähren. Ist dies nicht der Fall, fällt die Ausgleichsleistung in den Anwendungsbereich des DAWI-Rahmens. Das bedeutet, dass die Maßnahme vorher bei der Kommission angemeldet werden muss, damit diese prüfen kann, ob die staatliche Beihilfe mit dem AEUV vereinbar ist. Da es sich bei Maßnahmen, die unter den DAWI-Rahmen fallen, meist um größere Maßnahmen handelt, die potenziell in der Lage wären, den Wettbewerb stärker zu verfälschen, gelten im Allgemeinen strengere Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt als nach dem DAWI-Beschluss.
Die unterschiedlichen Regelungsinhalte der vorstehenden Rechtsgrundlagen ergeben sich aus der nachfolgenden vergleichenden Übersicht:
Altmark-Trans
Monti-/Almunia-Paket
Gemeinschafts-/DAWI-Rahmen
Beihilfeeigenschaft
Keine Beihilfe
Beihilfe +
Beihilfe +
Notifizierung
Keine Notifizierung
Keine Notifizierung
Notifizierung +
Genehmigung
Keine Genehmigung
Generelle Freistellung
Individuelle Genehmigung
Ausgleichszahlungen
Keine Schwellenwerte
„Kleine“ DAWIS < 30/15 Mio. EUR
„Große“ DAWIS > 30/15 Mio. EUR
Weitere maßgebliche Rechtsgrundlagen sind:
– Die am 25.4.2012 veröffentlichte De-minimis-Verordnung Nr. 360/2012/DAWI-De-minimis VO sieht eine Freistellung für sog. Bagatellbeihilfen im DAWI-Bereich vor. Danach unterliegen Ausgleichsleistungen für DAWI, die über einen Zeitraum von drei Steuerjahren insgesamt 500 000 EUR nicht übersteigen, nicht der beihilferechtlichen Kontrolle.
– Im Zuge der Modernisierung des EU-Beihilferechts hat die Kommission die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, sog. De-minimis-Verordnung/Allgemein, ABl. EU vom 24.12.2013 – L 352/1 – erlassen. Die De-minimis-Verordnung/Allgemein ist am 1.1.2014 in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.2020. Sie ersetzt die alte Verordnung (EG) 1998/2006 der Kommission vom 15.12.2006 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis-Beihilfen“, die Ende 2013 ausgelaufen ist.
– Am 17.6.2014 hat die Kommission die VO Nr. 651/2014 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) veröffentlicht, die weitere Freistellungsmöglichkeiten im Bereich der öffentlichen Hand eröffnet.
– Als Ergebnis einer längeren Konsultation hat die Kommission am 19.5.2016 die Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. 1 AEUV vorgelegt. Die deutsche Fassung wurde am 19.7.2016 veröffentlicht (ABl. EU C 262 vom 19.7.2016).
1.3 Weiterführende Arbeitshilfen für die Praxis
Hilfreich für das Verständnis und die Anwendung des Beihilferechts sind insbesondere folgende Dokumente/Handreichungen zur Erläuterung des beihilferechtlichen Rechtsrahmens:
– Die Handreichung der Innenministerkonferenz der Länder und kommunalen Spitzenverbände vom März 2006 beinhaltet einen Überblick zur Umsetzung insbesondere der Freistellungsentscheidung.
– Der Leitfaden „EG-Beihilfenrechtskonforme Finanzierung von kommunalen Leistungen der Daseinsvorsorge“ des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie NRW vom Mai 2008 führt umfangreich in die Problematik und Anwendung der Beihilfevorschriften ein und hat sich als eine praxisnahe Arbeitshilfe bewährt. (Anmerkung: aktualisiert durch das vom Land Hessen herausgegebene Handbuch – siehe unten.)
– Im Leitfaden zur Anwendung der Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse inklusive Sozialdienstleistungen vom 7.12.2010, herausgegeben von der EU-Kommission, finden sich Antworten der Kommission auf einschlägige Fragen zum Beihilferecht.
– Ebenso werden im Leitfaden zur Anwendung der Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse inklusive Sozialdienstleistungen der EU-Kommission vom 29.4.2013 zahlreiche Fragen zur Anwendung des Beihilferechts von der EU-Kommission beantwortet.
– Die CEEP hat eine informative Ausarbeitung „Aquis+Glossar – Der gemeinschaftliche Besitzstand für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)“ veröffentlicht (siehe Internetseite www.ceep.eu).
– Von besonderem Interesse für den Praktiker ist der von Büsching/Homann/Wiese herausgegebene Praxisleitfaden „Das Europäische Beihilfenrecht“. (https://www.berlin.de/…/europaeische…beihilfen/praxisleitfaden_beihilfe). Die 85 Seiten umfassende Ausarbeitung zeichnet sich durch eine gute Übersichtlichkeit und einen hohen Praxisbezug aus.
– Mit einem überschaubaren Umfang von 41 Seiten und praxisnahen Ausführungen hat der VKU eine „Anwendungshilfe Beihilferecht“, Stand: Februar 2015, herausgegeben. Die vorliegende Anwendungshilfe soll nach der Zielsetzung des VKU dazu dienen, die mit dem Beihilferecht verbundenen Risiken weiter zu sensibilisieren und den Rechtrahmen zu erläutern.
Die Anwendungshilfe schließt mit einer Fallsammlung aus dem kommunalen Tätigkeitsbereich und enthält für den Praktiker weiterführende Links zum Beihilferecht.
– Das Land Hessen hat im Juli 2015 in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Städtetag, dem Hessischen Landkreistag, dem Hessischen Städte- und Gemeindebund und der KPMG





























