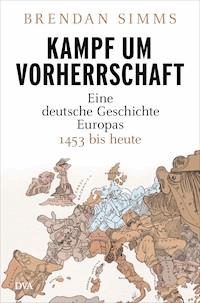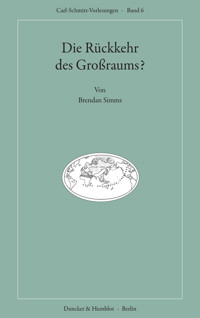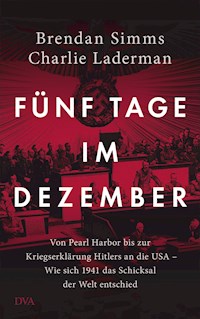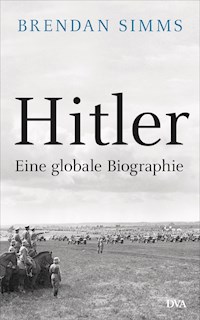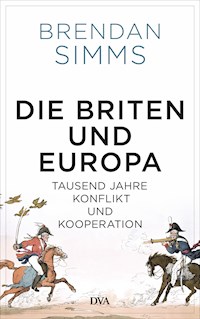9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten.“ Winston Churchill, 1946 Der bekannte irische Historiker Brendan Simms und der Publizist Benjamin Zeeb bieten nicht nur eine brillante Diagnose der gegenwärtigen europäischen Krise, sondern auch eine so vernünftige wie radikale Therapie: die zügige Verwirklichung einer demokratischen Union nach anglo-amerikanischem Modell, die die gesamte Eurozone umfasst und eine gemeinsame finanz- und Verteidigungspolitik beinhaltet. Wir brauchen dringend die Vereinigten Staaten von Europa, ansonsten ist Europa auf dem besten Wege sich abzuschaffen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Brendan SimmsBenjamin Zeeb
EuropaamAbgrund
Plädoyer für dieVereinigten Staatenvon Europa
Aus dem Englischenvon Hans Freundl
C.H.Beck
Zum Buch
«Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten.»
Winston Churchill, 1946
Der bekannte irische Historiker Brendan Simms und der Publizist Benjamin Zeeb bieten nicht nur eine brillante Diagnose der gegenwärtigen europäischen Krise, sondern auch eine so vernünftige wie radikale Therapie: die zügige Verwirklichung einer demokratischen Union nach anglo-amerikanischem Modell, die die gesamte Eurozone umfasst und eine gemeinsame Finanz- und Verteidigungspolitik beinhaltet. Wir brauchen dringend die Vereinigten Staaten von Europa, ansonsten ist Europa auf dem besten Wege sich abzuschaffen.
Über die Autoren
Brendan Simms ist Historiker und Professor für die Geschichte Internationaler Beziehungen an der Fakultät für Politik und Internationale Studien der Universität Cambridge. Bei C.H.Beck ist von ihm lieferbar: Der längste Nachmittag. 400 Deutsche, Napoleon und die Entscheidung von Waterloo (22015).
Benjamin Zeeb ist Historiker sowie Mitbegründer und Geschäftsführer des Project for Democratic Union, eines europaweit operierenden Thinktanks, der eine vollständige demokratische Union der Eurozone anstrebt.
Inhalt
1. Europa am Abgrund
2. Die deutsche Frage
3. Das europäische Problem
4. Die anglo-amerikanische Lösung
5. Union jetzt!
Anmerkungen
«Hätte nicht die große Nation jenseits des Atlantischen Ozeans schließlich begriffen, dass der Untergang oder die Versklavung Europas auch ebenso ihr eigenes Schicksal bestimmen würde, und hätte sie nicht ihre Hand zu Beistand und Führung ausgestreckt, so wäre das finstere Mittelalter mit seiner Grausamkeit und seinem Elend zurückgekehrt.
Meine Herren, es kann noch immer zurückkehren.
Und doch gibt es all die Zeit hindurch ein Mittel …
Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. …
Damit das zustande kommen kann, braucht es einen Akt des Vertrauens, an dem Millionen von Familien verschiedener Sprachen bewusst teilnehmen müssen. …
Wenn Europa vor endlosem Elend und schließlich vor seinem Untergang bewahrt werden soll, dann muss es in der europäischen Völkerfamilie diesen Akt des Vertrauens und diesen Akt des Vergessens gegenüber den Verbrechen und Wahnsinnstaten der Vergangenheit geben.
Wenn das Gefüge der Vereinigten Staaten von Europa gut und richtig gebaut wird, so wird die materielle Stärke eines einzelnen Staates weniger wichtig sein. Kleine Nationen werden genauso viel zählen wie große, und sie werden sich ihren Rang durch ihren Beitrag für die gemeinsame Sache sichern.
Aber ich muss Sie warnen. Vielleicht bleibt wenig Zeit. …
Wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa oder welchen Namen sie haben werden, bilden wollen, müssen wir jetzt anfangen.»
Winston Churchill in einer Rede in Zürich, 19. September 1946.
1. Europa am Abgrund
Heute steht Europa vor mehreren miteinander verbundenen Herausforderungen, die jeweils für sich wie auch in ihrem Zusammenwirken unseren Kontinent in die Knie zwingen. Wir erleben das unangefochtene Wiederaufleben eines autoritären Russlands, eine Finanz- und Wirtschaftskrise, die Rückkehr des «deutschen Problems» in Form der Durchsetzung einer EU-weiten Austeritätspolitik, das Entstehen sezessionistischer Bewegungen in Schottland, Katalonien und anderen Regionen, eine europäische Flüchtlingskrise beispiellosen Ausmaßes, die durch Kriege und Unterdrückung im Nahen Osten verursacht wird, die Zunahme europaskeptischer Stimmungen in allen Teilen der Union, von Großbritannien, Deutschland und Frankreich bis zu Ungarn und Griechenland, die Unsicherheit, die durch das bevorstehende britische Referendum über den Verbleib in der EU entsteht, und die ernstzunehmende Möglichkeit eines Sieges von Marine Le Pen bei der nächsten französischen Präsidentschaftswahl. Unser kleines Buch soll aufzeigen, dass diese Fragen nicht nur alle miteinander verbunden sind, sondern in ihrer Gesamtheit ein großes Problem darstellen, das eine große Lösung erfordert.
Es gibt natürlich viele Auseinandersetzungen mit diesen Fragen aus jüngster Zeit.1
Unsere Absicht besteht nicht darin, die zahlreichen Debatten über die europäische Krise oder über Großbritanniens Rolle in Europa wieder aufzuwärmen – wenngleich wir einige häufig behandelte Themen werden aufgreifen müssen –, vielmehr möchten wir ihre wechselseitige Verflochtenheit erklären und sie in ihren historischen Kontext stellen.2 Da die Eurozone strategisch wie ökonomisch ins Straucheln gerät und das Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa an einen wichtigen Scheidepunkt gelangt, muss die gegenwärtige Krise im Rahmen der mehr als drei Jahrhunderte währenden gemeinsamen Geschichte betrachtet werden. Unsere These lautet, kurz zusammengefasst, dass wir aufhören müssen, Großbritannien als das Problem und Europa als die Antwort zu betrachten, sondern vielmehr anfangen müssen, Europa als die Frage und das britische Modell, in richtig verstandener Weise, als die Lösung zu erkennen.
Der globale wirtschaftliche Abschwung und die nachfolgende europäische Staatsschuldenkrise haben den europäischen Kontinent und insbesondere die an der «Peripherie» liegenden europäischen Länder hart getroffen. Wie in den unglücklichen Familien in den Dramen von Leo Tolstoi unterscheiden sich die Ursachen der Misere in den einzelnen Ländern der Union, seien sie struktureller oder verhaltensbezogener Art; jedes Land wird auf jeweils eigene Weise in Mitleidenschaft gezogen. In Irland und Spanien hat ein Jahrzehnt des billigen Geldes, das durch die Einführung des Euro und die daraus resultierenden niedrigen Zinsen eingeläutet wurde, zu einer Spekulationsblase geführt, die schließlich geplatzt ist. In Griechenland hat die Regierung die EU über die finanziellen Verhältnisse des Landes getäuscht, um die Aufnahme in den Kreis der Euroländer zu erlangen. Die darauf folgende Erhöhung der Staatsausgaben, die durch einen Rückgang der Zinsen aufgrund der Währungsunion ermöglicht und gefördert wurde, führte zur Anhäufung eines Schuldenberges, der einen teilweisen Zahlungsausfall nach sich zog, jedoch noch immer viel zu hoch ist, als dass er von Griechenland jemals abgetragen werden könnte.3
Ungeachtet ihrer unmittelbaren Ursachen reichen die Wurzeln dieser Probleme zurück bis zur Konstruktion des Euro und sind in den anderen Ländern der sogenannten europäischen Peripherie weitgehend ähnlich. Eine Ansteckungsgefahr war immer gegeben und verbunden mit der Aussicht, dass ein Staatsbankrott in einem der «Peripherieländer» zu Bankenzusammenbrüchen in «Kernländern» wie Frankreich oder Italien führen könnte, deren Finanzsektoren am stärksten exponiert waren. Eine Weile hatte es den Anschein, als würden die Krisen immer häufiger auftreten und sich zunehmend verschärfen unter einem sich steigernden Trommelwirbel von Troikas, Bailouts und anderen Rettungspaketen für Irland, Griechenland, Portugal und Zypern. Schließlich verkündete der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, am 12. Juli 2012, dass er «alles tun werde, was nötig» sei, um den Euro zu stabilisieren, was im Ergebnis bedeutete, dass er Geld drucken würde.
Seitdem hat sich die unmittelbare Bedrohung von einer rein ökonomischen zu einer politischen gewandelt. Europa hat zwar formell die Rezession überwunden, doch die Krise ist noch lange nicht vorbei. Das Wirtschaftswachstum bleibt verhalten, und die Arbeitslosigkeit ist in vielen Teilen der Eurozone hoch. Trotz der erklärten Bereitschaft der EZB zu einer massiven geldpolitischen Lockerung sträubt sich die Inflation hartnäckig, auf den angestrebten Zielwert von zwei Prozent zu steigen. Die öffentliche Unzufriedenheit zeigt sich auf den Straßen von Athen und Madrid, wo gewöhnliche Bürger, die sich von ihren politischen und wirtschaftlichen Eliten nicht mehr angemessen repräsentiert fühlen, ihren Unmut äußern.
Wenn wir vielleicht auch nicht viel gelernt haben aus den jüngsten Verhandlungsrunden zwischen der Eurogruppe und Griechenland, so ist zumindest eines klar: Für beide Seiten ist der Status quo unhaltbar geworden. Dennoch wurde die Fiktion aufrechterhalten, dass sich Griechenland formell weiterhin an die Sparpolitik hält. Das ist natürlich eine Abmachung, die keine Chance auf Dauerhaftigkeit besitzt. Bald werden wir abermals den Atem anhalten, wenn das Spiel wieder von neuem beginnt. Die lähmende Ungewissheit, die uns seit einem halben Jahrzehnt begleitet, die uns geistig zermürbt, ausländische Unternehmen abschreckt und unsere Gegner im Osten ermutigt, wird sich daher verstärken.
Der Großteil des europäischen Kontinents befindet sich also weiterhin im Griff eines Austeritätsprogramms, auf dem die deutsche Regierung und deren schwindende Zahl von Verbündeten beharrt und das als einziger Weg zur Rettung des Euro dargestellt wird. Man kann über die wirtschaftliche Vernünftigkeit und die moralische Vertretbarkeit dieses Ansatzes streiten, vor dem Großbritannien und die Vereinigten Staaten zurückschrecken. Sie verfolgen stattdessen eine Politik der fiskalischen Stimulierung und haben schon viel früher eine wesentlich expansivere geldpolitische Lockerung betrieben und durch ihre Zentralbanken Geld gedruckt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nicht bestritten werden können jedoch die politischen Auswirkungen dieser Politik, insbesondere die Rezession oder die wirtschaftliche Depression in der südlichen und der westlichen Flanke der Union, die mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit verbunden ist.
Nicht zufällig verändert sich in diesem Zusammenhang auch das politische Klima. Auf der einen Seite hat sich in Europa in den letzten Jahren ein beunruhigender Aufstieg rechter Bewegungen vollzogen. Auf der anderen Seite haben neue linke Gruppierungen wie Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien die Parteienlandschaft durch ihr Versprechen erschüttert, den Menschen ihre wirtschaftliche Souveränität wieder zurückzugeben. Angesichts einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von mehr als 10 Prozent in der Eurozone und mehr als 20 Prozent in Griechenland und Spanien findet diese Botschaft durchaus Anklang bei einer desillusionierten Wählerschaft, die das Vertrauen in das europäische Versprechen von Prosperität und wirtschaftlicher Sicherheit verloren hat.
Während sich die erste Phase der europäischen Staatsschuldenkrise hauptsächlich um die Frage drehte, ob der Kern der Eurozone bereit und willens wäre, die Peripherie zu retten, werden wir es in den folgenden Jahren mit einer Weiterentwicklung des Problems zu tun bekommen. Die Hauptfrage wird lauten, ob die Peripherie weiterhin die Bedingungen zu akzeptieren bereit sein wird, die von Deutschland und den Institutionen, die vormals unter dem Namen «Troika» bekannt waren, vorgegeben werden. Die erste griechische Wahl im Jahr 2015 und die nachfolgende Niederlage von Tsipras und Varoufakis in den Umschuldungsverhandlungen, die ihnen vom deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble zugefügt wurde, dürften wahrscheinlich nur die erste Runde einer Reihe von noch bevorstehenden ähnlichen Auseinandersetzungen gewesen sein. Wenn die Wähler eine Lockerung der strengen Sparpolitik fordern, könnte ein freiwilliges Ausscheiden aus der Eurozone und eine Rückkehr zu nationalen Währungen zunehmend zu einem attraktiven Weg für Regierungen werden, die ihre Wahlversprechen einzuhalten versuchen, ohne sich dabei durch das Regelwerk der Eurozone einschränken lassen zu wollen.
Die Zukunft der Eurozone und darüber hinaus, wie Angela Merkel zu Recht mehrmals erklärt hat, die Zukunft Europas insgesamt lagen in den vergangenen Jahren in den Händen einer relativ kleinen Elite von politischen Entscheidungsträgern. Sofern es kein Wirtschaftswunder gibt, wird diese Zukunft bald in den Händen einer relativ kleinen Zahl (im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung der Eurozone) von südeuropäischen Wählern liegen. Sie scheinen zunehmend bereit zu sein, den Zusammenbruch eines Systems in Kauf zu nehmen, das sie nicht länger als hilfreich für die Verwirklichung ihrer Bestrebungen ansehen, wenngleich die Griechen bislang vor dem entscheidenden Schritt zurückgeschreckt sind. Wir können nicht sicher sein, dass sie, oder auch andere Wählerschaften, dies abermals tun werden, wenn sie sich zu stark unter Druck gesetzt fühlen.
Solange Europa seine Probleme nicht löst, wird es immer irgendeine nächste Wahl geben, bei der ein ganzer Kontinent den Atem anhält. Die Kräfte der Desintegration brauchen nur ein einziges Mal die Oberhand zu gewinnen, während wir jedes Mal Glück haben und hoffen müssen, dass Europa an allen Kreuzungen und Scheidewegen, auf die es trifft, stets den richtigen Weg nimmt.
Selbst in EU-«Kernländern» bilden sich populistische Bewegungen, wie der Aufstieg der eurokritischen AfD und nachfolgend der Pegida in Deutschland, der zahlreichen Randparteien in Italien und insbesondere des Front National in Frankreich unter Marine Le Pen belegt. Ähnlich wie die Bourbonen-Monarchie in der vorrevolutionären Zeit ist Frankreich heute ein wesentlich schwächeres Mitglied des europäischen Systems und ist sich dieser Tatsache auch schmerzhaft bewusst. Frankreich beklagt nicht nur seine wirtschaftliche Erstarrung, die zunehmenden Probleme mit nichtintegrierten Einwanderern und die Bedrohung durch den islamistischen Terror (die auf eindringliche Weise durch den abscheulichen Anschlag auf die Redaktion der Zeitschrift «Charlie Hebdo» und jüngst durch die Attacken auf ein Theater und diverse Cafés in Paris zum Ausdruck kam), sondern auch den Zerfall des traditionellen französisch-deutschen Kartells in Europa und dessen Ersetzung durch ein Arrangement, das sich in Richtung eines Monopols für Berlin entwickelt. Irgendwann wird das französische Volk gegen Europa aufbegehren und sich offen für die ablehnenden Kräfte der Rechten oder der Linken entscheiden. Ein Szenario, wonach Marine Le Pen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl 2017 die meisten Stimmen erhält, erscheint heute als eine realistische Möglichkeit. Selbst in Angela Merkels eigener Partei, der CDU, in der die Kanzlerin jüngst einen beträchtlichen Teil ihres politischen Kapitals verspielt hat durch ihre Entscheidung für die Aufnahme einer beispiellos hohen Zahl von Flüchtlingen in Deutschland, werden die Spannungen zweifellos zunehmen, wenn offenkundig werden wird, dass der Status quo nicht mehr haltbar ist und weitere Kapitalspritzen für den kränkelnden Süden Europas bereitgestellt werden müssen. Das bedeutet, dass neben dem häufig diskutierten Szenario eines Ausscheidens von Griechenland oder Portugal auch eine «zentrale Sezession», bei der eines der beiden «Kernländer» aus der Union ausscheidet, nun möglich wird.
All dies unterstreicht das «Demokratie-Defizit» im Herzen der Union. Die Europäer beklagen seit langem das Fehlen einer direkten Verbindung zwischen der Wählerschaft des europäischen Kontinents und dessen Regierungs- und Verwaltungsorganen. Nun, da Brüssel und Berlin einigen europäischen Ländern eine Sparpolitik verordnen und anderen die Kosten von Rettungsmaßnahmen aufbürden, fühlen sich die Deutschen über den Tisch gezogen, während die Griechen, die Spanier und die Iren das Gefühl bekommen, dass sie entrechtet werden. Diese Stimmung reicht tiefer als die gegenwärtige Eurokrise, doch die Problematik der Gemeinschaftswährung hat sie noch weiter verstärkt. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung wird die Frage gestellt, wer die Europäische Union eigentlich beherrscht.
In den ersten 15 Jahren nach der Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages war die Antwort auf diese Frage relativ einfach. Die Nationalstaaten blieben innerhalb eines weitgespannten zwischenstaatlichen Rahmens die primären Träger der politischen Autorität auf dem Kontinent. Ausgestattet mit einem demokratischen Mandat, das sich bis zu den geographischen Grenzen eines jeden Landes erstreckte, konnten sich die Staaten zu marktüblichen Zinsen Geld leihen und dieses Geld dann unter der Aufsicht ihrer nationalen Parlamente ausgeben. Wenn die Bevölkerung mit der Handlungsweise ihrer Regierung unzufrieden war (etwa mit der Steuerpolitik, der Verschuldung oder der Verwendung der Haushaltsmittel), konnte sie ihr dieses Mandat bei der nächsten Wahl entziehen.
Zu den schwerwiegendsten Folgen der gegenwärtigen europäischen Krise gehört es, dass diese Mechanismen nicht mehr greifen. In vielen Ländern der Eurozone gibt es heute faktisch keine Demokratie mehr. Die traditionellen Haushaltsrechte, die grundlegenden Rechte jedes Parlaments, sind aufgehoben worden. In Spanien, Irland, Italien, Portugal, Zypern und Griechenland können die Parlamente nicht mehr unabhängig über die finanziellen Mittel des Staates entscheiden und sind daher auch nicht mehr in der Lage, den Willen ihrer jeweiligen Wählerschaft angemessen zu repräsentieren.
Die Hinweise darauf, dass Austerität eine schlechte Wirtschaftspolitik ist, haben sich in den vergangenen Jahren gemehrt.4 Das soll nicht heißen, dass nicht in vielen Ländern Europas ein dringender Reformbedarf bestünde. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Ziele, an denen Reformen ansetzen könnten, beispielsweise der spanische und der italienische Arbeitsmarkt, der griechische Staatssektor oder das französische Sozialversicherungssystem. Auch eine kohärente Strategie für den Umgang mit dem enormen deutschen Leistungsbilanzüberschuss sollte auf dieser Liste ganz oben stehen. Doch die Vorstellung, dass starke Kürzungen der Staatsausgaben schnell das Vertrauen der Investoren wiederherstellen werden, hat sich als großer Irrtum herausgestellt und sollte nicht länger verteidigt werden. Wie sich gezeigt hat, fördert eine Politik der Ausgabenkürzungen die wirtschaftliche Kontraktion und erweist sich als kontraproduktiv, weil sie verheerende Auswirkungen auf die Beschäftigung hat – vor allem in Form steigender Jugendarbeitslosigkeit – und die Solvenz der Staatskassen auf dem Kontinent beeinträchtigt.