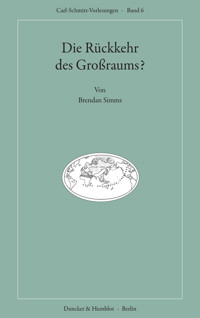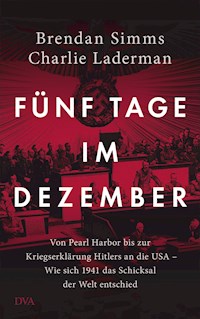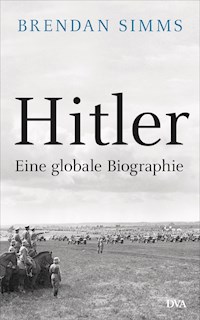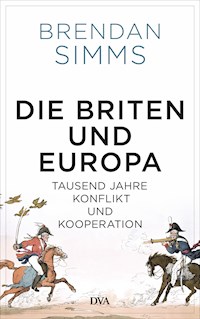5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
500 Jahre Machtkämpfe um die Mitte Europas
In einem großen, umfassenden Wurf erzählt Brendan Simms die Geschichte Europas seit dem 15. Jahrhundert. Er beschreibt sie als Geschichte ständig wechselnder Machtverhältnisse und Rivalitäten, des Kampfs der großen und kleinen europäischen Länder um Einfluss sowie der Begehrlichkeiten entfernterer Mächte wie des Osmanischen Reiches oder der USA – vor allem aber schildert er sie als Geschichte der Auseinandersetzung um die Mitte des Kontinents, vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bis zum wiedervereinigten Deutschland. Brendan Simms’ großartige Darstellung wird von vielen bereits mit Spannung erwartet und lädt gerade in diesen Tagen zu kontroversen Diskussionen ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1401
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
BRENDAN SIMMS
KAMPF UM VORHERRSCHAFT
Eine deutsche Geschichte Europas 1453 bis heute
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Deutsche Verlags-Anstalt
Für Constance
»Falsche Waage ist dem Herrn ein Gräuel,volles Gewicht findet sein Gefallen.«
Sprüche Salomonis, 11:1
»Du musst herrschen und gewinnen,Oder dienen und verlieren,Leiden oder triumphieren,Amboss oder Hammer sein.«
Johann Wolfgang von Goethe, »Kophtisches Lied«
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort
EinführungEuropa um 1450
1REICHE
2SUKZESSIONEN
3REVOLUTIONEN
4EMANZIPATIONEN
5VEREINIGUNGEN
6UTOPIEN
7TEILUNGEN
8DEMOKRATIEN
SCHLUSSBETRACHTUNG
DANK
BIBLIOGRAPHIE
Sach- und Personenregister
Vorwort zur deutschen Ausgabe
»Wie Deutschland in der Welt steht, was in der Welt geschieht, wie die anderen sich zu Deutschland verhalten, das ist für Deutschland um so wesentlicher, als seine ungeschützte geographische Lage in der Mitte es den Auswirkungen von der Welt her mehr aussetzt als andere europäische Länder.«
Karl Jaspers1
»Was an Deutschland nicht stimmt, ist, dass es zu viel davon gibt. Es gibt zu viele Deutsche, und Deutschland ist zu stark, zu sehr mit industriellen Ressourcen ausgestattet.«
A. J. P. Taylor2
Das vorliegende Buch ist keine Geschichte Deutschlands, sondern eine deutsche Geschichte Europas. Im Mittelpunkt stehen das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das die heutige Bundesrepublik, die Niederlande, große Teile Belgiens, Österreich, die Schweiz, Böhmen und Mähren sowie einen großen Teil Norditaliens umfasste, der ihm folgende Deutsche Bund sowie die Staaten, die wiederum diesem nachfolgten, das zweite deutsche Kaiserreich, das »Dritte Reich« und die Bundesrepublik Deutschland sowie, in einem weiteren Sinn, die Europäische Union.
In der Zeitspanne seit 1450 lag die zentrale Rolle der deutschen Frage zumeist gewissermaßen in der Natur der Sache. Deutschland befindet sich in der geographischen Mitte des Kontinents und wurde mehr als jedes andere Territorium von Heeren durchquert, die manchmal für Dinge kämpften, die mit ihm selbst nur am Rande zu tun hatten. Die Franzosen wollten verhindern, dass die Habsburger den Einkreisungsring schlossen, den sie in Flandern, Burgund und Spanien um Frankreich gelegt hatten. England betrachtete Deutschland als Stütze seiner Position in den Niederlanden, deren Besitz es Frankreich oder Spanien erlauben würde, auf kürzestem Weg zur englischen Südküste zu gelangen. Spanien benutzte das Heilige Römische Reich als Ausfallstor, um sowohl Frankreich als auch die rebellischen Holländer anzugreifen. Schweden strebte nach einer Pufferzone in Norddeutschland, um sich vor Angriffen über die Ostsee zu schützen. Und das Osmanische Reich versuchte, mit einem letzten verheerenden Angriff auf Deutschland die westliche Christenheit niederzuringen, bis es im späten 17. Jahrhundert vor den Mauern Wiens zurückgeschlagen wurde.
Für Europa beunruhigend war darüber hinaus das enorme demographische, wirtschaftliche und militärische Gewicht Deutschlands. Mit Ausnahme des entlegenen Zarenreichs war es stets der größte und bevölkerungsreichste europäische Staat. Seine Städte und Manufakturen bildeten schon lange vor der Industrialisierung den Kern der europäischen Wirtschaft, und der Rhein war die Hauptverkehrsader des Kontinents. Zudem war Deutschland für die Qualität seiner Soldaten bekannt, von denen viele als Söldner im Ausland dienten. Daher waren die europäischen Mächte darauf bedacht, diese Ressourcen entweder sich selbst zu sichern oder aber wenigstens ihren Rivalen vorzuenthalten. Es wurde zu einem Axiom der europäischen Politik, dass Deutschland, wie ein schwedischer Diplomat es in der Mitte des 16. Jahrhunderts ausdrückte, »ein gemäßigter und bevölkerungsreicher Teil der Welt mit einem kriegerischen Volk« sei und »dass kein Land unter der Sonne besser dafür geeignet [sei], eine Universalmonarchie und absolute Vorherrschaft in Europa zu errichten«.3 Schließlich war das Heilige Römische Reich die Quelle der ultimativen politischen Legitimität in Europa. Das Kaisertum hatte Vorrang vor allen anderen Monarchien und besaß zumindest theoretisch das Recht, die Ressourcen Deutschlands und sogar des ganzen Kontinents für gemeinsame Ziele einzusetzen. 1519 beispielsweise konkurrierten bei der Kaiserwahl die drei mächtigsten Fürsten um die Krone: Franz I. von Frankreich, Heinrich VIII. von England und Karl (V.) von Burgund, der sich durchsetzte. Das Streben nach der Kaiserkrone war bis zu den Napoleonischen Kriegen, als Napoleon ernsthaft erwog, sich zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs zu krönen, ein wesentlicher Antriebsfaktor der europäischen Politik. Selbst die osmanischen Herrscher waren, seitdem sie durch die Eroberung von Konstantinopel ihren Anspruch angemeldet hatten, von dem Verlangen besessen, die Kaiserwürde zu erlangen. All dies machte das Heilige Römische Reich zum Kampfplatz Europas.
Gleichzeitig war Deutschland Schauplatz heftiger innenpolitischer Auseinandersetzungen. Im Innern stand der Kaiser den großen Fürsten gegenüber, die ihrerseits untereinander zerstritten waren. Das deutsche Parlament, der Reichstag, in dem die weltlichen und geistlichen Fürsten und die Reichsstädte vertreten waren, war schon lange kein wirkungsvolles Forum für das Gemeinwohl mehr. So stießen 1453 nach dem Fall von Konstantinopel verzweifelte Bitten von Ungarn und Kroaten um Hilfe im Kampf gegen die vorrückenden Türken auf taube Ohren. Trotz aller Reformversuche durch Kaiser, Beamte und Intellektuelle blieb Deutschland ein fragmentierter politischer Raum. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts teilte die Reformation die westliche Christenheit in Katholiken einerseits und Lutheraner und Reformierte andererseits und spaltete das Heilige Römische Reich in zwei Teile. Und die Militärverfassung des Reiches, die dazu gedacht war, den Frieden in Deutschland aufrechtzuerhalten und Angreifer abzuschrecken, vermochte weder das eine noch das andere zu gewährleisten.
Aus all diesen Gründen waren die großen europäischen Friedensverträge hauptsächlich deutsche Regelungen. Im Kern des Westfälischen Friedens von 1648, von dem die gesamte moderne internationale Ordnung ihren Namen erhielt, stand die Befriedung Mitteleuropas. Dies war insofern irreführend, als die Verträge von Münster und Osnabrück, um einen weiteren Bürgerkrieg zu verhindern, der die Außenwelt zum Eingreifen veranlassen und sich zu einem europäischen Flächenbrand auswachsen könnte, keineswegs den Fürsten die Unverletzlichkeit ihrer Staaten garantierten, sondern vielmehr ihre Möglichkeiten einschränkten, willkürliche Maßnahmen gegen die eigenen Untertanen zu ergreifen. Die Beilegung von Streitigkeiten wurde hauptsächlich den Reichsgerichten überlassen. Religiöse Probleme sollten eher durch Kompromisse als durch Mehrheitsentscheidungen gelöst werden. Darüber hinaus erlangten im Westfälischen Frieden zwei Staaten, Schweden und Frankreich, die förmliche Anerkennung als Garantiemächte des Heiligen Römischen Reichs und damit der Territorialordnung Mitteleuropas. Im späten 18. Jahrhundert erhielt auch Russland dieses Privileg. Dieser Zusammenhang zwischen innerer Befriedung und europäischem Gleichgewicht kam auch in der Wiener Schlussakte von 1815 zum Ausdruck, mit der die Periode der Revolutions- und der Napoleonischen Kriege beendet wurde. Durch sie wurde ein Deutscher Bund mit gemeinsamen politischen, juristischen und militärischen Institutionen geschaffen, von dem man hoffte, er werde stark genug sein, um den inneren Frieden aufrechtzuerhalten und äußere Aggressoren abzuschrecken, aber zu schwach, um selbst nach der Hegemonie streben zu können.
Auch anderswo in Europa prägte der Kampf um Deutschland die Innenpolitik. In England beispielsweise wurde die Herrschaft der Stuarts nachhaltig delegitimiert, weil sie es versäumten, die Protestanten in Deutschland zu unterstützen, was schließlich zu dem Bürgerkrieg führte, der Karl I. den Kopf kostete. Trotz heftiger Bruderkonflikte in der Heimat kämpften bis zu hunderttausend Briten im Dreißigjährigen Krieg; jüngste Ausgrabungen haben gezeigt, dass ihre Knochen über ganz Mitteleuropa verstreut sind. Im 18. Jahrhundert gab es in Großbritannien kein Thema, das mehr Regierungen an die Macht oder zu Fall gebracht hätte als der Zustand des Heiligen Römischen Reichs. Tatsächlich war vor 1760, wenn Briten vom »Empire« sprachen, stets Deutschland gemeint, und nicht das eigene Kolonialreich. In Frankreich bereitete die erbärmliche Unfähigkeit der Bourbonen, die französischen Interessen im Heiligen Römischen Reich und in Osteuropa zu verteidigen, der Revolution den Boden, die ihre Monarchie stürzen sollte.
Über vierhundert Jahre lang war Deutschland in erster Linie ein Objekt der europäischen Politik. Im Dreißigjährigen Krieg wurde es durch die Bürgerkriegserfahrung traumatisiert und dadurch gedemütigt, dass fremde Heere – spanische, dänische, schwedische, französische, um nur die wichtigsten zu nennen – nach Belieben durch sein Territorium ziehen konnten. Die Bevölkerung des Heiligen Römischen Reichs schrumpfte von 21 auf etwas mehr als 13 Millionen Menschen – ein weit größerer Verlust, als ihn irgendein Konflikt vorher oder nachher verursacht hat. Die Lage mitten in Europa hatte sich für Deutschland beinahe als Todesurteil herausgestellt. Danach blieb es, wie der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz beklagte, »der Ball, den einander zugeworfen, die um die Monarchie gespielt, Deutschland ist der Kampfplatz, darauf man um die Meisterschaft von Europa gefochten«. In den Revolutions- und Napoleonischen Kriegen war Deutschland erneut das Hauptopfer; es war umkämpft, wurde geteilt und von beiden Seiten als Rekrutenreservoir für ihre Heere genutzt. Der Friedensvertrag von 1815 setzte einen Schlusspunkt unter die Kämpfe, änderte aber nichts daran, dass Deutschland dem Diktat des europäischen Gleichgewichts unterworfen war.
Die beiden Lösungen der deutschen Frage, das Heilige Römische Reich ebenso wie der Deutsche Bund, hatten vieles für sich. Das Heilige Römische Reich war in seinen vielen guten Augenblicken ein vergleichsweise angenehmer Ort, um dort zu leben. Es zog rechtliche Konfliktlösungen militärischen vor, und es war ein Vorreiter auf dem Gebiet der friedlichen religiösen und politischen Koexistenz, die heutige »Konkordanzmodelle« der Machtteilung in gespaltenen Gesellschaften, wie etwa in Nordirland, vorwegnahm. Seine Einwohner – und nachfolgende Generationen überall auf der Welt – profitierten von der einzigartigen kulturellen Vielfalt des Reiches und des Deutschen Bundes. Besonders deutlich kam dies in der Vorherrschaft der deutschen Musik bis mindestens in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck.
Letztlich scheiterten beide Modelle. Die Deutschen fuhren fort, gegeneinander zu kämpfen, wofür insbesondere der berüchtigte »Dualismus« zwischen Österreich und Preußen stand.4 In den Kämpfen mit dem Osmanischen Reich und dem französischen Expansionsstreben blieb Deutschland erheblich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Vor allem aber vermochte weder das Heilige Römische Reich noch der Deutsche Bund ausländische Angreifer abzuschrecken. Das Alte Reich brach 1806 unter dem napoleonischen Ansturm zusammen, und sein Nachfolger konnte Frankreich während der Revolution von 1830 und in der Rheinkrise von 1840 nur mit Mühe eindämmen, von der späteren Herausforderung durch Napoleon III. ganz zu schweigen. Kurz, beide Lösungen sorgten dafür, dass Deutschland und seine Einwohner keine Subjekte im europäischen System wurden, sondern Objekte blieben.
Den meisten Deutschen war dieser Zustand ein Gräuel, und viele versuchten, ihn zu überwinden. Voller Unmut verfolgten sie, wie sich Reichsgebiete entfremdeten und insbesondere Frankreich zuwandten; Elsass-Lothringen war nur das offensichtlichste Beispiel dafür, aber keineswegs das einzige. Sie verurteilten den internationalen »Handel« mit deutschen Söldnern, und dass viele arme Landsleute ihr Heil in der Auswanderung sahen, erfüllte sie mit Verzweiflung.5 Jahrhundertelang versuchten Reformer, dem Heiligen Römischen Reich und dann dem Deutschen Bund eine Verfassungs- und Militärstruktur zu geben, die es den Deutschen erlaubt hätte, ohne auswärtige Vorherrschaft zu leben. Doch alle diese Versuche scheiterten, angefangen mit den Bemühungen des kaiserlichen Generalissimus Lazarus von Schwendi im 16. Jahrhundert über diejenigen Samuel von Pufendorfs im 17. und Friedrich Carl von Mosers im 18. Jahrhundert bis zu denjenigen der liberalen Nationalisten am Anfang und in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Deutsche Fürsten versuchten mangels aller anderen Formen von Sicherheit, ihre Angreifbarkeit in der Mitte Europas durch inneren Zusammenhalt wettzumachen und so auszugleichen, was ihnen an Territorium, Reichtum und Bevölkerung fehlte. Sie nutzten das »Primat der Außenpolitik«, wie es später genannt wurde, um die Entmachtung der traditionellen repräsentativen Versammlungen und die Einführung der Autokratie zu rechtfertigen.
Erst als der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck den deutschen Nationalismus für seine Zwecke vereinnahmte, liberale Kräfte ins Boot holte und Österreich ausschloss, gelangte Deutschland endlich zu der inneren Einheit, die potentielle Angreifer abzuschrecken vermochte; jedenfalls hoffte man dies. Doch stattdessen hob der neue mitteleuropäische Staat sowohl aus strukturellen Gründen als auch durch sein Verhalten die Weltordnung aus den Angeln und wurde schließlich zweimal von einer Koalition von Weltmächten in die Schranken gewiesen. Das vereinigte Deutschland von 1871 war, wie Henry Kissinger bemerkte, »zu groß für Europa und zu klein für die Welt«. Es war größer als Frankreich (ohne seine Kolonien), Österreich-Ungarn und Großbritannien (ohne das Empire). Nur das riesige Zarenreich hatte mehr Untertanen. Darüber hinaus verzeichnete es im Gegensatz zu seinem stagnierenden Rivalen Frankreich ein rasches Bevölkerungswachstum, verbunden mit einer rasant voranschreitenden Industrialisierung.
Das Deutsche Reich sah sich jedoch von zwei Seiten bedroht: im Osten durch Russland und im Westen durch Frankreich. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde diese Furcht durch eine maritime Rivalität mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten verschärft. Zudem blieb Deutschland territorial unverändert, während Großbritannien, Frankreich, Russland und die Vereinigten Staaten expandierten. Hinzu kam, dass Millionen Deutsche auf der Suche nach einem besseren Leben in die britischen Siedlerkolonien, vor allem aber in die Vereinigten Staaten auswanderten, was dem Deutschen Reich nicht nur Kräfte entzog, sondern auch das demographische Reservoir seiner potentiellen Gegner auffüllte.
Für diese Herausforderungen gab es viele Lösungswege, und Deutschland probierte ohne nachhaltigen Erfolg die meisten von ihnen aus. Bismarck versuchte durch raffinierte Diplomatie, die strategische Quadratur des Kreises zu finden und Frankreich zu isolieren, indem er dafür sorgte, dass Deutschland stets »einer von zweien in einer Welt von dreien« oder »einer von dreien in einer Welt von fünfen« war. Dies ging eine Zeitlang gut, aber die Anstrengung, den beiden Hauptverbündeten Russland und Österreich-Ungarn entgegengesetzte Versprechungen zu machen, um keinen von beiden zu verlieren, wäre auf Dauer selbst dann nicht durchzuhalten gewesen, wenn Wilhelm II. sich nicht so eindeutig für Wien entschieden und dadurch Paris und St. Petersburg mit Front gegen Deutschland zusammengeführt hätte. Bismarcks Nachfolger Caprivi versuchte, die deutsche Stellung in der Welt durch wirtschaftliche Produktivität abzusichern: »[E]ntweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Menschen«, so sein Credo. Diese Strategie war jedoch durch Zollschranken angreifbar, nicht zuletzt auch deshalb, weil Deutschland seinerseits mit Rücksicht auf die ostelbischen Junker vielerlei Beschränkungen eingeführt hatte. Die dritte Option, die Mobilisierung der Nation durch sozialen Fortschritt und die Ausweitung des Wahlrechts, Forderungen, für die vor allem der liberale Soziologe Max Weber bekannt ist, wurde nie richtig umgesetzt. Die vierte Lösung, die territoriale Expansion, um mit derjenigen der Rivalen Schritt zu halten, scheiterte am spektakulärsten. Sie bewirkte lediglich als Gegengewicht geschlossene Bündnisse wie die Tripel Entente von Großbritannien, Frankreich und Russland des Ersten und die Große Allianz des Zweiten Weltkriegs sowie die dauerhafte Feindschaft der Vereinigten Staaten, die sich aus Sorge über ein deutsches Vordringen nach Lateinamerika, insbesondere nach Mexiko, gegen Berlin wandten. Die weitreichenden territorialen Ambitionen des deutschen Kaiserreichs in West- und Osteuropa während des Ersten Weltkriegs und Hitlers rassenideologisch aufgeladenes Streben nach »Lebensraum« in den 1930er und 1940er Jahren endeten in Katastrophen und im letzteren Fall in einem beispiellosen Völkermord an den europäischen Juden. Deutschlands Versuche, sich die Ressourcen Europas einzuverleiben, schlugen vor allem deshalb fehl, weil es sein immenses Potential durch Zwang nicht in vollem Umfang zu mobilisieren vermochte.
Während dieser Periode stand das deutsche Problem stets im Mittelpunkt der europäischen Innenpolitik. In Frankreich lag den meisten inneren Krisen – von der Boulangerkrise in den 1880er Jahren über die Dreyfusaffäre bis zu den erbitterten Auseinandersetzungen der 1930er Jahre – die Frage zugrunde, wie die Gesellschaft gegen Deutschland organisiert werden sollte. In Russland nahm die panslawistische Bewegung seit dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts die deutsche »Vorherrschaft« ins Visier, und im Ersten Weltkrieg war die Entschlossenheit, Berlin einzudämmen, in Russland derart groß, dass das militärische Versagen und der allgemeine Eindruck, dass die herrschende Dynastie insgeheim deutschfreundlich eingestellt sei, im Februar 1917 zu einer russischen Revolution führten. Nach der zweiten, der bolschewistischen Oktoberrevolution, stand für die neue Regierung die Frage im Vordergrund, wie sie einen kommunistischen Aufstand in Deutschland entfachen konnte und was sie tun sollte, falls er nicht ausbrechen sollte. Erst durch den Sieg von Stalins Slogan vom »Kommunismus in einem Land« über Trotzkis Konzept der »Weltrevolution« rückte dieses Thema in den Hintergrund. In Großbritannien trat die Furcht vor deutschen Ambitionen erstmals in der »Dreadnought«-Debatte im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zutage, und in den 1930er Jahren war, wie in Frankreich, die »Beschwichtigung« Hitlers das vorherrschende Thema.
Daher dürfte es nicht überraschen, dass beide Nachkriegsregelungen in erster Linie der Beilegung der deutschen Frage galten, also des Problems, wie Deutschland stark genug erhalten werden konnte, um Aggressoren abzuschrecken, ohne dass es erneut mächtig genug wurde, um noch einmal das kontinentale Gleichgewicht umzustürzen. 1919 versuchte man, mit dem Versailler Vertrag und der Gründung des Völkerbunds einerseits den Kommunismus aufzuhalten und andererseits eine deutsche Wiederaufrüstung zu verhindern. In ähnlicher Weise gingen die Vereinten Nationen 1945 aus einer gegen Deutschland gerichteten Kriegsallianz hervor, deren Ziel diesmal der Sturz des Hitlerregimes gewesen war. Dieser Ursprung spiegelt sich heute noch in der Zusammensetzung des Sicherheitsrats mit seinen fünf Vetomächten wider. Deutschland verlor riesige Gebiete, insbesondere im Osten; Millionen Menschen wurden vertrieben oder flohen westwärts. Das Rumpfgebiet wurde in vier Zonen aufgeteilt, aus denen schließlich die Bundesrepublik im Westen und die Deutsche Demokratische Republik im Osten gebildet wurden. Wie die deutsche Frage gelöst werden könnte, wurde zum Hauptthema des Kalten Krieges zwischen den westlichen Demokratien und den kommunistischen Diktaturen unter Führung der Sowjetunion. Der Atomwaffensperrvertrag, auf den man sich in den 1960er Jahren einigte, ging im Wesentlichen auf die Absicht zurück, zu verhindern, dass Deutschland in den Besitz von Atomwaffen gelangte.
Die deutsche Frage bildete auch den Hauptimpuls des europäischen Einigungsprozesses. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde gegründet, um zu erreichen, dass Deutschland und Frankreich strukturell nicht mehr in der Lage waren, wieder gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Für Washington ging es bei der europäischen Integration nicht nur um die Eindämmung des deutschen Revanchismus, sondern auch darum, die Bundesrepublik gegen die sowjetische Bedrohung zu mobilisieren. Dem Europäischen Wiederaufbauprogramm der Vereinigten Staaten, allgemein Marshallplan genannt, lag die Hoffnung zugrunde, dass die deutschen Exporte einen europäischen Aufschwung auslösen würden. Bonn wurde durch das Londoner Schuldenabkommen von 1953 von Reparationsforderungen und einem großen Teil der deutschen Auslandsschulden entlastet, wofür es sich im Gegenzug mit der »Einbettung« der Bundesrepublik in übernationale Strukturen einverstanden erklärte. Mitte der 1950er Jahre blockierte das französische Parlament jedoch die politische und militärische Integration des Kontinents durch die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Danach vollzog sich die militärische Integration Europas, einschließlich der Wiederbewaffnung Westdeutschlands, im Rahmen der NATO. Die wirtschaftliche, politische und kulturelle Integration führte 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die später zur Europäischen Gemeinschaft und dann zur Europäischen Union wurde. Als sich die deutsche Wirtschaft erholte, verlagerte sich die Aufmerksamkeit auf den Umgang mit dieser Macht, und es bildete sich in zunehmendem Maß der Konsens heraus, dass die mächtige Deutsche Mark, deren Stärke der Bundesbank praktisch die Kontrolle über die europäischen Zinssätze verschaffte, letztlich durch eine gemeinsame Währung ersetzt werden müsse. Schon vor der deutschen Wiedervereinigung hatte der französische Präsident François Mitterrand gewarnt: »Ohne eine gemeinsame Währung sind wir alle … dem Willen der Deutschen unterworfen.«6
All dies war ein zweiseitiger Prozess. Für die Deutschen stellte das europäische Projekt ein Vehikel dar, mit dem sie nach dem Nationalsozialismus die politische Rehabilitierung erreichen konnten, ohne sich vor ihren westlichen Partnern oder sich selbst fürchten zu müssen. Sie brachten nicht nur ihre sich rasch erholende Wirtschaft, sondern auch einen großen Teil ihrer vormodernen politischen Kultur in die Europäische Gemeinschaft ein, insbesondere eine Vorliebe für die Verrechtlichung politischer Streitigkeiten, für endlose Debatten und ordentliche Verfahren, so dass die Gemeinschaft immer mehr dem alten Heiligen Römischen Reich ähnelte. Der französische Innen- und vormalige Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement warf Deutschland sogar vor, es wollte, indem es das Heilige Römische Reich als Modell für die europäische Verfassungsentwicklung hochhielt, die Macht der Nationalstaaten aushöhlen und so die Hindernisse für seine Dominanz beseitigen. Er hatte nur zur Hälfte recht, insofern die Autorität, welche die Mitgliedsstaaten auf den entscheidenden Gebieten der Finanz-, Außen- und Militärpolitik verloren, nicht eigentlich übertragen, sondern vielmehr atomisiert wurde. Wie das Alte Reich beruhte die Europäische Gemeinschaft nicht auf der Konzentration, sondern auf der Diffusion von Macht.
Fünfzig Jahre lang funktionierte diese Übereinkunft gut. Deutschland und Westeuropa prosperierten. Die Bundesrepublik und die Europäische Gemeinschaft waren das beste Deutschland und das beste Europa, die es jemals gab. Trotz aller zeitgenössischen Befürchtungen änderte sich dies auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Wiedervereinigung von 1989/90, durch die das territoriale und demographische Gewicht der Bundesrepublik beträchtlich zunahm, nicht sofort. Dies lag zum Teil daran, dass die deutsche Wirtschaft weit länger als erwartet brauchte, um den vom Kommunismus heruntergewirtschafteten Osten zu integrieren. Der Hauptgrund bestand jedoch darin, dass die nächsten Stufen des europäischen Projekts, die Umsetzung des Maastrichter Vertrags von 1992 und insbesondere die Einführung des Euro, der an die Stelle der mächtigen Deutschen Mark treten sollte, vorangetrieben wurden, um das vereinigte Deutschland fester in ein vereinigtes Europa einzubetten. Der deutsche Finanzminister Theo Waigel erklärte den Deutschen: »Wir bringen die D-Mark nach Europa.«7 Die Währungsunion wurde jedoch nicht durch eine politische Union ergänzt; die Europäische Gemeinschaft behielt ihre lockere föderale Struktur.
Die Bundesrepublik brach also trotz ihrer neuen Größe nicht aus, sondern arbeitete immer enger mit ihren Partnern zusammen, insbesondere auf dem Gebiet der Sicherheit, auf dem sie lange hinterhergehinkt war. Berlin war ein eifriger Befürworter der ersten Osterweiterung von NATO und EU nach Polen, Ungarn und Tschechien. Schließlich nahmen deutsche Truppen an der Intervention gegen die ethnische Säuberung in Bosnien teil; sie waren bei der NATO-Intervention im Kosovokonflikt von Anfang an dabei, und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 entsandte Berlin Truppen nach Afghanistan. »Die deutsche Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt«, hieß es. Und als Deutschland vorübergehend den Wachstums- und Stabilitätspakt nicht erfüllte, stand es damit nicht allein da. Auf jeden Fall hatte es den Anschein, als hätte die Verhaltensänderung Deutschlands seit 1945 die strukturelle Umwälzung infolge der Wiedervereinigung neutralisiert. Die deutsche Frage, so schien es, war durch die Integration Deutschlands in den Westen gelöst.8
Was das Verhalten anging, traf dies sicherlich zu. Die Deutschen hatten sich in der Tat verändert, aber Europa nicht – oder nicht genug. Vom Jahr 2010 an geriet die nach dem Kalten Krieg errichtete Ordnung vor allem aus strukturellen Gründen zunehmend unter Druck. Erstens gewann die deutsche Wirtschaft – die man um die Jahrtausendwende als kranken Mann Europas abgeschrieben hatte – durch die von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Gang gesetzten Reformen auf Kosten Südeuropas ihre Wettbewerbsfähigkeit zurück. Plötzlich war wieder von einem »Modell Deutschland« die Rede.9 Zweitens platzte schließlich die Blase, die durch die Währungsunion an der westlichen und südlichen Peripherie Europas entstanden war, und da es keine politische Union gab, fehlten den Europäern die Instrumente, die sie gebraucht hätten, um über den nationalen Rahmen hinaus darauf reagieren zu können. Als das Land mit der größten und gesündesten Wirtschaft war Deutschland nicht nur gut aufgestellt, um den Sturm unbeschadet zu überstehen, sondern dominierte auch in zunehmendem Maß die gesamteuropäische Reaktion auf die Krise. Daher hat der Einfluss Deutschlands, dem es widerstrebte, der Europäischen Zentralbank die Erlaubnis für den von der bankrotten Peripherie ersehnten Staatsanleihenankauf zu geben, und das stattdessen eine kaum verdauliche Kur aus strikten fiskalischen »Regeln« durchsetzte, in den letzten fünf Jahren enorm zugenommen. Frankreich wurde im europäischen Entscheidungsprozess immer weiter an den Rand gedrängt. Deshalb überrascht es nicht, dass in diesem Zeitraum überall in Europa auch eine neue Welle von politischer und populärer Deutschfeindlichkeit entstand. In Griechenland, das von EU und IWF unter finanzielle Kuratel gestellt wurde, hat der Hass auf Deutschland – das als treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen »Versklavung« des Landes betrachtet wird – ein derartiges Ausmaß angenommen, dass Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem letzten Besuch in Athen von Tausenden von Polizisten geschützt werden musste. Jedenfalls haben das europäische Projekt, so, wie es derzeit aufgebaut ist, im Allgemeinen und die Währungsunion im Besonderen, die beide ursprünglich den Zweck hatten, die deutsche Macht einzudämmen, diese in Wirklichkeit vergrößert. Es ist also genau das eingetreten, wovor Margaret Thatcher stets gewarnt hat. Wir leben heute, um den Historiker Timothy Garton Ash zu zitieren, im Zeitalter der »neuen deutschen Frage«.10
Die eigentliche, weitgehend unbeachtete Veränderung nach 1989 war nicht der Gebietszuwachs der Bundesrepublik, sondern der Zuwachs an Sicherheit. Durch den Zusammenbruch des Kommunismus und die Vergrößerung der NATO und der Europäischen Union war Deutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte ausschließlich von befreundeten Demokratien umgeben. Deshalb ließ das Interesse an Sicherheitsfragen erheblich nach, insbesondere in Bezug auf die Neubelebung der russischen Macht im Osten. Polen und die baltischen Staaten waren aus Furcht vor einem Sicherheitsvakuum in Osteuropa zutiefst beunruhigt, als Berlin 2008 sein Veto gegen die Aufnahme der Ukraine in die EU einlegte. Ihr Entsetzen verstärkte sich nach der Weigerung der Bundeskanzlerin, jegliche noch so geartete Vergeltungsmaßnahme zu beschließen, als der Kreml wenig später Truppen in Georgien einmarschieren ließ und anschließend das umstrittene Gebiet praktisch annektierte, indem er russische Pässe an die Einwohner ausgab. Im Februar und März 2014 warf die russische Aggression in der Ukraine erneut die Frage auf, inwieweit die Deutschen, gemütlich in ihrem mitteleuropäischen Idyll lebend, weit entfernt vom Epizentrum der Krise, nach guten Beziehungen zu Moskau verlangend und nach russischer Energie hungernd, in der Lage sind, an das allgemeine geopolitische Wohl Europas zu denken, auch wenn ihre unmittelbare Sicherheit nicht davon abhängt. Die Folge ist, dass Polen, Balten und Ungarn Berlin heute ebenso vergeblich um Hilfe bitten wie vor über fünfhundert Jahren die Ungarn und Kroaten den Reichstag.
Schließlich gibt es auch eine Spaltung im Verhalten, diesmal zwischen den »ehrlichen« Deutschen und den »unvorsichtigen« anderen. Obwohl die Wirtschafts- und Fiskalkrisen in den einzelnen europäischen Ländern unterschiedliche Ursachen haben, gehen sie alle auf verschiedene Formen schlechten Wirtschaftens zurück, denen die Deutschen im großen Ganzen nicht gefrönt haben. Anders als Iren und Spanier bauten sie keine riesigen Anlagen mit Eigentumswohnungen, sondern begnügten sich damit, ihre Wohnungen zu mieten, wie sie es immer getan hatten; im Gegensatz zu den Italienern verwandelten sie ihr politisches Leben nicht in einen Zirkus, der das Vertrauen in ihre Staatsanleihen untergrub; und im Unterschied zu den Griechen besitzen sie ein politisches System, das sich (bei allen Mängeln) durch relative Ehrlichkeit und Transparenz auszeichnet. Gleichwohl leiden diese Länder zudem unter einem strukturellen Fehler der neuen europäischen Architektur, der dazu führte, dass die Währungsunion als Nachfolger der Deutschen Mark in den meisten Mitgliedsstaaten einen Tsunami aus billigen Krediten auslöste und in einigen von ihnen eine Vermögenspreisblase entfachte. Dies ist die große Ironie der staatlichen und privaten Schuldenkrise an der europäischen Peripherie: Ihre Verlierer sind in erster Linie nicht der deutschen Macht, sondern einem Versuch, sie einzudämmen, zum Opfer gefallen.
Kurz, die deutsche Frage ist im Verlauf eines halben Jahrtausends mutiert. Rund vierhundert Jahre lang war Deutschland zu schwach, und die Frage lautete, wie man die Deutschen zur Verteidigung des Machtgleichgewichts mobilisieren oder wenigstens verhindern konnte, dass sie einem Hegemon in die Hände fielen. Nach der deutschen Vereinigung im Jahr 1871 war Deutschland achtzig Jahre lang zu stark und gefährdete entweder tatsächlich oder dem Anschein nach den Weltfrieden. Danach folgte ein knappes halbes Jahrhundert, in dem Deutschland politisch relativ schwach war und weit weniger für den Westen tat, als ihm möglich gewesen wäre. Heute ist Deutschland, wie gesehen, sowohl zu stark als auch zu schwach oder wenigstens zu unbeteiligt. Es befindet sich in unbequemer Lage im Zentrum der Europäischen Union, die in erster Linie geschaffen wurde, um die deutsche Macht einzudämmen, stattdessen aber dazu gedient hat, sie zu stärken, und die aufgrund ihrer Konstruktionsfehler viele andere Europäer unabsichtlich ihrer Souveränität beraubt hat, ohne ihnen eine demokratische Teilhabe an der neuen Ordnung zu gewähren. Schlimmer noch, Deutschland ist ein lähmendes politisches Vakuum mitten im Zentrum eines Kontinents, der angesichts drängender ökonomischer und fiskalischer Herausforderungen und ganz allgemein des Zusammenhalts bedarf.
Heute stehen wir vor folgenden Fragen: Wie kann die Bundesrepublik, die prosperiert und sicher ist wie niemals zuvor, dazu gebracht werden, die politische Initiative zu ergreifen und die vorübergehenden ökonomischen Opfer zu bringen, die nötig wären, um die europäische Einigung zu vollenden? Wie kann man erreichen, dass Deutschland weiterhin als Subjekt des europäischen Systems handelt, ohne dass die anderen europäischen Länder dadurch in Objekte verwandelt werden? Wie können sämtliche Kräfte des Kontinents, einschließlich derjenigen Deutschlands, für die Aufgabe mobilisiert werden, die enorme Herausforderung durch das Wachstum der russischen und chinesischen Macht zu bewältigen und den relativen Niedergang der Vereinigten Staaten, sollte er sich als dauerhaft herausstellen, auszugleichen? Wie können die Europäer die seit den 1950er Jahren aufgerissene Kluft zwischen sozioökonomischer und politisch-militärischer Integration schließen? Kurz, wie erledigen wir mit einem Streich die deutsche und die europäische Frage, denn die eine zu lösen bedeutet auch die Lösung der anderen?
Es gibt einen Weg. Um ihn zu gehen, müssen die Deutschen und die Europäer die föderativen Traditionen des Alten Reichs und seiner Nachfolgerin, der Europäischen Union, aufgeben, das heißt, sie müssen den grundlegenden Glauben abstreifen, Europa könne nur durch Krisen voranschreiten, die den Ruf nach »mehr Europa« und damit nach mehr Krisen auslösen.11 Das Ergebnis wäre wahrscheinlich entweder eine Auflösung wie im Jahr 1806 oder ein vollgültiger Bundesstaat. Denn, was auch immer die Zukunft bereithalten mag, das große Opfer der letzten fünf Jahre ist die »gradualistische« Täuschung, Europa könne Stein auf Stein, Schritt für Schritt, peu à peu »aufgebaut« werden. Was wir stattdessen brauchen, ist ein kurzes kollektives Feuer, in dem angesichts gewaltiger ökonomischer und außenpolitischer Gefahren neue Institutionen und letztlich neue Identitäten gebrannt werden. Wie dies genau geschehen soll, ist eine Frage, die eher an Politiker als an Historiker gerichtet ist. Ob es geschehen wird, ist eine Frage an Propheten, nicht an Gelehrte. Wenn es jedoch geschehen soll, werden die Europäer den Blick auf die angloamerikanischen Demokratien des Westens richten müssen, in denen in der Vergangenheit ähnliche Probleme bewältigt wurden.
Am Anfang des 18. Jahrhunderts beendeten Engländer und Schotten ihre jahrhundertealte militärische, diplomatische und wirtschaftliche Konfrontation und vereinigten ihre Kräfte. Diese Union hatte zwei Ziele: Zum einen sollte die seit langem bestehende Rivalität zwischen beiden Ländern beigelegt werden, die Englands Feinden regelmäßig eine Gelegenheit geboten hatte, Druck auf dessen Nordgrenze auszuüben. Zum anderen sollten die vereinigten Ressourcen effektiver gegen äußere Mächte mobilisiert werden, anstatt sie durch Konkurrenz in Handel und Kolonialbestrebungen zu schwächen. Diese Erwägungen setzten sich während des Spanischen Erbfolgekriegs gegen das bourbonische Frankreich schließlich durch. Das Ergebnis war der Act of Union von 1707, der Schottland eine großzügige Vertretung in Westminster zusicherte; ferner durfte es sein Rechts- und Bildungssystem behalten, seine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik aber musste es aufgeben. Die gemeinsame Abwehr von Papsttum und Universalmonarchie schmiedete die beiden Unionspartner bald wirkungsvoller zusammen, als Bestechung, Einschüchterung und nackte kommerzielle Vorteile es jemals vermocht hätten.12 Großbritannien war geboren und mit ihm ein fiskalisch-militärischer Staat, der seither mehr in der Welt zählt, als es seinem »natürlichen« Gewicht entspräche.
Ein ähnlicher Prozess führte im späten 18. Jahrhundert zur Gründung der amerikanischen Union. Häufig wird angenommen, die Neue Welt habe sich in gesegneter Isolation von der Alten entwickelt. »Amerika, du hast es besser«, schwärmte Goethe. »Als unser Kontinent, der alte, / Hast keine verfallenen Schlösser / Und keine Basalte. / Dich stört nicht im Innern / Zu lebendiger Zeit / Unnützes Erinnern / Und vergeblicher Streit.« In Wirklichkeit wurde der amerikanische Staat nicht in Abwesenheit der europäischen Rivalitäten geschaffen, sondern wegen ihnen. Die 13 Bundesstaaten waren mit riesigen Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien hervorgegangen. Außerdem fanden sie sich in einer gefährlichen Welt wieder. Ohne den Schutz durch die britische Marine war die amerikanische Handelsschifffahrt nach der Revolution sofort heftigen Angriffen von Berberkorsaren ausgesetzt, die von Nordafrika aus operierten. Großbritannien behielt Kanada im Norden und blieb der Union gegenüber feindselig eingestellt. Unglücklicherweise waren die aus dem Revolutionskrieg hervorgegangenen Verfassungsarrangements völlig ungeeignet, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Es gab keine wirkliche Exekutive, der Kongress hatte nicht das Recht, Steuern zu erheben, um nationale Projekte zu finanzieren, und sämtliche internationalen Verträge mussten von jedem einzelnen Bundesstaat ratifiziert werden, bevor sie in Kraft traten. Infolgedessen fehlte den Vereinigten Staaten sowohl ein richtiges Heer als auch eine Kriegsmarine. Tatsächlich waren die Bande, welche die Konföderation zusammenhielten, derart locker, dass viele Amerikaner fürchteten, die Vereinigten Staaten könnten in ihre Bestandteile zerfallen oder sogar in innere Kämpfe versinken.
Als die Repräsentanten der 13 Kolonien 1787 in Philadelphia zusammenkamen, um eine Verfassung auszuarbeiten, wussten sie genau, welchem europäischen Unionsmodell sie folgen würden. Das »föderative System« des Deutschen Reichs kam für den späteren Finanzminister Alexander Hamilton und den späteren Präsidenten James Madison nicht in Frage. Es sei ein »kraftloser Körper, der unfähig ist, seine eigenen Glieder zu dirigieren … wehrlos gegen Gefahren von außen und zugleich unaufhörlich von inneren Gärungsprozessen erschüttert«.13 Tatsächlich fand von den europäischen Präzedenzfällen nur einer bei den Autoren der Federalist Papers Gnade: die englisch-schottische Union von 1707, zu der sich zwei zuvor tief zerstrittene Partner zusammenschlossen, um »allen Feinden zu widerstehen«, wie Königin Anne im Juli 1706 in einem Brief an das schottische Parlament erklärt hatte. John Jay zitierte Königin Annes Ausführungen und sah in der von ihr beschworenen »vollständigen und vollkommenen Union« das zukunftweisende Vorbild für die amerikanische Republik.14 Die 1787 in Philadelphia ausgearbeitete Verfassung zeigte, dass die Amerikaner aus den britischen und deutschen Erfahrungen gelernt hatten. Wie Schotten und Engländer waren sie entschlossen, ihren »Bund zu vervollkommnen«, wie es in der Präambel hieß. In Form des Präsidentenamts wurde eine starke Exekutive geschaffen, die zur Führung der Außenpolitik und zum Abschluss von internationalen Verträgen ermächtigt war, die dann jedoch der Ratifikation durch den Senat bedurften. Der Rest ist bekannt: Die Vereinigten Staaten entwickelten sich zum mächtigsten Staat der Welt. Vielleicht hätte Goethe besser dichten sollen: »Amerika, du machst es besser.«
Die Geschichte zeigt, dass erfolgreiche Vereinigungen nicht in einem schrittweisen Prozess der Annäherung unter relativ günstigen Umständen entstehen, sondern durch scharfe Brüche in Zeiten extremer Krisen. Sie kommen nicht durch eine Evolution zustande, sondern durch einen »Urknall«. Sie sind eher Ereignisse als Prozesse. Die politische Einheit, die Europa so dringend braucht, erfordert daher eine einzige kollektive Willensanstrengung der europäischen Regierungen und Eliten sowie letztlich auch der Bürger.
1 Jaspers, Die Schuldfrage, S. 67.
2 Taylor, From Napoleon to Stalin, S. 83.
3. Zit. in Osiander, The States System of Europe, S. 79
4 Siehe jetzt Schlie, Das Duell.
5 Siehe O’Reilly, Selling Souls.
6 Zit. in Marsh, Der Euro, S. 199.
7 Zit. in ebd., S. 195.
8 Siehe Winkler, »Die deutsche Frage ist gelöst, die europäische Frage ist offen«.
9 Siehe Rödder, »›Modell Deutschland‹ 1950–2011«.
10 Garton Ash, »The New German Question«; vgl. Geppert, Ein Europa, das es nicht gibt.
11 So die brillante Analyse von Andreas Wirsching in Der Preis der Freiheit, S. 190 und passim.
12 Siehe Simms, Three Victories and a Defeat, S. 51–53.
13 Hamilton/Madison/Jay, Die Federalist Papers, Nr. 19 (Madison/Hamilton), S. 143 f
14 Ebd., Nr. 5 (Jay). S. 69.
Vorwort
Es heißt oft, die Vergangenheit sei ein anderes Land, und in den zurückliegenden rund 550 Jahren, die in diesem Buch behandelt werden, hat man vieles gewiss anders gemacht als in der Gegenwart. Religionskriege, Sklaverei, Nationalsozialismus und sogar Kommunismus erscheinen westlichen Lesern heute als etwas Fremdes. Im Gegensatz dazu hätten unsere Vorfahren über den heutigen Konsens in Bezug auf das allgemeine Wahlrecht, Rassengleichheit und Frauenemanzipation nur den Kopf geschüttelt. Wahrscheinlich werden spätere Generationen vieles von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, merkwürdig finden. Manches ändert sich indes nie – oder nur sehr wenig und sehr langsam. In diesem Buch wird gezeigt, dass die hauptsächlichen Sicherheitsfragen, mit denen die Europäer konfrontiert waren, über die Jahrhunderte hinweg bemerkenswert gleich geblieben sind. Die Konzepte, wenn auch nicht die Begriffe, von Einkreisung, Puffern, Gleichgewicht, gescheiterten Staaten und Prävention, der Traum von einem Reich und das Verlangen nach Sicherheit, die zentrale Rolle Deutschlands als Halbleiter, der die verschiedenen Teile des europäischen Hauses miteinander verbindet, die Balance zwischen Freiheit und Autorität, die Spannung zwischen Konsultation und Wirksamkeit, der Zusammenhang von Außen- und Innenpolitik, das Verhältnis zwischen Ideologie und Staatsräson, die Phänomene nationaler Hochmut und nationaler Versagensangst, der Zusammenprall der Kulturen und die Entwicklung von Toleranz: Alle diese Themen haben die europäischen Staatsmänner und Weltführer (sofern sie nicht beides in einer Person waren) von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis heute beschäftigt. Kurz, im vorliegenden Buch geht es um die Gegenwärtigkeit der Vergangenheit.
Dies vorausgeschickt, muss hervorgehoben werden, dass die Vergangenheit einst offen war. Die europäische Geschichte hat stets die Keime vieler »Zukünfte« in sich getragen. Deshalb werden wir neben den Hauptstraßen, die zum internationalen Staatensystem von heute und zu der ihm zugrunde liegenden innenpolitischen Ordnung führten, auch den nicht genommenen Wegen und denen, die nirgendwohin führten, Aufmerksamkeit schenken. Wir werden die Verlierer mit gebührendem Respekt betrachten, wie schwer dies auch fallen mag. Immerhin waren die Niederlagen von Karl V., Ludwig XIV., Napoleon und Hitler alles andere als unvermeidlich. Das Aufkommen religiöser Toleranz, das Ende von Sklaverei und internationalem Sklavenhandel und die Ausbreitung der westlichen Demokratie in Europa waren nicht vorherbestimmt. Jedoch waren diese Ergebnisse kein Zufall. Wie wir sehen werden, bestand ein enger Zusammenhang zwischen dem Aufstieg und Niedergang der Großmächte, der Zunahme der Freiheit und dem Triumph des Westens. Ob es weiterhin so sein wird, hängt stark davon ab, was die Europäer auf beiden Seiten des Atlantiks tun werden. Wir werden unsere eigene Geschichte gestalten müssen und dabei jene der Vergangenheit nicht als Bedienungsanleitung benutzen, sondern als Leitfaden dafür, wie man früher mit diesen Fragen umgegangen ist. Aus diesem Grund endet das letzte Kapitel nicht mit einer Voraussage, sondern mit einer Reihe von Fragen. Andernfalls wäre aus diesem Buch kein historisches Werk geworden, sondern ein prophetisches.
EinführungEuropaum1450
»Das Maß der Unabhängigkeit gibt einem Staate seine Stellung in der Welt; es legt ihm zugleich die Notwendigkeit auf, alle inneren Verhältnisse zu dem Zwecke einzurichten, sich zu behaupten. Dies ist sein oberstes Gesetz.«
Leopold von Ranke15
»Die Geschichte ist europäisch … Wenn man sie als bloß lokal behandelt, ist sie ziemlich unverständlich.«
William Ewart Gladstone16
»Die Demokratie fängt erst an, strategisch zu denken, wenn sie zum Zweck der Selbstverteidigung dazu gezwungen ist.«
Halford Mackinder17
West- und Mitteleuropa besaßen seit dem Hochmittelalter das Gefühl einer gemeinsamen Identität.18 Fast alle seine Bewohner gehörten der katholischen Kirche an und unterwarfen sich der geistigen Autorität des Papstes in Rom; die gebildeten Schichten teilten die Kenntnis des römischen Rechts und der lateinischen Sprache. Einig waren sich die Europäer auch im Gegensatz zum Islam, der sich auf der Iberischen Halbinsel auf dem Rückzug befand, an der Südostflanke Europas aber rasch vordrang. Die meisten europäischen Gemeinwesen besaßen ähnliche soziale und politische Strukturen. Am unteren Ende des sozialen Spektrums zahlten die Bauern für ihren Schutz Abgaben an die Grundherren und für geistige Führung den Zehnten an die Kirche. Die vielen sich selbst regierenden Städte wurden zumeist von einer Elite aus Zunftmitgliedern und Magistratsherren geführt. An der Spitze der Pyramide gingen Aristokratie, hohe Geistlichkeit und in manchen Fällen auch Städte einen Sicherheitspakt mit einem Fürsten ein, dem sie Militärdienst und Beratung zusicherten, wofür sie im Gegenzug Schutz und die Bestätigung oder Vergrößerung ihres Landbesitzes erhielten.19 Diese »feudalistische« Vertragsbeziehung wurde fast überall in Europa durch repräsentative Versammlungen hergestellt: durch das englische, irische und schottische Parlament, die niederländische und französische Generalversammlung, die kastilische Cortes sowie den ungarischen, polnischen, schwedischen und deutschen Reichstag.20 Kurz, die meisten Fürsten übten keine absolute Herrschaft.
Im Gegensatz zum nahegelegenen Osmanischen Reich und zu den fernen asiatischen Gemeinwesen war die politische Kultur Europas also durch intensive öffentliche oder halböffentliche Debatten gekennzeichnet: darüber, wie viel Steuern wem, von wem und zu welchem Zweck gezahlt werden sollten, wobei Letzterer fast immer militärischer Art war. Obwohl sie eher Untertanen als Staatsbürger im modernen Sinn waren, glaubten die meisten Europäer an eine Herrschaft durch Konsens. Ständig waren sie besorgt, ihre Rechte – oder »Privilegien«, wie man damals sagte – gegen fürstliche Ansprüche zu verteidigen. Die Europäer lebten nicht in Demokratien, aber ihre Eliten waren in einem bedeutsamen Sinn »frei«. Darüber hinaus wuchs im spätmittelalterlichen Europa das Verlangen nach politischer Freiheit, auch wenn sie, je weiter man die soziale Leiter hinabstieg, mehr Sehnsucht als Realität war.21 In erster Linie wurde die Freiheit im Innern verteidigt, aber manchmal war ein heimischer Tyrann nur mit Hilfe benachbarter Fürsten zu besiegen. Aus diesem Grund besaßen die Europäer kein ausgeprägtes Souveränitätsgefühl: Viele betrachteten äußere Interventionen im Kampf gegen eine »tyrannische« Herrschaft nicht nur als legitim, sondern auch als wünschenswert und sogar als Pflicht rechtschaffener Fürsten.
Es wäre falsch, die fürstliche europäische Politik mit derjenigen von »Großmächten« oder Staaten im modernen Sinn zu vergleichen. Dennoch fand seit dem Hochmittelalter eine »Staatenbildung« statt, da die Fürsten bemüht waren, die militärische Mobilisierung zu intensivieren, um zu expandieren oder wenigstens zu überleben.22 Zudem hatten Gemeinwesen wie England, Frankreich, Kastilien, Polen und Burgund eine klare Vorstellung ihrer eigenen Andersartigkeit, Stärke und Bedeutung; zumindest in Bezug auf England und Frankreich ist es nicht verfrüht, von einem »Nationalbewusstsein« zu sprechen, das auf politischer Teilhabe sowie einer gemeinsamen Sprache und Kriegführung (hauptsächlich gegeneinander) beruhte. Gleichzeitig waren sich die Europäer der gemeinsamen Zugehörigkeit zur »Christenheit« – die synonym für Europa stand – bewusst, die weiterhin in regelmäßigen Kreuzzügen gegen die Moslems ihren Ausdruck fand. Dank der Reisen Marco Polos und anderer wussten die Europäer von der Existenz Chinas und des Fernen Ostens, während sie die westliche Hemisphäre weitgehend unbeachtet ließen. Gleichwohl verstanden sich die meisten von ihnen – weit davon entfernt, »eurozentrisch« zu sein – kartographisch immer noch als Bewohner des Randes einer Welt, deren Mittelpunkt Jerusalem und das Heilige Land bildeten.23 So wurden die ersten Entdeckungsreisen entlang der Westküste Afrikas unternommen, um einen alternativen Weg nach Osten zu finden, der es ermöglichen würde, die Moslems im Rücken anzugreifen. Der portugiesische Prinz Heinrich der Seefahrer, zum Beispiel, hoffte, den Islam ausmanövrieren und sich vielleicht sogar mit dem mythischen Königreich von »Priester Johannes« in Afrika oder Asien (man war sich nicht sicher, wo es lag) zusammenschließen zu können. 1415 nahm Portugal Ceuta in Besitz. Europa »expandierte« gewissermaßen in Selbstverteidigung.
Zugleich war Europa ein zutiefst gespaltener Kontinent, der sich während des gesamten Mittelalters in inneren Kriegen befand: zwischen Kaiser und Papst, zwischen fürstlichen Herrschern, zwischen Stadtstaaten und Territorialfürsten, zwischen Baronen, zwischen rivalisierenden Städten sowie zwischen Bauern und Grundherren. Die katholische Einheit wurde in Frage gestellt durch Lollarden in England, Hussiten in Böhmen, Albigenser in Südfrankreich und verschiedene andere Sekten. Außerdem äußerten sich in der Kirche viele kritisch über die Missbräuche, die sich im Mittelalter ausgebildet hatten. In der Mitte des 15. Jahrhunderts war Europa vielleicht ruhiger als im Frühmittelalter, aber es blieb ein gewalttätiger, zersplitterter Kontinent. Die italienischen Staaten, insbesondere Venedig und Mailand, lagen miteinander im Streit; auf der Iberischen Halbinsel strebte Alfonso von Aragon nach der Vorherrschaft; in Spanien standen sich Christen und Mauren, die immer noch Granada hielten, gegenüber; die Ungarn standen kurz davor, einen Kreuzzug gegen die osmanischen Türken zu unternehmen; Philipp von Burgund ließ seine Muskeln spielen, unschlüssig darüber, ob er auf einen Kreuzzug gehen oder in einen Kampf in größerer Nähe ziehen sollte; die Osmanen verstärkten ihre Angriffe auf die Reste des orthodox-christlichen Byzantinischen Reichs am Bosporus; und währenddessen wurde zwischen England und Frankreich eine Auseinandersetzung fortgeführt, die zum Hundertjährigen Krieg werden sollte.24
Im Mittelpunkt dieser europäischen Streitigkeiten stand das Heilige Römische Reich, das sich von Brabant und Holland im Westen bis Schlesien im Osten und von Holstein im Norden bis knapp unterhalb von Siena im Süden und Triest im Südosten erstreckte. Es umfasste das heutige Deutschland, Österreich, die Schweiz, Tschechien und die Niederlande ebenso wie einen Teil Belgiens, Luxemburg, Ostfrankreich, Norditalien und Westpolen. An der Spitze stand der Kaiser, der von sieben Kurfürsten gewählt wurde – den Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier sowie den herrschenden Fürsten Böhmens, der Pfalz, Sachsens und Brandenburgs. Er regierte in Konsultation mit den weltlichen und geistlichen »Ständen« – Kurfürsten, Fürsten, Grafen, Rittern und Städten –, die den Reichstag bildeten, das kaiserliche deutsche Parlament. Die Deutschen verhielten sich keineswegs unterwürfig, sondern lagen ständig im Streit mit der Obrigkeit, ob nun die Fürsten mit dem Kaiser oder die Bauern mit ihren Grundherren, vor kaiserlichen oder lokalen Gerichten.25 Das Reich war der Dreh- und Angelpunkt der europäischen Politik. Seine Bevölkerung war größer als die jedes anderen europäischen Gemeinwesens. Die Städte der Niederlande, des Rheinlands, Süddeutschlands und Norditaliens waren, zusammengenommen, die reichsten, lebendigsten und technisch am weitesten entwickelten in Europa. Das Reich – oder wenigstens seine mächtigsten Regenten – hielten das Gleichgewicht zwischen England und Frankreich aufrecht.26 Die englischen Ansprüche sollten sich nie mehr vom Abfall des Herzogs von Burgund im Jahr 1435 erholen, einem Mitglied der französischen Königsfamilie, dessen Land sich an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland erstreckte. Vor allem war die Kaiserkrone, da sie auf Karl den Großen zurückging, ein mächtiger Magnet nicht nur für deutsche Fürsten, sondern auch für die Könige der Nachbarländer, insbesondere diejenigen von Frankreich.27 Als einziger westlicher Herrscher konnte ihr Träger die Autorität des Nachfolgers der römischen Kaiser für sich beanspruchen.28
Trotz seiner enormen Bedeutung und seines stolzen Erbes befand sich das Reich Mitte des 15. Jahrhunderts in einer akuten Krise.29 Die Macht des Kaisers, seit 1438 ein Habsburger, war aufgrund der Zugeständnisse, die er in der Wahlkapitulation als Vorbedingung seiner Wahl gemacht hatte, aufgeweicht worden. Privatfehden und Banditenüberfälle nahmen überhand, und der Handel war Gegenstand einer Vielzahl mehr oder weniger erpresserischer Abgabenforderungen. Die Reichskirche steckte ebenfalls in einer tiefen Krise und war durch Missbräuche demoralisiert. Vor allem aber hatte das Reich Mühe, die gemeinsame Verteidigung zu gewährleisten. Anders als das englische Parlament erwies sich der Reichstag als unfähig, einen regulären Besteuerungsmechanismus einzuführen, um die Kriege gegen die Hussiten, die Türken und in zunehmendem Maß auch gegen Frankreich zu finanzieren.30 Außerdem befand sich das Reich in einer Identitätskrise. Es nahm für sich in Anspruch, die gesamte Christenheit zu repräsentieren, und zählte Menschen vieler »Nationalitäten« zu seinen Untertanen, unter ihnen solche, die Französisch, Niederländisch, Italienisch und Tschechisch sprachen, aber die meisten seiner Untertanen betrachteten sich als Deutsche oder sprachen wenigstens einen deutschen Dialekt. Noch war kaum von »Deutschland« die Rede, aber ab 1450 fügten die Zeitgenossen dem Begriff des Heiligen Römischen Reichs immer öfter den Zusatz »Deutscher Nation« hinzu.31
Im vorliegenden Buch wird gezeigt, dass das Heilige Römische Reich und seine Nachfolgestaaten den Kern des europäischen Machtgleichgewichts und des von Europa aufgebauten globalen Systems bildeten. Auf seinem Gebiet überschnitten sich die strategischen Interessen der Großmächte. Befand es sich in Freundeshand, konnte es die eigene Macht beträchtlich verstärken, während es in Feindeshand eine tödliche Bedrohung darstellte. Was in ihm geschah, war für England von Bedeutung, weil es die »Barriere« der Niederlande, die seine Südküste vor Angriffen schützte, sicherte und weil das Gleichgewicht in Europa von ihm abhing. Für Spanien war es von Bedeutung, weil es die Quelle des Kaisertitels war, ein Reservoir dringend benötigter Rekruten darstellte und als strategisches Hinterland der Spanischen Niederlande diente. Für Österreich wurde es später aus den gleichen Gründen wichtig. Für Frankreich stellte es sowohl einen Puffer als auch ein Expansionsgebiet dar. Preußen, selbst ein Territorium des Reiches, besaß in ihm letztlich ein Sprungbrett für die Expansion nach Westen und Osten. Für Amerika war es wegen der Intrigen des reichsdeutschen Kaisers in Mexiko von Bedeutung, und die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion verfolgten das Hauptziel, sein Gebiet entweder zu erobern oder wenigstens zu verhindern, dass der Gegner es sich aneignete.
Ferner waren das Heilige Römische Reich und seine Nachfolgestaaten für alle, die für Europa sprechen wollten, die wichtigste Quelle politischer Legitimität. Jahrhundertelang verlangte es die europäischen Hauptprotagonisten nach der Kaiserwürde und dem Erbe Karls des Großen. Heinrich VIII. strebte ebenso danach wie Suleiman der Prächtige; Karl V. besaß sie; französische Könige von Franz I. bis zu Ludwig XIV. wollten sie besitzen; Napoleon dachte ernsthaft darüber nach, sie anzunehmen; der Nachhall dieses Strebens in Hitlers »Drittem Reich« war unüberhörbar, und die Europäische Union hat ihren Ursprung in demselben Gebiet und demselben Streben, wenn auch mit einem völlig anderen Geist und Inhalt. Kurz, in den vergangenen 550 Jahren war es die unerschütterliche Überzeugung der europäischen Führer, selbst jener, die keine imperialen Ambitionen hegten, dass der Kampf um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich und seinen deutschen Nachfolgestaaten entschieden wurde. Königin Elisabeth I. wusste dies ebenso wie Cromwell, Marlborough, die beiden Pitts, Bismarck, das alliierte Oberkommando im Ersten Weltkrieg, Franklin D. Roosevelt, Stalin, Gorbatschow, die Russen, die sich nach dem Fall der Berliner Mauer hartnäckig der Ostausdehnung der NATO widersetzten, und die Eliten, die heute aus Furcht, Deutschland könnte sich aus seiner Verankerung lösen, bemüht sind, die Europäische Union zusammenzuhalten. Wer Mitteleuropa über einen längeren Zeitraum hinweg beherrschte, der herrschte über Europa, und wer über Europa herrschte, der würde letztlich die Welt dominieren.
Deshalb überrascht es nicht, dass der Kampf um die Herrschaft über Deutschland auch den Prozess der inneren Veränderung in Europa voranbrachte. Die Engländer begehrten gegen Karl I. auf, weil er die protestantischen deutschen Fürsten, von denen ihre eigene Freiheit abhing, nicht unterstützte. Die Franzosen brachen mit Ludwig XVI., weil er sich angeblich Österreich gegenüber unterwürfig verhielt. Und die Russen wandten sich vom Zaren ab, weil es ihm nicht gelang, das zweite deutsche Reich in die Schranken zu weisen. Deutschland war auch der Ursprungsort der bedeutsamsten weltanschaulichen Veränderungen in Europa: Reformation, Marxismus und Nationalsozialismus waren dort entstanden und beeinflussten die globale Geopolitik nachhaltig. Das Streben nach Sicherheit und Vorherrschaft trieb auch die Expansion Europas voran, von den ersten Reisen des Kolumbus bis zum »Wettlauf um Afrika« im 19. Jahrhundert, und später lag es der Entkolonialisierung zugrunde. Gewiss standen nicht immer Erwägungen in Bezug auf das Heilige Römische Reich und Deutschland dahinter, aber sie waren nie weit entfernt. Dies bezeugen die Bemühungen der englischen Marine im 17. und 18. Jahrhundert, das Gleichgewicht in Europa aufrechtzuerhalten, indem sie Edelmetalllieferungen aus der Neuen Welt an die Rivalen Englands abfing, ebenso wie William Pitts Bemerkung, man müsse »Amerika in Deutschland gewinnen«, das französische Streben im späten 19. Jahrhundert, als Gegengewicht zum deutschen Kaiserreich sein Kolonialreich auszuweiten, und der britische Versuch, mit Hilfe der Balfour-Erklärung weltweit Juden gegen den Kaiser zu mobilisieren, womit eine Entwicklung in Gang gesetzt wurde, an deren Ende die Gründung Israels stand.
15 Ranke, »Politisches Gespräch«, S. 60.
16 Zit. in Schreuder, »Gladstone and Italian unification, 1848–70«, S. 477.
17 Mackinder, Democratic Ideals and Reality, S. 23.
18 Siehe Bartlett, Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt, S. 295–326.
19 Bisson, »The Military Origins of Medieval Representation«, S. 1199, 1203.
20 Vgl. Myers, Parliaments and Estates in Europe to 1789; Koenigsberger, »Parliaments and Estates«. Zu England, Deutschland und Schweden siehe Blickle/Ellis/Österberg, »The Commons and the State«. Zur parlamentarischen Kritik an der großen Strategie und zum fiskalischen Zähnefletschen siehe Roskell, The History of Parliament, S. 89, 101–115, 126, 129, 137.
21 Siehe Cohn, Lust for Liberty, S. 228–242.
22 Siehe Bonney (Hg.), The Rise of the Fiscal State in Europe; Contamine (Hg.), War and Competition between States.
23 Siehe Wintle, The Image of Europe, S. 58–64.
24 Vgl. Kohler, Die spätmittelalterliche Res Publica Christiana und ihr Zerfall.
25 Siehe Blickle, Deutsche Untertanen, S. 55–60; vgl. auch Kintzinger/Schneidmüller, Politische Öffentlichkeit im Spätmittelalter.
26 Zum starken englischen Interesse am Heiligen Römischen Reich siehe Reitmeier, Außenpolitik im Spätmittelalter, S. 14 f., 474–481 und passim.
27 Siehe Tanner, The Last Descendant of Aeneas; Kintzinger, Die Erben Karls des Großen; Haran, Le lys et le globe. Zum strategischen Aspekt siehe Hardy, »The 1444–5 Expedition of the Dauphin Louis to the Upper Rhine in Geopolitical Perspective«, S. 360–370.
28 Siehe Marquardt, Die »europäische Union« des vorindustriellen Zeitalters.
29 Siehe Brady, German Histories in the Age of Reformations, 1400–1650, S. 90–98.
30 Isenmann, »Reichsfinanzen und Reichssteuern im 15. Jahrhundert«, S. 1–9; Lanzinner, »Der Gemeine Pfennig, eine richtungweisende Steuerform?«
31 Scott, »Germany and the Empire«, S. 337–340.
1REICHE
1453—1648
»Schließlich wurde mir, mit einhelliger Zustimmung Germaniens, das Reich übertragen: nach dem Willen, wie ich glaube, und dem Befehl Gottes … Zufrieden könnte ich freilich sein mit dem spanischen Reich, den Balearen und Sardinien, dem Königreich Sizilien, einem großen Teil Italiens, Germaniens, Galliens und einer anderen, gewissermaßen goldreichen Welt [Südamerika] … Das alles kann kaum existieren oder geschehen, wenn ich nicht Germanien mit Spanien verbinde und dem spanischen Titel den des Kaisers hinzufüge.«
Kaiser Karl V., 152032
»[D]ie Cron Schweden müsse ein groß absehen Vff Teütschlandt haben, Vndt Sich Versichern, den es were temperata et populosa regio vndt eine bellicosa Natio, das kein Landt Vnter der Sonnen, welches zu erlangung einer universal monarchia vndt absoluten dominats in Europa so woll gelegen, als Deütschlandt … Wan nun ein Potentate dieses Reich absolute beherrschte, müsten alle vicina Regna in Sorgen stehen, das sie subjugirt würden …«
Johan Adler Salvius, schwedischer Unterhändler in Osnabrück, 164633
Der Fall von Konstantinopel und der französische Sieg im Hundertjährigen Krieg
Mit dem Zusammenbruch des Byzantinischen Reiches und kurz darauf des englischen Reiches in Frankreich markierte das Jahr 1453 den Beginn der modernen europäischen Geopolitik. Beide Ereignisse hatten tiefgreifende Folgen für Europa als Ganzes, besonders aber für das in seiner Mitte liegende Heilige Römische Reich Deutscher Nation, von den Zeitgenossen für gewöhnlich einfach »das Reich« genannt. Nach dem Sieg über England erhöhte Frankreich bald den Druck auf die Westflanke Deutschlands und erhob mit mehr Nachdruck Anspruch darauf, die Politik des Reiches zu kontrollieren, zumindest aber zu beeinflussen. Weiter östlich setzten die Osmanen ihren Vormarsch nach Südost- und Mitteleuropa fort, der sie schließlich zweimal bis vor die Tore Wiens brachte. Die Aufgabe, diesen Bedrohungen entgegenzutreten, fiel den Habsburgern zu, die auf dem Höhepunkt der Regentschaft Karls V. nicht nur über einen großen Teil Mittel-, Süd- und Nordwesteuropas, sondern auch über weite Gebiete der Neuen Welt herrschten. Entscheidend für die Aufrechterhaltung dieser Machtstellung war die Kaiserkrone, deren Träger potentiell das letzte Wort in Deutschland erhielt und einen universalen Anspruch auf die Führungsrolle in Europa erheben konnte. In den Augen seiner Gegner waren die Ambitionen Karls V. sowie der spanischen und österreichischen Habsburger, die ihm nachfolgten, dagegen Teil eines finsteren Plans zur Errichtung einer »Universalmonarchie« in Europa. Die Bemühungen der Habsburger, ihre imperialen Ansprüche durchzusetzen, und die Entschlossenheit ihrer Gegner, ihnen die Herrschaft über das Heilige Römische Reich zu verwehren, bestimmten die europäische Geopolitik der nächsten zweihundert Jahre.
Der Fall von Konstantinopel und die englische Niederlage in Frankreich führten in ganz Europa zu tiefgreifenden innenpolitischen Veränderungen. In den nächsten zwei Jahrhunderten bildeten sich zwei unterschiedliche Regierungsformen heraus, die beide auf ihre Weise eine direkte Antwort auf die internationalen Herausforderungen darstellten. Einerseits entstanden die konsultativen Systeme Englands und der Vereinigten Niederlande, deren bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit beide Staaten in die Lage versetzte, nicht nur alle Anfechtungen zu überstehen, sondern auch das europäische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Andererseits gab es die monarchischen Systeme, vom reinen Despotismus, wie im Osmanischen Reich und in Russland, bis zu Mischformen, wie in Frankreich und Spanien, wo repräsentative Versammlungen weiterhin eine bedeutende Rolle spielten, auch wenn sich die königliche Macht unverkennbar im Aufwind befand. Währenddessen kämpfte das Reich, das sowohl geopolitisch als auch mit seiner Regierungsform in der Mitte lag, darum, sich eine Verfassungsstruktur zu geben, die es befähigen würde, die inneren Spannungen aufzulösen und äußere Aggressoren abzuschrecken.
Das Osmanische Reich
Die erste Herausforderung kam von den Osmanen. Im Sommer 1453 fiel Konstantinopel – die Hauptstadt dessen, was vom orthodox-christlichen byzantinischen Staat übriggeblieben war – nach langer Belagerung an die Türken.34 Es folgte eine brutale Plünderung mit Tausenden von Morden und Vergewaltigungen und der Entweihung der antiken Kirchen der Stadt. Aus christlicher Sicht noch schlimmer war, dass Mehmed II. jetzt den Titel »Kayser-i Rum«, Kaiser von Rom, annahm. Er verlegte nicht nur seine Hauptstadt nach Konstantinopel – das der Prophet Mohammed als Zentrum der Welt bezeichnet hatte –, sondern behielt auch den Namen der Stadt mit all seinen europäischen und imperialen Obertönen bei.35 Danach war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Osmanen eine neue Offensive über das Mittelmeer oder auf dem Balkan in Richtung Mitteleuropa unternehmen würden, um ihren Anspruch auf das Römische Reich durchzusetzen, auf dem Weg der Kontrolle über Europa die Weltherrschaft zu erlangen und um ihren universalen Auftrag, den Islam zu verbreiten, zu verfechten. Aus diesem Grund nahm die gesamte Christenheit den Fall von Konstantinopel mit panischem Entsetzen auf.36 Sogar im fernen Skandinavien erklärte König Christian I., der »Großtürke« sei »das aus dem Meer aufsteigende Ungeheuer, das in der Apokalypse beschrieben wird«.37
Im frühen 16. Jahrhundert wurde der Vormarsch unter Suleiman dem Prächtigen fortgesetzt. Sein Ziel war nichts Geringeres als eine Universalmonarchie: Eine spätere Inschrift über dem Eingang der Großen Moschee in Konstantinopel bezeichnete ihn als »Eroberer der Lande des Orients und des Okzidents, mit Hilfe des allmächtigen Gottes und seiner siegreichen Armee, Besitzer der Königreiche der Welt«.38 Im Bund mit den unzufriedenen spanischen Mauren und ihren ausgewanderten Verbündeten entlang der nordafrikanischen Küste schlug er im Mittelmeerraum zu. Nachdem er Algerien zum osmanischen Vasallen gemacht, den Johanniterorden auf Rhodos überwältigt und den größten Teil der Küste des Schwarzen Meers gesichert hatte, wandte sich der Sultan gegen Mitteleuropa. 1521 nahm er die große Festung Belgrad ein, und fünf Jahre später brachte er dem ungarischen Heer in der Schlacht bei Mohács eine vernichtende Niederlage bei. Ein riesiger Teil Südosteuropas, einschließlich fast des gesamten fruchtbaren Donaubeckens, geriet unter osmanische Herrschaft. Ungarn, dessen Adel sich selbst zum »Schild und Bollwerk der Christenheit« erklärt hatte, gab es nicht mehr. In seiner selbst proklamierten Rolle als »Verteiler von Kronen an die Monarchen der Welt« machte Suleiman seine Marionette Johann Zápolya zum »König« von Ungarn. Er war, mit den Worten des griechische Historikers Theodore Spandounes, dabei, »eine unübersehbare Streitmacht aufzustellen, um die Christen an Land und auf See mit Krieg zu überziehen«, mit »dem einen Ziel, sie wie ein Drache mit weit aufgerissenem Schlund zu verschlingen«.39 Nur mit Mühe wehrten die Habsburger im Jahr 1529 einen türkischen Angriff auf Wien selbst ab.
Ende der 1550er Jahre griffen Suleimans Nachfolger erneut an. 1565 tauchten die Türken vor der strategisch wichtigen Inselfestung Malta auf, die sie beinahe eroberten. Im Sommer 1570 landeten türkische Truppen auf Zypern und nahmen es im Lauf eines Jahres ein. Gleichzeitig häuften sich an der Ostküste Spaniens die Überfälle von Piraten und Morisken, die nicht selten bis tief ins Landesinnere vordrangen, während in Ungarn die Osmanen weiter Boden gutmachten und das Heilige Römische Reich bedrohten. In den 1550er und 1560er Jahren kam es zu schweren Kämpfen, die sich nach einem langen Waffenstillstand in den 1590er Jahren fortsetzten. Erst durch den Frieden von Zsitvatorok im Jahr 1606 wurde die osmanische Bedrohung Mitteleuropas vorübergehend aufgehoben.
Während sie das Hauptangriffsziel des osmanischen Plans einer Universalmonarchie waren, entwickelten die Habsburger eigenen Ehrgeiz. Tatsächlich begründeten sie ihren Anspruch auf die Führung der Christenheit zum Teil mit der Notwendigkeit der Einheit des Westens im Kampf gegen die Türken. Die Wahl des Habsburgers Karls V. zum römischen Kaiser im Jahr 1519 prägte die europäische Geopolitik der nächsten drei Jahrzehnte.40 Er herrschte nicht nur über Spanien, Neapel, die Niederlande, Österreich und Böhmen, sondern auch über ein wachsendes Kolonialreich in der Neuen Welt. Ein spanischer Bischof bezeichnete Karl V. deshalb als »von Gottes Gnaden … König der Römer und Kaiser der Welt«. Eine Universalmonarchie unter Karl V., in der Habsburg über eine vereinte und wieder einheitliche katholische Christenheit herrschte, schien eine realistische Möglichkeit zu sein.41 Erst nach rund dreißig Jahren voller Kämpfe gegen das Osmanische Reich, Frankreich, deutsche Staaten und sogar England war Karl V. gezwungen, den Ehrgeiz, über ganz Europa zu herrschen, aufzugeben.
Binnen weniger Jahrzehnte erwies sich sein Sohn, Philipp II. von Spanien, indes als mindestens ebenso ehrfurchtgebietend wie er. Philipp besiegte in der Seeschlacht von Lepanto die Türken, übernahm die Herrschaft über Portugal und sein Kolonialreich, kolonisierte die Philippinen, erhöhte die Einnahmen aus der Neuen Welt beträchtlich und war eine Zeitlang sogar englischer Prinzgemahl. Auf die Rückseite einer Gedenkmünze für die Vereinigung der Kronen von Spanien und Portugal prägte man die Worte »Non sufficit orbis«, die Welt ist nicht genug, und auf einem spanischen Triumphbogen wurde der König als »Herr der Welt« und »Herr über alles in Ost und West« bezeichnet.42 Wie sein Vater scheiterte Philipp jedoch letzten Endes, erschöpft vom Kampf gegen die holländischen Rebellen und bekümmert über den katastrophalen Ausgang der Expedition der spanischen Armada gegen England. Ihren Ehrgeiz, über Europa zu herrschen, gaben die Habsburger jedoch nicht auf. Während des Dreißigjährigen Kriegs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren die vereinten Anstrengungen Frankreichs, Schwedens, deutscher Staaten und am Ende auch Englands nötig, um den österreichisch-spanischen Versuch zu vereiteln, sich den Kontinent untertan zu machen.