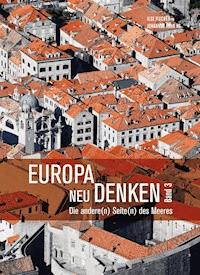
Europa neu denken III E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet Salzburg
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Europa neu zu denken setzt die Beantwortung der Frage voraus, welches Europa wir eigentlich wollen. Die Zukunft ist nicht etwas, das sich ohne unser Zutun quasi von selbst ereignet. Sie ist vielmehr etwas, das erst durch unser eigenes Mitwirken, durch unser Wissen und Nichtwissen, unsere Hoffnungen und Befürchtungen Gestalt annehmen kann. Die einzelnen Beiträge sind überarbeitete Fassungen zweier Tagungen, die in Triest stattfanden. Drei Problembereiche werden diskutiert: Das Laboratorium Europa, Europäische Künste, Erzählungen, Sprachen sowie Europäische Lebenswelt und Raum. Dabei spielen die Dialektik von Herkunft und Zukunft sowie die Kreativität von Widersprüchen und Synergien eine große Rolle. Mit Beiträgen von Henning Ottmann, Helga Rabl-Stadler, Hedwig Kainberger, Rut Bernardi, Claudio Magris, Volker Gerhardt, Christiane Feuerstein, Blanka Stipetic u. v. m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EUROPA NEU DENKEN Band 3
Die andere(n) Seite(n) des Meeres
Ilse FischerJohannes Hahn (Hg.)
Dank für die Unterstützungzur Durchführung des Projekts:
www.europa-neu-denken.com
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2016 Verlag Anton Pustet5020 Salzburg, Bergstraße 12Sämtliche Rechte vorbehalten.
Titelbild: Fotolia, ©monticellllo 2016Foto M. Fischer: ©LEO/Andreas Kolarik FotografieGrafik, Satz und Produktion: Tanja KühnelLektorat: Dorothea Forster, Gail Schamberger
ISBN Printausgabe 978-3-7025-0846-3 e-ISBN 978-3-7025-8033-9
www.pustet.at
Inhaltsverzeichnis
Ilse Fischer: Einleitung und Dank
Margarethe Lasinger: Nachbarschaftliche Grenzüberschreitungen
Hedwig Kainberger: In und um Dubrovnik überlebt das Empfindliche
Der Anfang von allem. Der Mensch und das MEER. Philosophie. Identitäten
Raimund Schulz: Die Antike und das Meer
Ilma Rakusa: Danilo Kiš, Dubrovnik und das Meer – oder Kosmopolitismus als Lebensart
Konstantinos Kosmas: Düstere Meeresbilder: Finanzkrise, Flüchtlinge und die Flut
Silvana Ballnat: Der Mensch im steten Dialog. Wahrnehmung und Sprache
Erinnerungspassagen. Das MEER erlesen
Alida Bremer: Europa maris mediterranei oder: Wo liegt eigentlich der Balkan?
Arian Leka: Again the sea … Obstacle and Opportunity
Rumena Bužarovska: Between the Mediterranean and Europe. The Case of Macedonia
Nedžad Ibrahimović: Pannonica – Gründe für eine prä-europäische Nostalgie
Alida Bremer: Erinnerungen eines kroatischen und eines serbischen Matrosen
Saša Ilić: Die Untergegangenen und die Geretteten. Ein Blick auf Europa vom Meer aus gesehen – im Jahr 1991
Tvrtko Jakovina: Soll ich wirklich hier bleiben? Boka Kotorska vor dem Krieg 1991 – Erinnerungen eines kroatischen Marinesoldaten
Laboratorium Europa. MEER. Musik. Lebenskunst. Architektur
Jan Tabor: traktat über die unerlässlichkeit, eine hauptsächliche stadt für die vereinigten staaten von europa zu errichten
Boris Podrecca: Das Andere im Gleichen. Bauen im mitteleuropäischen Küstenland
Ivana Prijatelj Pavičić: Eigenständigkeit und Nachahmung in der dalmatinischen Küche und Kunst
Vjera Katalinić: Music migrations between Central Europe and the Mediterranean: Changes in Croatian lands between the two revolutions (1789–1848)
Nach Europa. Über das MEER
Dieter Richter: Das Meer und seine Toten
Gentian Shkurti: Break on through (to the other side). Go West – video game art
Krsto Lazarević: Auf dem Wartegleis – Der beschwerliche Weg durch Europa
Jeton Neziraj: Das Theater als Haus der Flüchtlinge
Grenzenlose Natur. Transeuropa. MEER. Geschichte. Wirtschaft. Politik. Biologie. Visionen
Svjetlana Krstulović Šifner: Diversity and abundance of the Adriatic teuthofauna
Mirko Đurović: Boundless nature. Die Förderung der Europäischen Union für Programme der internationalen Zusammenarbeit zum Schutz der Biodiversität im Adriatischen Meer
Bruno Ćorić: World economic crisis and the economic perspective of Mediterranean countries in the 21st century
Tvrtko Jakovina: The Mediterranean in continuous crisis. Small nations, big sea, decades of crisis no one can solve?
Ricarda Vidal: Atlantropa: A Dam across the Mediterranean as a Solution to War and Crisis
Ausblicke
Gerard Mortier: Die kulturelle Identität Europas
Sven Hartberger: Europa in der Kunst leben – Gerard Mortiers Gedanken über die kulturelle Identität Europas
Helga Rabl-Stadler: Welches Europa wollen wir eigentlich?
Johannes Hahn: Der Weg der EU in Bezug auf Südosteuropa – Herausforderungen und Perspektiven
Autorinnen und Autoren
Einleitung
Ilse Fischer
Das Symposion »Europa NEU denken« im Oktober 2015 in Dubrovnik war das erste, das den Untertitel »Michael Fischer Symposion« trug. Das bedeutet, dass der, der es gegründet und so erfolgreich gemacht hat, nicht mehr dabei sein kann: Universitätsprofessor DDr. Michael Fischer, mein wunderbarer und jetzt so schmerzlich vermisster Mann, der mir Liebe und Leben war.
Der altgriechische Ausdruck »Symposion« steht sinngemäß für »gemeinsames, geselliges Trinken«. Aus dieser Bedeutung hat sich dann der Begriff für wissenschaftliche Konferenzen entwickelt. Für Michael Fischer waren seine Symposien beides: anregende Wissenschaft und ebensolche Begegnungen – sowie immer auch ein geselliges Miteinander.
Er war ein Genussmensch im allerbesten Wortsinn. In seinem Genießen verband er Wissenschaft, Kochkunst, die Liebe zur Oper, zur Kunst und zu interessanten Menschen.
Einen »Menschensammler« nannte Helga Rabl-Stadler ihn in ihrer berührenden Rede in der Kollegienkirche beim Requiem im Jahr 2014. Das trifft es sehr genau. Mit leidenschaftlichem Engagement und unglaublicher Kennerschaft führte er Menschen zusammen, ließ Visionen aufblitzen, die dann zu spannenden Büchern, Symposien, Vorlesungen und Seminaren für seine StudentInnen führten. Das geschah an unserem Esstisch daheim in Anif genauso wie an den Opernhäusern in Berlin, Paris oder Madrid.
Hier und dort wird er immer fehlen.
Er war ein glühender Europäer und nicht nur das verband ihn mit EU-Kommissar Johannes Hahn, mit dem er die Reihe »Europa NEU denken« gegründet hat.
Sein Engagement, vor allem in seinen letzten zehn Jahren, galt der Erzählung der faszinierenden Möglichkeiten eines Europa der Vielfalt. Erzählungen und Mythen über Europa, die erklären wollen, woher wir kommen, wer wir sind und wonach wir streben. »Europa«, schrieb Michael Fischer einmal, »ist aus Erzählungen hervorgegangen – aus den Mythen und Epen der Antike, aus den Geschichten der unterschiedlichen Kulturen, aus den narrativen Schöpfungen der Literatur, der Künste und der Wissenschaften. In ihnen fand Europa seine geistige Identität, aus ihnen wurden seine Kulturen geschaffen, durch sie gewann es Einheit und Vielfalt.«
Den Bogen, den ich gemeinsam mit denjenigen, die mich so wunderbar unterstützen, gespannt habe, hätte er wohl mit Begeisterung verfolgt und die Fäden dann – wie er es so perfekt gekonnt hat – am Ende zu einem großen Ganzen verbunden.
Der Unfassbarkeit seiner Abwesenheit, die ich und all jene spüren, die seinen Lebensweg auf die eine oder andere Weise mit ihm gegangen sind, wollen wir mit diesem Band und mit der Weiterführung der Reihe »Europa NEU denken« entgegenwirken. Wenn die geliebten Menschen, die wir verloren haben, präsent bleiben, dann ist der Weg, den wir gemeinsam gehen, wohl der richtige. Die Trauer über seinen Tod überwiegt, aber die Möglichkeit, seine Intellektualität und seinen Geist lebendig zu halten, ist ein Sonnenstrahl in die Zukunft. Sein Denken wird uns dabei begleiten.
Ilse Fischer, im April 2016
Dank
Mein Dank gilt vor allem Margarethe Lasinger, die mein Mann so sehr schätzte und die jetzt so viele kluge Ideen in Hinblick auf die Fortsetzung unseres gemeinsamen Projektes hat. Mein Dank gilt Hedwig Kainberger, Helga Rabl-Stadler und Claudio Magris, die mit mir Michael Fischers Gedanken lebendig halten. Und mein Dank gilt Inge Schrems, die so viele Jahre mit ihm an der Universität, bei den »Festspiel-Dialogen« und vielen Symposien gearbeitet hat und nun mit mir gemeinsam seine Arbeit fortsetzt.
Danken möchte ich auch und ganz besonders Johannes Hahn und Andreas Kaufmann, die an meiner Seite sind, bei vielem.
Nachbarschaftliche Grenzüberschreitungen
Margarethe Lasinger
Als wir – Ilse Fischer, Hedwig Kainberger und ich – im Frühsommer 2015 im Café Bazar in Salzburg am Feinschliff der vierten Ausgabe des Symposions »Europa NEU denken« arbeiteten, hatte uns eine neue Realität längst eingeholt. Uns gegenüber saß Salim Chreiki, ein in seiner früheren Heimat höchst erfolgreicher und bekannter Schauspieler. Er war – wie viele Hunderttausende andere auch – aus Syrien geflohen und nun unweit von Salzburg in einer Flüchtlingsunterkunft gestrandet.
Mit Händen und Füßen, einigen englischen Floskeln und ein paar Brocken Deutsch erzählte er von seiner Flucht, von seinen Ängsten und Hoffnungen und wie er sich sein Leben nun neu denken wolle. Aus einem Notizblock holte er ein Blatt hervor, auf dem er in arabischer Schrift seine Gedanken notiert hatte, und zugleich bemühte er sich, diese in ihm noch fremden Worten und Zeichen darzustellen: »wir haben eine menge von den untergang des syrischen volkes im meer. meer ist gräber von vielen geworden …«, stand auf den Zettel gekritzelt. Mit den schlimmsten Erinnerungen an seine Flucht versuchte sich Salim Chreiki eine neue Sprache anzueignen.
»Das ›Meer‹ steht für Ängste und für Hoffnungen, für Grenzen und Entgrenzung, für die Furcht vor dem Fremden einerseits und unermessliche Vielfalt andererseits«, hatten wir in unserem Einladungstext zum Symposion formuliert. Uns war, als würden wir der Personifizierung all der Fragen, die wir uns im Hinblick darauf stellten, in unserem neuen Nachbarn gegenüberstehen.
Und dann also Dubrovnik, das sich uns bei der Ankunft sommerlich warm zeigte und prächtig funkelte. Doch bald schon verfinsterte sich der Horizont und heftige Stürme peitschten die See auf – »ungeheuer, ungezähmt, unermesslich« hatten wir in unserem Text geschrieben. Uns war, als wolle sich das Meer in seiner gewaltigsten Eigenart präsentieren, während Dieter Richter über die Angst vor dem Meer referierte und uns von staunenswerten Zeremonien berichtete, um dem anonymen maritimen Tod zu begegnen und dem Meer zu trotzen – »einem Gegner, von dem es in Homers Odyssee heißt: ›Denn nichts Schrecklicheres ist mir bekannt, als die Schrecken des Meeres‹«.
Ohne Meer jedoch kein Abenteuer, keine Bewährung, keine Entwicklung, repliziert Raimund Schulz zum Auftakt in seinem Beitrag über die Hassliebe zum Meer. Und Konstantinos Kosmas macht uns die bedenkliche Metaphorik des Wasservokabulars und der Meeresbühne im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Flüchtlinge deutlich. Bilder, die sich in diesem Sommer in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt haben, lässt Krsto Lazarević in seinem Beitrag vor unseren Augen wiedererstehen. Den Schreckensbildern stellt Ricarda Vidal die Utopie eines historischen Großprojekts gegenüber: Herman Sörgels »Atlantropa«-Vision. In der Neudeutung einer solchen Utopie befasst sich Jan Tabor mit der Gründung einer supranationalen europäischen Metropole.
Von einer naturwissenschaftlichen Seite untersuchen die Meeresbiologen der Universitäten Crna Gora und Split die Grenzenlosigkeit des Meeres und stellen ihr inter-institutionelles Netzwerken im Dienste der grenzüberschreitenden Erforschung dieses besonderen Ökosystems, um dessen Biodiversität zu schützen, dar.
Alida Bremer betrachtet mit ihren Schriftstellerfreunden aus Südosteuropa die widersprüchliche Erörterung der Idee Europa aus der Sicht der EU-Nachbarstaaten. »Das Mittelmeer, der Orient und der Balkan sind nicht nur dank der Neigung der Westeuropäer, diese Räume auf vergleichbare Art zu mystifizieren, in einem unlösbaren Verhältnis miteinander verbunden. Dort, wo sich diese Gebiete – ob imaginiert oder real – überlagern, wie etwa in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, entstehen Konflikte um Deutungen, Zuschreibungen und Abgrenzungen«, schreibt sie.
Arian Leka (Albanien) etwa berichtet von seinen sehr persönlichen Träumen, seiner naiven Idolatrie. Dem ehemals sehnsüchtigen Blick über das Meer nach Europa setzt er den heute skeptischen entgegen: jenen auf Xenophobie und Menschenhatz und auf das Auseinanderdriften von West und Ost, von Wir und Ihr. Jeton Neziraj (Kosovo) spürt der Rolle des Theaters in Krisensituationen nach; Nedžad Ibrahimović (Bosnien und Herzegowina) beschreibt die Ursachen der prä-europäischen Nostalgie, die Devastierung des Geistes und die verzweifelte Konstruktion von Zufluchtsorten in der Literatur – und Rumena Bužarovska den Fall Mazedonien: Sie zeigt auf, wo die Traditionen des Orients auf jene des Okzidents treffen und wie anhand der Öffnung historischer Routen eine Integration der Nationalstaaten gelingen könnte.
Saša Ilić (Serbien) schließlich wirft in seinem Beitrag die Frage nach dem Erinnern der Kriegserlebnisse und der Überwindung von Traumata unter neuen Bedingungen auf. Er erzählt von seinen Erfahrungen als Matrose im Krieg an der Adria. Den dokumentarischen Notizen aus dem Logbuch des Matrosen stellt er Fakten aus der Zeit des Seekriegs gegenüber. Traum und Trauma verbinden sich bei seiner Wiederbegegnung mit Dubrovnik.
Auf diese berührenden Erinnerungen antwortet seinerseits Tvrtko Jakovina (Kroatien) mit Tagebucheitragungen und Briefen aus seiner Militärzeit bei der Marine kurz vor Ausbruch des Kroatienkrieges. – Mit ihren Aufzeichnungen entführen die beiden uns mitten in jenen Konflikt, dessen Spätfolgen uns heute beschäftigen. Sie lassen uns nicht nur an ihrer Geschichte teilhaben, sondern an der Geschichts-Schreibung und uns damit ihre Erfahrungen begreifen.
In seinem historischen Beitrag analysiert Jakovina zudem den Status quo, die weltweiten Verflechtungen sowie die historischen Hintergründe der Krise im Mittelmeerraum. »Jener Teil der Welt, der die ältesten Zivilisationen, einige der schönsten Städte und schmackhafteste Nahrung aufzuweisen vermag, sieht sich mit Problemen konfrontiert, die von epischen Ausmaßen zu sein scheinen.«
Bruno Ćorić (Kroatien) zeigt auf, wie die wirtschaftliche Rezession den Mittelmeerländern in höherem Maße zusetzte als dem Epizentrum der Weltwirtschaftskrise und dass nur Investitionen in die Bildung eine Entwicklung zur Demokratie beschleunigen können.
Darauf bezieht sich auch Kommissar Johannes Hahn in seinem Vortrag: »Die Herausforderung der Stabilisierung im Mittelmeerraum wird uns die nächsten Jahre begleiten … Ich glaube, wir werden sie nur meistern, wenn wir parallel zu den notwendigen politischen Maßnahmen auch ganz massiv in die Entwicklung einer Zivilgesellschaft investieren.«
Von einem, der schon früh vor den Gefahren des Nationalismus in Jugoslawien warnte und sich gegen unüberlegte Zuschreibungen verwehrte, schreibt Ilma Rakusa. Der bedeutende europäische Erzähler Danilo Kiš setzte der Einengung und der Begrenzung das »ozeanische Gefühl«, eine durch und durch weltoffene Haltung entgegen, wie sie eindrücklich aufzeigt.
Ein solches »ozeanisches Gefühl« beseelte auch Gerard Mortier, den ehemaligen Intendanten der Salzburger Festspiele, dessen Denken Sven Hartberger nachspürt. Er führt uns einen großen Europäer vor Augen, der seine schöpferische Kraft »nicht zuletzt aus der gelungenen Vereinigung vieler kultureller Gegensätze zog, welche in ihrer Gesamtheit wiederum die Identität Europas ausmachen«.
Boris Podrecca umschreibt diese Vielheit für seine Architektursprache als »Poetik der Unterschiede«. »Die Poetik der Unterschiede führt mich zu einprägsameren Beziehungen von Stadt, Landschaft und Mensch, wodurch der Transfer der Andersheit erreicht werden kann.« Ivana Prijatelj Pavičić geht einer solchen Poetik der Ambivalenz in den Grenzüberschreitungen in bildender Kunst und Gastronomie auf den Grund, und Vjera Katalinić dem Kulturtransfer zwischen Zentraleuropa und dem Mittelmeerraum, der durch Musik und Musiker erfolgte.
Distanz versus Nähe, Bedrohung versus Verheißung, Diversität versus Kongruenz, Eingrenzung versus Migration – um diese grundlegenden Ambivalenzen kreisen sämtliche Beiträge. Das Ambivalente beschreibt einerseits die Metaphysik des Meeres, aber auch jene Traumgestalt von einem Europa, die so viele zu erreichen suchen. Gentian Shkurti (Albanien) etwa verglich sie gar mit einer Geliebten, die aber – heftig umworben – unerreichbar bleibt. »Für uns Albaner ist die Beziehung zu Europa eine noch nicht realisierte Liebesgeschichte – Break on through, to the other side«.
»Europa neu zu denken setzt die Beantwortung der Frage voraus, welches Europa wir eigentlich wollen«, hielt Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in ihrem Referat in Dubrovnik gleich zu Beginn fest. Dies zu diskutieren und physische und immaterielle Grenzen im europäischen Raum zu überwinden, fanden wir uns im Gedenken an Michael Fischer in Dubrovnik zusammen. Anhand der »anderen Seite(n) des Meeres« betrachteten wir die widersprüchliche Erörterung der Idee Europa und trafen auf nachbarschaftliches Verständnis, auf kritischen Dialog und auch gegensätzliches Wahrnehmen. »Wahrnehmung ist ein Dialog zwischen Menschen und ihrer Umwelt«, erläutert Silvana Ballnat und beschreibt die Voraussetzungen des Dialogs als ein stetiges Zwischen – »zwischen Offenheit und Vorurteilhaftigkeit, zwischen Endlichkeit und Selbsttranszendenz, zwischen Freiheit und Gesetz, Meer und Land. Denn der Mensch lebt im steten Dialog …«. Das hätte auch Michael Fischer so gesehen.
Was ist die Verheißung Europas, die nicht eingelöst wurde, dürfen wir mit Claudio Magris abschließend fragen – »das fehlende Wir-Gefühl«, antwortete Michael Fischer damals. – In Dubrovnik haben wir in den vielen Gesprächen rund um die Vorträge, bei den gemeinsamen Essen und Gedankenspaziergängen ein ganz besonderes Wir-Gefühl erlebt. Wir haben unüberlegte Zuschreibungen hinterfragt und damit uns und unsere Nachbarn und die jeweiligen Befindlichkeiten neu gedacht, wir wurden zu Teilhabern ihrer Geschichten und unserer Geschichte.
Und nur so, »mit kulturellen Tugenden wie Einfühlungsvermögen und Empfindsamkeit, nur mit Eröffnen von Gedankenräumen statt Erobern von Wirtschaftsräumen«, stellt Hedwig Kainberger fest, wird die Bewährungsprobe der EU in Südosteuropa zu bestehen sein.
In und um Dubrovnik überlebt das Empfindliche
Hedwig Kainberger
Etwas außergewöhnlich Empfindliches hat in der Gegend von Dubrovnik überlebt. Es ist rund und flach, vermittelt das Gefühl muskulöser Alertheit, schmeckt meerig, muschlig sowie algig und erregt – was für eine Speise selten ist – alle verfügbaren Geschmackspapillen von Wangeninnenseiten, Gaumen, Zunge bis tief in den Rachen hinunter mit einer kräftig-zarten, ernsten, ganz und gar unsüßen Vielfalt.
Dieses genießbare Empfindliche, eine der Spezialitäten in Dubrovnik, ist die Europäische Auster. In vielen ihrer einstigen Heimaten, wie im Norden Deutschlands oder auf Sylt, ist sie seit Jahrzehnten ausgestorben, weil sie die robustere Pazifische Auster verdrängt hat oder weil ihr Verschmutzung und Krankheitserreger den Garaus gemacht haben. Bei Dubrovnik hingegen, in der Bucht von Mali Ston, wird sie gezüchtet und kann kulinarischen Feinspitzen kredenzt werden.
Hier um Dubrovnik wird noch etwas in uralter Methode gewonnen, was einst als »weißes Gold« Europas gegolten hat: Salz. Die in den flachen Becken der Salzgärten gewonnenen Salzblüten, die der Maestral, die Tramuntana und andere Winde der Adria aus dem Meerwasser herausdunsten, betonen pikante Speisen. Den zart-süßen Gusto hingegen bedienen ein Törtchen namens Smokvenjak oder ein fast schwarzes, fast amorphes Dessert – beides uralte Köstlichkeiten, weil sie natürlich fruchtig süß und ohne industriell raffinierten Rübenzucker zubereitet sind. Smokvenjak besteht aus Feigen und Walnüssen, manchmal auch mit Cognac verfeinert; das erwähnte Dessert wird aus reduziertem Traubensaft, Nüssen und Orangenschalen hergestellt.
Warum so viel vom Essen? Weil Traditionelles, Empfindliches und Geschmackvolles, das noch dazu die Menschen gern miteinander und frisch genießen, so gut zu dem passen, was Michael Fischer mit Konferenzen und Symposien hat bewirken wollen. Wo eine fast ausgestorbene Auster überlebt, wo Früchte nicht bloß haltbar gemacht, sondern miteinander komponiert werden, wo regional Spezifisches frisch und delikat zubereitet wird, ist der passende Ort für das Nachdenken über ein großes Manko der Europäischen Union. Deren politischer Dimension mangelt es nicht an Wirtschaft und Währung, nicht an Handel und Freizügigkeit von Arbeitskraft und Kapital, sondern an Kultur. Europa aus der Kultur heraus und in die Kultur hinein zu denken ist Auftrag und Sehnsucht der Symposien »Europa NEU denken«.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges und der darauf folgenden Osterweiterung von NATO und EU hat sich die neuralgische Zone Europas auf die Gegend zwischen Adria, Ionischem Meer, Ägäis und Schwarzem Meer verlagert. Welche Unterschiede treffen hier aufeinander! Welches Konfliktpotenzial brodelt in der nach dem größten Gebirgszug, dem Balkan, benannten Halbinsel, wobei allerdings die Literaturwissenschaftlerin Alida Bremer auf Probleme und Missverständnisse in und um Begriffe wie »Balkan«, »West-Balkan« und »Balkanisierung« hinweist.
Im Südosten Europas funktioniert das mit geografischen Linien abgrenzbare und von jeweiligen Landessprachen bestimmte Konzept des Nationalstaates schlecht; Staaten und Ethnien sind hier oft nicht kongruent. Nirgendwo sonst in Europa ist der Islam seit so vielen Jahrhunderten derart verbreitet und verwurzelt wie etwa in Bosnien und Herzegowina, Albanien, im Kosovo oder in Mazedonien; und Dubrovnik war lange die wichtigste Handelsstadt und somit Verbindungspunkt zwischen Europäern und Osmanen. Das Christentum hat im Südosten mehr Ausprägungen als sonst in Europa – von starker römisch-katholischer Prägung wie in Kroatien bis zu orthodoxen Nationalkirchen wie in Serbien und Griechenland. Auch wenn im Zweiten Weltkrieg und im Bosnienkrieg Tausende Juden ermordet und vertrieben wurden oder geflohen sind, ist Sarajevo noch heute eine Stadt aller drei Weltreligionen – mit Moscheen, Kirchen und Synagogen.
Sofern Kulturtouristen in Europa das Wort »Krieg« in Kurzbeschreibungen in Reiseführern finden, bezieht sich das meist nur auf etwas in tiefer Vergangenheit. Doch jeder noch so konzise historische Überblick für die zumindest zweieinhalb Jahrtausende währende Geschichte in Dubrovnik nennt 1991/92 als markante Jahreszahl und dazu »Belagerung«, »Kriegsschiffe« und »Luft-, Artillerie- und Mörserangriffe« – alles Begriffe, die in der Europäischen Union zwar nicht fremd geworden sind, doch weit in die Vergangenheit oder in eine andere Weltregion gehören. Einige Teilnehmer kamen für dieses Symposium »Europa NEU denken« zum ersten Mal seit diesem Krieg wieder nach Dubrovnik – wie die Schriftstellerin Ilma Rakusa.
Kann die als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg begonnene und mit der Europäischen Union nach und nach institutionalisierte europäische Integration auch in Südosteuropa stabilen Frieden bringen? Macht die von Tausenden Flüchtlingen auf ihrem Weg nach Europa begangene »Balkanroute« deutlich, dass die EU in ihrem Südosten beginnt? Ergibt sich allein aus dem Blick auf eine Landkarte, dass die Region zwischen dem Mitglied Griechenland und den Mitgliedern Ungarn, Kroatien und Slowenien ebenfalls in die EU passt? Zeugt es auch für Zugehörigkeit, dass seit den 1990er-Jahren über eine Million aus dem ehemaligen Jugoslawien und Albanien Ausgewanderte in der EU leben (laut Schätzungen des WIIW, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche)? Ist die Einladung an Montenegro zum NATO-Beitritt der erste Schritt für dieses Land in Richtung Kandidatenstatus als EU-Mitglied?
Solche tagesaktuellen Fragen schweben beim vierten Symposium Europa NEU denken nur im Hintergrund. Hier wird – nach Claudio Magris, Fulvio Tomizza und Boris Pahor in den Vorjahren – etwa an den Schriftsteller Danilo Kiš erinnert. Ihn beschreibt der Biograf Mark Thompson als Mitteleuropäer.1 Im Sinne Danilo Kiš’ ist »Mitteleuropa« jedenfalls antinationalistisch, doch ökonomisch, kulturell und politisch ist es ein schwammiger, undeutlicher Komplex – von einigen ersehnt, von anderen gehasst.
Im Zusammenhang mit Danilo Kiš und Mitteleuropa zitiert Mark Thompson einen faszinierenden Gedanken von Claudio Magris: In den Städten Mitteleuropas sei etwas zu spüren, das nicht verwirklicht worden sei, durch das sie allerdings etwas wahrhaft Großes und Wunderbares hätten werden können. Worin besteht diese nicht eingelöste Verheißung? Was ist es, was dieses Mitteleuropa nicht geworden ist, weil viele Kriege und Streitereien dies vergällt haben? Und wie kostbar wäre es, diese Verheißung zu entschlüsseln! Vielleicht steckt in dieser von Claudio Magris angedeuteten Verheißung das, was Michael Fischer am Beginn des ersten Symposions »Europa NEU denken« in Triest als unser großes Manko in Europa festgestellt hat: »Aber das Wir-Gefühl fehlt.«
Europa von der Kultur heraus und in die Kultur hinein zu denken gelingt nicht allein mit Hilfe von Literaten und Philosophen. Auch der Architekt Boris Podrecca ist so ein Europäer, der im Denken keine Grenzen überschreiten muss, weil er sowieso grenzenlos denkt und wirkt. Oder der Theatermacher Jeton Neziraj aus Priština: Seine mehr als 15 Theaterstücke wurden in etwa zehn europäische Sprachen übersetzt und in vielen europäischen Städten aufgeführt; in Peer Gynt aus dem Kosovo vermittelt er – inspiriert von Henrik Ibsens Drama – mögliche Eindrücke aus Träumen, Albträumen und Irrfahrten im heutigen Europa. Oder der Historiker Tvrtko Jakovina: Er erinnert an eine andere, im Vergessen versinkende, doch für das Verständnis für Südosteuropa entscheidende grenzüberschreitende Idee: die vom jugoslawischen Präsidenten Josip Broz Tito einst initiierten »Blockfreien Staaten«.
Sollen mit der europäischen Integration der Nationalismus und folglich die Nationalstaatlichkeit abzuschwächen sein, soll in Europa ein Zusammenleben von vielen Religionen möglich werden, soll eine Geschichte des Krieges überwunden werden, sollen sich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit europaweit durchsetzen, soll die kulturelle Vielfalt ein Wesensmerkmal Europas bleiben, so wartet nun auf die EU in ihrem Südosten – nach ihrer Gründung sowie nach Währungsunion und Osterweiterung – die dritte historische Bewährungsprobe. Nur mit kulturellen Tugenden wie Einfühlungsvermögen und Empfindsamkeit, nur mit Eröffnen von Gedankenräumen statt Erobern von Wirtschaftsräumen wird sie zu bestehen sein.
Endnote
1 Mark Thompson, Geburtsurkunde. Die Geschichte von Danilo Kiš. Aus dem Englischen von Brigitte Döbert und Blanka Stipetić, München 2015.
Der Anfang von allem.Der Mensch und das MEER. Philosophie. Identitäten
Die Antike und das Meer
Raimund Schulz
Odysseus
»Wir sind ein Seefahrervolk und haben keine Angst, aufs offene Meer zu fahren«, so sprach der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras am 5. Juli 2015 seinen Landsleuten Mut zu.1 Dann verwies er auf Odysseus, den Prototyp des wagemutigen Seefahrers. Odysseus ist – so Homer zu Beginn des großen Epos – der »vielgewanderte« und der »vielgewandte«:2 Er besitzt die Fähigkeit, sich durch Anpassung, Intelligenz, List und Zähigkeit zu behaupten, Niederlagen und Verluste zu verkraften, ohne sein Ziel aus dem Auge zu verlieren. Kann es für Politiker ein besseres Vorbild geben? Manche ergänzen, dass Odysseus sich im Laufe seiner Irrfahrten selbst entdeckt, die Abenteuer auf dem Meer mit einem charakterlichen Selbstfindungsprozess einhergehen. Nicht zufällig haben die Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno Odysseus zum Leitbild eines neuen Typs von Intelligenz gewählt.
So vielfältig der Charakter des großen Helden ausgedeutet werden kann, alles benötigt die Folie des Meeres: ohne das Meer keine Abenteuer, keine Bewährung, keine Entwicklung und auch kein glücklich erreichtes Ziel. Mehr als einmal bekennt Odysseus, dass ihm das Meer verhasst ist. Tief im Gemüt – so Homer – erduldete er unendliche Leiden. Dass er an diesen Leiden nicht zerbrach und seine Angst überwand – erst das macht ihn zum wahren Helden.
Das Meer als Ort des Schreckens und der Chancen
Das Verhältnis des Odysseus zum Meer enthält eine zentrale Botschaft der Antike: Nicht nur den frühen Griechen, auch anderen Kulturen galt das Meer als Ort des Schreckens, tödlich wie ein gegnerisches Heer3, menschenfeindlich und unberechenbar, Sinnbild des Bösen und Launenhaften. »Drei Übel gibt es in der Welt« – so ein Komödienschreiber des 5. Jahrhunderts v. Chr. – »das Meer, das Feuer und das Weib«4. Tollkühn, närrisch odernotgeboren ist es, sich ihm anzuvertrauen: »Wer da das Meer befährt, muss melancholisch sein/ oder ein Bettler oder lebensmüde«, fügt ein anderer Dichter hinzu.5 Das Meer ist das Reich der Toten und der Sünden und aus dem Meer werde einst – so die Johannesapokalypse – das gottfeindliche Tier erscheinen.6 Das Meer als Ort der Kontemplation oder gar der sportiven und sinnlichen Erholung – all das war der Antike fremd, allenfalls betrachtete man zufrieden das Meer vom Strand aus, weil man eine Seefahrt überstanden und sich wieder in der Sicherheit des Landes wähnte. Angst und Schrecken ließen ein romantisches Naturgefühl erst gar nicht aufkommen.
Doch was trieb die Menschen der Antike dennoch immer wieder – wie Odysseus – aufs Meer und befähigte sie, ihre natürliche Angst vor dem Element zu überwinden? Zunächst einmal die Lebensumstände: Die mediterrane Zivilisation der Antike war im Gegensatz zu den Hochkulturen Chinas und Indiens eine von Städten geprägte Küstenkultur. Ob Athen, Rom, Karthago, Konstantinopel, Alexandria oder Syrakus – alle großen Städte lagen am Meer oder besaßen küstennahe Verbindungen, und das nicht von ungefähr: Denn nur selten reichten die heimischen Agrarprodukte aus, um die Ernährung zumal größerer Gemeinden zu sichern. Fisch und Frutti di mare mochten das Nahrungsmittelangebot ergänzen, die wichtigsten naturalen Ressourcen wie Getreide mussten jedoch für eine wachsende Zahl von Menschen über das Meer importiert werden: aus den Anbauflächen am Nil, aus Sizilien und dem Nordschwarzmeerraum.
Hinzu kam der eklatante Mangel an wertvollen Metallen, die man zum Aufbau von Armeen, der Ausgestaltung der Paläste und der Herstellung von Kunstprodukten und Tempelwerkzeugen brauchte. Auch sie waren im Mittelmeerraum selten und ungleich verteilt: Kupfer und Eisen gab es auf Zypern, in Norditalien sowie an der Nord- und Südküste Kleinasiens, Gold und Silber vor allem im südlichen Spanien und in Nubien, Zinn musste aus Nordeuropa herangeschafft werden.
Und schließlich als dritte Produktpalette, die meist nur über den Seeweg zu bekommen war: exotische Gewürze und Pflanzen für den Tempeldienst, für die Arzneikunst sowie für die Führung eines luxuriösen Lebens – an erster Stelle: Weihrauch und Myrrhe aus Südarabien und Somalia und schon bald Pfeffer aus Indien und Seide aus dem fernsten Osten.7
Die Eroberung des Meeres
Seit der Bronzezeit konnte es sich kein Herrscher leisten, auf diese Produkte zu verzichten. Nur wer sie am eigenen Hofe präsentierte und für eigene Zwecke verwendete, bewies sich als omnipotenter Herrscher, dessen Arm bis zu den Welträndern reichte. So brachen immer wieder Kapitäne nicht nur aus den mediterranen Küsten, sondern auch von den Nordküsten des Roten Meeres und dem Zweistromland auf, um an die Schätze heranzukommen. Ihre Herkunftsgebiete wurden zu Wunderländern am Rande der Welt, wie das goldreiche Tartessos am Guadalquivir, Punt und Kusch in Arabien (oder Somalia), Dilmun als Umschlagplatz des fernöstlichen Seehandels und Zwischenstation auf dem Weg nach Mackhan, womit wohl die Induskultur gemeint war.
Große Territorialreiche wie das pharaonische Ägypten, die Assyrer, Babylonier und Perser mussten allerdings mit ihren Kräften und den Risiken haushalten: In dem Maße, in dem sie große Landarmeen zur Verteidigung und Erweiterung ihres Herrschaftsgebietes unterhielten, versuchten sie die kostspielige und technisch anspruchsvolle Seefahrt auf kleinere Küstengemeinden abzuwälzen, die traditionell ein sehr viel engeres Verhältnis zur See hatten. Für diese war das Meer gleichermaßen ein Ventil innerer Spannungen und Überlebensgarantie in der Welt viel mächtigerer Nachbarn. Griff ein überlegenes Landheer an, konnten sich die Bürger der Küstengemeinden auf die Schiffe retten und zur Not emigrieren; gab es innere Streitigkeiten, zwang man eine Partei zur Auswanderung, um den Frieden zu wahren. Und schließlich bot allen das Meer die Chance, als Lieferant, Zwischenhändler oder bei der Verarbeitung der begehrten Rohmaterialien reich zu werden.
Aus dieser Konstellation heraus sind die großen Seefahrertraditionen der Phöniker und Griechen erwachsen. Die phönikischen Städte der Levante schickten ihre Seefahrer bis nach Spanien und in den Atlantik, um für die Assyrer und Perser Zinn, Silber und Gold heranzuschaffen und ihre eigenen Kunsthandwerker mit Material zu versorgen. Im Osten unternahm man für den Hebräerkönig Salomon Seeexpeditionen nach Ophir und Punt und angeblich umrundete ein phönikischer Kapitän um 600 v. Chr. im Auftrag des ägyptischen Pharao vom Roten Meer aus Afrika.8 Griechische Abenteurer folgten diesen Spuren durch das Mittelmeer nach Westen an die französische Küste, in die Adria und Spanien; sie erschlossen das unwirtliche Schwarze Meer, wo der Sage nach Jason und seine Argonauten das Goldene Vlies erbeutet hatten.
Andere Kapitäne standen im Dienst des persischen Königs, einer von ihnen fuhr den Indus hinab, segelte dann westwärts bis zum Eingang des Persischen Golfes und umrundete als erster Mensch des Mittelmeerraums die arabische Südhalbinsel, um durch das Rote Meer wieder den Boden Ägyptens zu erreichen.9 Daneben durchkämmten Griechen und Phöniker wie Odysseus und Jason auf eigene Rechnung das Meer, als Seeräuber, Kolonisten- oder Söldnerführer und vor allem als Fernhändler auf der Suche nach neuen Routen und Verbindungen. Es waren griechische Seefahrer, die seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. im Westen durch die Straße von Gibraltar bis nach Nordbritannien kamen und mit dem sagenhaften Thule wahrscheinlich Island erreichten sowie im 1. Jahrhundert n. Chr. im Osten über Ceylon und durch die Straße von Malakka bis ins chinesische Meer vorstießen.10
Hassliebe
Nach wie vor kannten auch sie die Grauen des Meeres, die sich nun allerdings in den Ozeanen jenseits des Mittelmeeres offenbarten. Doch trieb sie eine Mentalität, die auch Odysseus aufbrechen und am Ende mit reichen Schätzen heimkehren ließ: Neugier, Wagemut und ein unerschütterliches Selbstbewusstsein, jede Gefahr zu meistern und sich überall zurechtzufinden – Eigenschaften, die später so typisch für die europäischen Entdecker der Frühen Neuzeit wurden. Aus dem Hass des Odysseus ist eine Hassliebe zum Meer geworden, die viele Seefahrer der Geschichte immer wieder hinaustrieb, wohl wissend um die furchtbaren Grauen der See und dennoch angezogen von der unendlichen Weite und dem Stolz, sich auf dem todbringenden Element behauptet zu haben. Denn anders als auf vergleichbaren Feldern wie z.B. dem Krieg, auf denen der antike Mensch sich dem Tod stellen und seinen Mut beweisen musste, waren im Falle der Seefahrt auch noch Klugheit und Erfahrung gefragt. Erst diese Kombination machte aus der Bewährung auf See eine Kunst, die nicht viele beherrschten.
Genauso ambivalent wie das Verhältnis zum Meer war demnach die Einschätzung der Seefahrt selbst. Schon bei Homer wird Odysseus für seine Taten und den Verlust seiner Kameraden mit einer Sühnefahrt belegt und auch in der Folge sahen manche seinen Drang in die Ferne ähnlich kritisch wie die grenzenlosen Eroberungen Alexanders zu Lande: als Abweichen von der Norm, als Hochmut (Hybris) gegenüber den natürlichen Schranken, welche die Götter menschlichem Tun gesetzt haben.
Die tief sitzende Furcht vor dem Meer mündet in eine Verachtung all derjenigen, die sich dem Element blindlings und ohne Not anvertrauen. Seeleute werden von den landbesitzenden Eliten genauso verachtet wie die Fernhändler, deren Lügen über Reisen in exotische Länder Hörer und Kunden blenden. Adelige Kritik an der Athener Demokratie drückt sich darin aus, dass man ihre wichtigsten Stützen und Befürworter, nämlich die Ruderer der Kriegsschiffe, für politisch unzuverlässig und inkompetent erklärt. Selbst große Philosophen raten deshalb dazu, die Idealstadt fern vom oder ganz ohne Hafen anzulegen, um die Bürger nicht den Verführungen der Seefahrerwelt auszusetzen.11 Doch es sind die gleichen Philosophen und andere Gelehrte, die sehr wohl um die Chancen der Seefahrt wissen, die Kugelgestalt der Erde propagieren und 2 000 Jahre vor Kolumbus eine Westfahrt von Spanien über den Atlantik nach Indien für möglich halten, im Atlantik sogar mit einem neuen Kontinent rechnen.12
Es ist der alte Zwiespalt: einerseits Distanz vor dem Meer und all denjenigen, die ihm ihre Seele verkaufen, andererseits das Wissen darum, welche Möglichkeiten die Seefahrt der Wissenserweiterung, dem Weltverkehr und der Völkerverbindung eröffnet. Seefahrt kann dementsprechend von dem einen als Abkehr vom glücklichen Dasein eines ländlichen Goldenen Zeitalters gebrandmarkt und von anderen als größte Errungenschaft des menschlichen Geistes gefeiert werden, so wie es Sophokles in der Antigone tut. Schiff und Hafen sind Symbole politischer Wirrnis und Lasterhaftigkeit, gleichzeitig beruft man sich auf die Metapher des Staatsschiffes, das der weise Politiker durch alle Stürme der Zeit führt.13 Es ist die ewige und für den mediterranen Menschen so typische Zerrissenheit gegenüber dem Meer und wie so häufig überwiegt am Ende der Reiz, das Vabanque-Spiel zu wagen, das entweder ein nasses Grab oder trockene Reichtümer verspricht.
Das Meer der Christen
Selbst das Christentum konnte sich diesem Reiz nicht entziehen, zumal ihm eine ganz besondere Nähe zum Meer vom Beginn an eigen war. Hatte nicht Jesus den Sturm gebändigt und das Element besiegt, als er über das Wasser des Sees Genezareth schritt? Und hatte der Meister nicht seinen Jüngern aufgetragen, die Frohe Botschaft allen Völkern der Erde zu verkünden? Generationen von Missionaren nutzten wie alle Fernreisenden die großen See- und Handelsrouten. Und sie machten die gleichen existentiellen Erfahrungen mit dem Meer, die schon die alten Schriften und epischen Schilderungen beschrieben hatten.
Als das Schiff des Paulus vor Kreta oder Malta (?) im Sturm versank, mochte er sich an die hebräische Bibel erinnern, die vor der teuflischen Bösartigkeit des Meeres gewarnt hatte. Doch er und viele andere wurden gerettet und lernten die Chancen des gefürchteten Elements schätzen: Christliche Schriftsteller priesen das Meer als göttliches Geschenk, als Vehikel der Mission und Kulturverbindung. Lenkte der Politiker das »Staatsschiff« über die stürmische See, so geleitete nun Christus als Steuermann das aus dem Kreuzesholz gezimmerte »Kirchenschiff« über das satanische Meer. Gott blieb siegreich:14Das Böse des Meeres ist gezähmt und das Gute genutzt. Christliche Seefahrt ist deshalb gottgewollt und der christliche Seefahrer zeigt durch seine Navigationskunst, dass er Anteil am göttlichen Logos hat. Von hier aus verläuft eine direkte Linie in die Zeit des Kolumbus und des Aufbruchs der Europäer über alle Weltmeere.
Wenn demnach heute ein Politiker wie der griechische Ministerpräsident voller Stolz auf die Seefahrertraditionen seines Volkes verweist, dann zeigt er sich nicht nur als Patriot und Europäer, sondern auch – wohl ohne es zu ahnen – als guter Christ. Wer hätte das gedacht?
Literatur
Bringmann, Klaus, Veränderungen des antiken Weltbildes, in: Christof Dipper / Martin Vogt (Hg.), Ringvorlesung: Entdeckungen und frühe Kolonisation, Darmstadt 1993, S. 45–63.
Cary, Max/Warmington, Eric H., Die Entdeckungen der Antike, Zürich 1966.
Casson, Lionel, Die Seefahrer der Antike, München 1979.
Hennig, Richard, Terrae incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. Altertum bis Ptolemäus, Leiden 1944.
Heydenreich, Titus, Tadel und Lob der Seefahrt. Das Nachleben eines antiken Themas in den romanischen Literaturen, Heidelberg 1970.
Kaiser, Otto, Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel, 2. Aufl. Berlin 1962.
Klengel, Horst, Bronzezeitlicher Handel im Vorderen Orient. Ebla und Ugarit, in: Orientalisch-Ägäische Einflüsse in der Europäischen Bronzezeit. Ergebnisse eines Kolloquiums (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien 15), Bonn 1990, S. 33–46.
Richter, Dieter, Das Meer. Geschichte der ältesten Landschaft, Berlin 2014.
Schulz, Raimund, Die Antike und das Meer, Darmstadt 2005. Schulz, Raimund, Abenteurer der Ferne. Die großen Entdeckungsfahrten und das Weltwissen der Antike, Stuttgart 2016.
Endnoten
1FAZ Sonntagszeitung, 5. Juli 2015, S. 1.
2 Homer, Odyssee 1.
3 Isaia 17,12f.
4 Menander Mon. v. 264; Übersetzung bei Raimund Schulz, Die Antike und das Meer, Darmstadt 2005, S. 208.
5 Alexis Fragment 1; Übersetzung bei Albin Lesky, Thalatta, Der Weg der Griechen zum Meer, Wien 1947, S. 31.
6 Apokalypse 13,1.
7 Vgl. für die späteren Epochen: Ursula Heimberg, Gewürze, Weihrauch, Seide. Welthandel in der Antike, Aaalen 1981. Horst Klengel, Bronzezeitlicher Handel im Vorderen Orient. Ebla und Ugarit, in: Orientalisch-Ägäische Einflüsse in der Europäischen Bronzezeit. Ergebnisse eines Kolloquiums (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien 15), Bonn 1990, S. 33–46.
8 Herodot, Historien 4,42, S. 2–4; vgl. Richard Hennig, Terrae incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. Altertum bis Ptolemäus, Leiden 1944, S. 63–67; Klaus Bringmann, Veränderungen des antiken Weltbildes, in: Christof Dipper/ Martin Vogt (Hg.), Ringvorlesung: Entdeckungen und frühe Kolonisation, Darmstadt 1993, S. 53f.
9 Skylax aus Karyanda; Herodot, Historien 4,44; vgl. Hennig, Terrae incognitae, S. 116–119; Bringmann, Veränderungen des antiken Weltbildes, S. 55.
10 Hennig, Terrae incognitae, S. 155–182. Max Cary / Eric H. Warmington, Die Entdeckungen der Antike, Zürich 1966. S. 164f.
11 Plutarch, Nomoi, 4. Buch, 704a–705c; Aristoteles, Politeia 7,6, 1327c–f.
12 Aristoteles, Metereolog 2,5; Über den Himmel 2,14; vgl. Strabon, Geographika 1,4,6 (über Eratosthenes); 2,2,2; 2,3,6 (über Poseidonios).; Seneca, Naturales Quaestiones 1 praef. 13.
13 Vgl. Schulz, Die Antike und das Meer, S. 105.
14 Belege und Interpretation bei Schulz, Die Antike und das Meer, S. 221f.
Danilo Kiš, Dubrovnik und das Meer – oder Kosmopolitismus als Lebensart
Ilma Rakusa
Danilo Kiš mochte Dubrovnik, es sei sein liebster Ort in Jugoslawien, bekannte er mehrfach. Geboren wurde er allerdings im nordserbischen Subotica, an der Grenze zu Ungarn, in jener pannonischen Tiefebene, die als Überrest des ausgetrockneten pannonischen Meeres gilt. 1935 kam er als Sohn eines ungarischen Juden und einer serbisch-orthodoxen Montenegrinerin zur Welt, in Novi Sad wurde er getauft, die Kindheitsjahre verbrachte er im Heimatdorf seines Vaters in Südwestungarn. 1944 wurde der Vater nach Auschwitz deportiert, von wo er nie zurückkehrte. Danilo, seine Schwester Danica und die Mutter wurden nach dem Krieg nach Montenegro repatriiert. In Cetinje besuchte Kiš das Gymnasium, zum Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft ging er nach Belgrad. Hier entstanden sein Roman Die Dachkammer und Teile von Garten, Asche, dem ersten Band einer autobiografischen Trilogie, die der Vatersuche und dem Untergang des mitteleuropäischen Judentums gewidmet ist. Die Fortsetzungsbände Frühe Leiden und Sanduhr schrieb er in Frankreich, wo er als Universitätslektor für Serbokroatisch arbeitete. International bekannt wurde er mit dem aus sieben Erzählungen bestehenden Roman Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch, der die Schicksale meist jüdischer Revolutionäre schildert, die in Stalins Gulag umkommen. In Belgrad wurde das Buch nicht zuletzt als implizite Kritik am titoistischen System aufgefasst und scharf kritisiert, wobei man Kiš vordergründig des Plagiats bezichtigte. Kiš schrieb eine mehrhundertseitige polemische Erwiderung unter dem Titel Anatomiestunde und kehrte Belgrad definitiv den Rücken.
Die Sommer aber verbrachte er vorzugsweise im Hotel Argentina in Dubrovnik, in Gesellschaft seiner französischen Übersetzerin und Lebensgefährtin Pascale Delpech sowie des Schriftstellers Milan Milišić und dessen Frau Jelena Trpković. Er liebte Dubrovnik für seine Weltoffenheit und Schönheit und schätzte es nicht nur wegen seines venezianischen Erbes und seiner bedeutenden Renaissance- und Barockkultur, sondern auch als historische Brücke zum (byzantinischen und osmanischen) Osten.
1985, vier Jahre vor seinem Tod, plante Kiš einen Roman über den Dubrovniker Renaissance-Dichter Diogo Pires (1517–1599), der als portugiesischer Jude von der Inquisition vertrieben wurde, zum Christentum konvertierte und nach Stationen in Salamanca, Antwerpen und Italien schließlich in Dubrovnik (damals Ragusa) landete. Hier kehrte er zum Judentum zurück, nahm den Namen Isaiah Kohen an und schrieb lateinische Werke, in denen er seine verlorene und neue Heimat besang. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er im Ghetto, beerdigt wurde er auf dem jüdischen Friedhof.
Es erstaunt nicht, dass Kiš sich für diesen Stoff interessierte: Themen wie Verfolgung, Exil, Judentum, Dichtung, Sprache trieben ihn um, der Schauplatz Dubrovnik hatte einen weiteren Reiz. Doch bis auf ein paar Notizen in Serbokroatisch und Ungarisch ist nichts aus dem Romanprojekt geworden, was auch damit zusammenhängen mag, dass Kiš 1986 an Lungenkrebs erkrankte.
Noch in seinem Todesjahr, 1989, weilte Kiš im Hotel Argentina in Dubrovnik. Allerdings fühlte er sich schlecht. Am 5. September ließ er sich (wie sein Biograf Mark Thompson schreibt)1 im Krankenhaus von Herceg Novi untersuchen. Nach der Untersuchung soll er den Arzt gefragt haben: »La commedia è finita?« Der Arzt nickte. Am 15. Oktober starb Kiš in seiner Pariser Wohnung.
Den Jugoslawienkrieg erlebte er nicht mehr und erfuhr so nicht, dass sein geliebtes Dubrovnik 1991 von der Jugoslawischen Armee bombardiert und sein kosmopolitischer Freund Milišić am 5. Oktober zu den ersten Opfern dieses Angriffs wurde. Er wäre verzweifelt gewesen.
Was bedeutete für Danilo Kiš das Meer? Nicht das ausgetrocknete pannonische, dem er im Roman Sanduhr ein berührendes Kapitel gewidmet hat, sondern das adriatische, blaue, bewegte Meer? Über Dubrovnik gibt es kein literarisches Zeugnis aus seiner Hand, sehr wohl aber über die Bucht von Kotor, die nicht allzu weit von Cetinje, wo er seine Jugend verbracht hatte und seine Schwester Danica lebte, entfernt war. Dieses Meer in der Bucht, das man am eindrucksvollsten aus der Höhe erlebt, schilderte er minuziös in Kapitel 7 seines Romans Sanduhr und später in einer zu Lebzeiten unveröffentlichten Erzählskizze aus dem Jahre 1983 (A und B),mit dem englischen Untertitel »The magical place« (Der magische Ort). Ich habe diesen Text 1996 auf Deutsch in dem Nachlassband Der Heimatlose (serbokroatisch Lauta i ožiljci, 1994) herausgegeben und möchte ihn hier vollständig zitieren:
»Man sollte um fünf Uhr in Kotor (Kotor se trouve dans la région de la Zeta, en Yougoslavie, dans le golfe de Cattaro, une embouchure de la mer Adriatique) losfahren und nach einer Stunde über die steilen Serpentinen hinauf eine Rast einlegen und warten.
Es sollte ein klarer Tag sein, doch im Westen müssen ein paar weiße Wolken gleich einer Herde weißer Elefanten am Himmel stehen.
Nun: den Blick über Meer, Berge und Himmel schweifen lassen.
Und dann über Himmel, Berge und Meer.
Man muss sicher sein, dass der Vater mit dem Bus oder einem in Kotor angeheuerten Taxi dieselbe Strecke fuhr, man muss überzeugt sein, dass er dasselbe Panorama sah: Aus den Wolken, die einer Herde weißer Elefanten gleichen, bricht die Sonne, die hohen Berge verschwimmen im Dunst, das Meer in der Bucht ist kobalttintenblau, die Stadt liegt am Fuß des Gebirges, ein weißes Schiff macht am Kai fest, aus dem Schornstein der Seifenfabrik quillt dichter Rauch, ihre riesigen Fenster glühen wie Feuer.
Man muss auch auf das Zirpen der Grillen achten (als würden Millionen Armbanduhren aufgezogen), weil man es sonst leicht vergessen kann, ebenso leicht, wie man den Geruch des gemeinen Wermuts am Straßenrand wegen seiner ständigen Anwesenheit verpasst.
Dann muss man alles andere vergessen und aus dieser göttlichen Perspektive das Zusammentreffen der Elemente beobachten: Luft, Erde, Wasser.
Und wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird sich in einem das Gefühl von Ewigkeit regen, das Koestler das ›ozeanische Gefühl‹ nannte.
P.S.
Einer meiner Freunde, ein Bildreporter, durfte mit Erlaubnis des Kapitäns auf einem vor Kotor ankernden sowjetischen Kreuzer fotografieren. Mit dem Weitwinkel nahm er den Kreuzer und die Landschaft der Bucht vom Ufer aus auf, aber nach dem Entwickeln war der ganze Film schwarz wie die schwärzeste Nacht.
Die Ahnung der Ewigkeit, das ›ozeanische Gefühl‹, hinterlässt auf einer Filmrolle nur rote, schwarze oder grüne Flecken, unabhängig von der technischen Verzerrung (brouillage), sofern während der Aufnahme einer der Sinne ungenutzt blieb: Ohr, Nase oder Auge.
Eben dieses Panorama betrachtet mein Vater 1939 (fünf Jahre, bevor er in Auschwitz verschwand), im Jahr 1898 aber Herr Sigmund Freud, der danach seinen berühmten Traum von den drei Parzen träumen sollte.«2
Über das »ozeanische Gefühl« wüsste man gerne mehr, aber wir ahnen, dass Kiš eine metaphysische Landschaft beschreibt, die entsprechende metaphysische Empfindungen weckt. Magie grenzt hier an Ewigkeit.
Nichts unterscheidet sich so stark vom »Ozeanischen« wie Grenzen, reale und mentale. Kiš sträubte sich – im persönlichen Leben – gegen feste Zuschreibungen, verwahrte sich dagegen, als jüdischer oder serbischer Schriftsteller angesehen zu werden. Jedes Attribut dieser Art sei ihm fremd; es gebe nur gute oder schlechte Literatur. Vor allem aber warnte er schon früh vor den Gefahren des Nationalismus in Jugoslawien. Ungemein luzid hielt er bereits 1973 in einem Interview (»Zeit des Zweifels«) fest:
»Nationalismus ist vor allem Paranoia. Kollektive und individuelle Paranoia. Als kollektive Paranoia ist er eine Folge von Neid und Angst, mehr noch aber eine Folge des individuellen Identitätsverlustes; demnach ist kollektive Paranoia nur eine bis zum Paroxysmus gesteigerte Summe individueller Paranoien.«3
In der Folge charakterisiert Kiš den Nationalismus als »Weg des geringeren Widerstands«, als »Bequemlichkeit«, als »eine Ideologie der Banalität«, ja als »eine totalitäre Ideologie«. Er sei zudem »nicht nur seiner etymologischen Bedeutung nach die letzte Ideologie und Demagogie, die sich an das Volk wendet«. Kiš sieht im Nationalismus eine rein »negative Kategorie des Geistes«, denn dieser lebt »in der Negation und von der Negation«. Schärfer lässt sich diese reaktionäre Erscheinung kaum verurteilen.
Vehement hat Kiš in seinem polemischen Buchessay Anatomiestunde (1978, dt. 1998) nachgedoppelt und darauf verwiesen, dass ihn schon die leidvollen Erlebnisse seiner Kindheit – Flucht, dann die Deportation des jüdischen Vaters – die Relativität aller Werte gelehrt hätten. Sein Kosmopolitismus versteht sich somit als Antwort auf jede Form von (rassistischer, religiöser, ideologischer) Ausgrenzung. Diese weltoffene Haltung hat Kiš – im Leben wie im Schreiben – bis zuletzt bewiesen, was nicht hinderte, dass er – obwohl lange Jahre in Frankreich ansässig – seine Bücher konsequent auf Serbokroatisch schrieb. Offenheit bedeutete für Kiš nicht zuletzt, künstlerisch nach Neuland zu suchen, aus verkrusteten, anachronistischen Formen auszubrechen. Alle seine Bücher tragen das Siegel der Verfremdung bzw. eines obsessiven Strebens nach Einzigartigkeit. Wobei Poetik für Kiš Po-Ethik war. Nichts hielt er für verfehlter als L’Art pour l’art.
Nennen wir Kiš’ Werk – jenseits aller Zuschreibungen – einen Kontinent on its own, mit Flüssen, Ebenen, Städten, mit Menschen auf Wanderschaft. Keine Frage, dass dieser Kontinent ans Meer grenzt, das nicht nur Weite, sondern Ewigkeit evoziert.
Endnoten
1 Mark Thompson, Geburtsurkunde. Die Geschichte von Danilo Kiš. Aus dem Englischen von Brigitte Döbert und Blanka Stipetić, München 2015, S. 441.
2 Danilo Kiš, Der Heimatlose. Erzählungen. Aus dem Serbokroatischen von Ilma Rakusa, München/Wien 1996, S. 115–117.
3 Danilo Kiš, Homo poeticus. Gespräche und Essays, hg. von Ilma Rakusa, München /Wien 1994, S. 181.
Düstere Meeresbilder: Finanzkrise, Flüchtlinge und die Flut
Konstantinos Kosmas
»Hier will ich innehalten und will auch ich ein wenig die Natur betrachten.
Des Morgenmeeres und des wolkenleeren Himmels
leuchtende Blautöne und gelbes Ufer.
Alles hell und schön im Licht.
Hier will ich innehalten und so tun, wie wenn ich all dies sähe;
(wahrhaftig sah ich’s einen Augenblick, als ich eben innehielt);
und nicht auch hier noch meine Phantasien
und Erinnerungen und die Trugbilder der Wollust.«1
Griechenlands Küstenlinie zählt zu den zehn oder 15 längsten weltweit, das Meer ist gewissermaßen überall. Dass es ein übliches Motiv in Literatur und Sprache sein musste, war zu erwarten. Das Wasser ist nicht nur allgegenwärtig, sondern auch flüssig und sehr weit; eine ideale Bühne für Fantasieprojektionen. Konstantinos Kavafis nutzte kaum Naturbilder in seinen Gedichten und in dem Gedicht, das ich am Anfang zitiert habe, ist das Meer ein ausgesprochenes Fantasiekonstrukt, eine Bühne für seine Erinnerungen.
Griechenland wird seit circa fünf Jahren mit der Krise assoziiert: einer heftigen Wirtschafts- und Politikkrise auf der einen, der Flüchtlingskrise auf der anderen Seite. Meeres- und Wasserbilder spielen auch in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: »Den Griechen steht das Wasser bis zum Hals«, »Grexit, einfach wie Wassertrinken« oder: »Flüchtlingsstrom«, »Flüchtlingswelle«, »Überflutung«. Neben Krankheitsmetaphern,2 die zur Beschreibung der Krise dienen, sind Wasser-Bilder am häufigsten. Die aktuellen Migrationsbewegungen werden als Flüchtlingsströme und (Flut)-wellen beschrieben, die Uneindämmbarkeit ausdrücken sollen. Die Krise, die sich in den flüchtenden Menschenmassen manifestiert, scheint keiner Logik zu folgen, keiner Kategorie zu entsprechen, unbeherrschbar zu sein wie das Meer.
Vor einigen Wochen konnte man den slowakischen EU-Politiker Richard Sulík sagen hören,3 Europa sei ein Boot und Flüchtlinge das Wasser, das hineindringe; man solle dieses eindringende Wasser stoppen, anstatt es zu verteilen.
Der geografische Zufall will es nun, dass viele Flüchtlinge tatsächlich über das Meer nach Griechenland und Italien kommen. Die wasser- bzw. meerbezogene Bildsprache bezüglich Krisen und Gefahren ist auffällig und soll der rote Faden meiner Überlegungen, textuellen Assoziationen und Beispiele sein. Wie verbinden sich Meer, Krise und Gefahr in griechischsprachigen Texten? Und inwiefern ist das, was sich momentan an den griechischen Stränden jenseits der touristischen Muße abspielt, in literarischen Texten wiederzufinden?
Schon im ältesten literarischen Text der Geschichte ist das Meer ein Versteck für Ungeheuer und Gefahren. Homers Odysseus will nach dem Krieg zurück nach Hause, doch seinen Weg versperren unter anderen auch Meeresungeheuer. Skylla schnappt sich die Männer vom Wasser und frisst sie, die gestaltlose Charybdis konnte sie von der Oberfläche in den Abgrund hinabsaugen und vernichten. Diese Wesen waren unbesiegbar, Odysseus und seine Männer konnten sie lediglich umschiffen bzw. Blutzoll zahlen, um weiterfahren zu dürfen.
Eine andere mythologische Erzählung berichtet, dass Perseus – Sohn des Zeus und der Danae –, der als goldener Regen empfangen wurde, den Kopf der Gorgone Medusa abschlagen musste, die auf einer Insel wohnte. Auf dem Weg zurück nach Argos fliegt er an der Küste Nordafrikas vorbei. Dort sieht er die schöne Andromeda, an einen Felsen gekettet, als Opfer für das Meeresungeheuer Ketos – das bedeutet auf Griechisch Walfisch, Meeresungeheuer bzw. generell das große, gefährliche Meereswesen. Ketos steigt in diesem Augenblick aus dem Meer und schießt auf Andromeda zu. Doch Perseus kann ihn töten, das Mädchen retten und heiraten.
Auch in der Bibel werden die Gefahren des offenen Wassers zur Verdeutlichung des Untergangsszenarios verwendet. Der Lieblingsjünger Jesu zog sich auf die Insel Patmos zurück und verfasste in einer Höhle die Apokalypse. In Kap. 13 schreibt er:
»Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwen Mund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. […] Und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden; und ward ihm gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden.«4
Das Unheil kommt auch hier aus dem Meer, einem Hort unheimlicher Wesen, die nicht nur Reisende, sondern auch die Bewohner des Festlandes bedrohen. Das Meer: tief, unbekannt, fließend und daher nicht begreifbar. Es ist der Ursprung des Lebens und zugleich der Tod – das Tor zum Hades war übrigens an der Spitze der Halbinsel Tainaron auf dem Südpeloponnes gelegen.
Seit der Patmos-Apokalypse hat die griechischsprachige Literatur eine lange Pause in der Darstellung jener Gefahren gemacht, die aus dem Meer steigen. Die Meeresungeheuer, die den Fang der Seeleute auf dem Land verschlingen und Schiffbrüchige auf offener See in den Tod reißen, stammen von Plinius, die Riesenkraken sind Seemannsgarn der Nordeuropäer und Romanfiguren bei Jules Verne, der eigentlich göttliche Rächer Moby Dick ist ein spottender Amerikaner.
Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert und in einem der wichtigsten Werke der Literatur Griechenlands, in der Novelle Die Mörderin5 von Alexandros Papadiamantis, kommt das alte Bild des Meeres mit enigmatisch-düsteren Vorzeichen zurück, wenn auch raffiniert und diskret. Die Hauptfigur, die unheimliche Alte Frangogiannou, ist eine der emanzipiertesten Frauen des 19. Jahrhunderts; so emanzipiert, dass ihr Wille, ihr Recht durchzusetzen und Frauen zu schützen, sie über die sozialen und göttlichen Grenzen hinwegführt. Bereits ihre Mutter wurde quasi als Hexe, als eine nicht der Menschengemeinde zugehörige Frau wahrgenommen. Auch Frangogiannou, alt und abgekämpft, muss realisieren, dass sie als Frau keine Möglichkeit hat, frei und glücklich zu sein. Daher mordet sie Mädchen – um sie vor der Willkür der Männer zu schützen. Ihre Morde werden entdeckt und von da an gilt sie für die Menschen als etwas Abscheuliches, ein Monstrum. Der Autor behandelt sie jedoch mit Ehrfurcht und lässt sie auch nicht von Menschen bestrafen. Die Novelle endet archetypisch: Frangogiannou, die Mörderin, kehrt ins Meer zurück, steigt lebendig hinein, um vor den Polizisten zu fliehen. Sie verschwindet im Wasser. Das Monster kann nicht von Menschen gefasst werden und taucht ins Meer, dorthin, wo Monster herkommen.6
Ansonsten empfinden die Griechen und ihre Literatur das Meer als eine stete und gute Gesellschaft: Erholung und Reinigung, erotische Anspielung, Verheißung einer hellen und reinen Zukunft, Projektionsfläche einer reisenden und suchenden Nation, Metapher für das Offene und das Endlose in politischer, sozialer und metaphysischer Hinsicht. »Nur ein Weniges noch/ und wir werden die Mandeln blühen sehen/ den Marmor in der Sonne leuchten/ und das Meer sich wiegen«7, heißt es bei Giorgos Seferis. Der andere Nobelpreisträger, Odysseas Elytis, kreierte eine Metaphysik des Ägäischen Meeres und seines Lichtes. Der Lyriker und Matrose Nikos Kavvadias schrieb vom polyglotten und multinationalen Mikrokosmos der Seeleute auf den Frachtern und Tankern mit einer Mischung aus moderner Sittenschilderung und Orientalismus: Die Seemänner haben ihre eigene Sprache und eigene Gesetze, sie sind rau, aber auch verletzlich. Die Frauen und ihre fernen Städte sind heiß, feucht und wild.
Das für uns Interessante, nämlich die Abweichungen von solchen verklärenden Meeresbildern, erscheint immer dann, wenn eine Krise herrscht oder bevorsteht. In den letzten 100 Jahren gab es in Griechenland zwei große Flüchtlingswellen, die zeitgleich mit lokalen politischen Krisen einhergingen. Die erste brach nach dem griechisch-türkischen Krieg 1920–1922 aus, in dessen Folge circa anderthalb Millionen Flüchtlinge aus Kleinasien aufs griechische Festland kamen; die zweite findet gerade jetzt statt. In den ersten acht Monaten dieses Jahres flohen circa 160.000 Menschen über das Meer nach Griechenland.8 – Die neuen Flüchtlinge in Kombination mit der anhaltenden Krise, wie geht die Literatur damit um und spielt das Meer dabei eine besondere Rolle?
Bereits die Krise von 1922 verursachte einen Flüchtlingsstrom über das Meer. Ein plastisches Bild davon überliefert der Roman Die Madonna mit dem Fischleib von Stratis Myrivilis. Darin ist das Meer keine Idylle, sondern es bringt das Elend hervor. Auf der Insel Lesbos, auf der heute Tausende von Flüchtlingen wöchentlich stranden, kamen auch damals die Flüchtlinge an. Es werden Boote beschrieben, die beladen sind mit
»großem Leid und Grauen. Einige [Boote] wiesen Schusslöcher auf, die mit Taschentüchern und seidenen Pfropfen, mit Mützchen von Kindern und Unterwäsche zugestopft waren. Männer, Frauen, Kinder stiegen aus. Ihre Gesichter waren schmutzig, grünlich-fahl. Sie bissen die Zähne fest zusammen und blickten um sich mit von Schlaflosigkeit geröteten und geschwollenen Augen. Einige von ihnen waren verwundet. Sie hoben auch Leichen heraus, darunter einen Burschen mit blondem Bart, sehr jung, und eine Frau. Ihre Wangen waren zerfleischt, ein weißes Tuch hielt ihre Kinnbacken zusammen, und ihre Augen starrten weit offen in den Himmel. Tiefschwarze Augen […] Die Leichen waren völlig starr, sie hoben sie auf alten Militärdecken heraus. Niemand weinte mehr […]«9
Die Flüchtlinge aus jenem Krieg wurden in Griechenland feindselig aufgenommen – sie kamen aus dem Meer, sahen schmutzig und krank aus, ihre Sprache klang anders. Bis sie nach einer Generation zu einem dynamischen Teil der griechischen Gesellschaft geworden waren, mussten sie wohl das Meeressalz von sich abstreichen und die Gestalt und Farbe der Festlandgriechen annehmen.
Das Meer war auch in den 1970er-Jahren ein Tor zur Welt, nur umgekehrt: nicht Eingang, sondern Ausgang. Hunderttausende Griechen verließen ihr Land in Richtung Amerika, Australien, Europa. Sehr viele von ihnen auf dem Seeweg. Auf der Suche nach Arbeit, einer neuen Heimat, bereit, alles hinter sich zu lassen, waren auch diese Migranten …
Ende der 1980er-Jahre fasste in Griechenland eine aufstrebende Wirtschaft Fuß und die Gesellschaft konnte die Armutsidentität, die die Menschen in den 60er- und 70er-Jahren in die Migration getrieben hatte, hinter sich lassen. Dominant wurde ein Wohlstandsimaginativ, das eng mit den Interessen der populistischen regierenden Partei von Andreas Papandreou verfilzt war: Für viele Interpretatoren der derzeitigen Krise sei jene Zeit der eigentliche Ursprung der heutigen Misere gewesen, sowohl finanziell, aber auch gesellschaftlich gesehen. Es war, zumindest in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre, eine Mischung aus Libyen- und Palästinasozialismus, Nationalismus, Machogehabe und Korruption, die den Ton im politischen Diskurs angab.
Der damals relativ populäre Autor Phädon Tamvakakis publizierte seine Novelle Die Äußerste Ende dieser 80er-Jahre.10





























