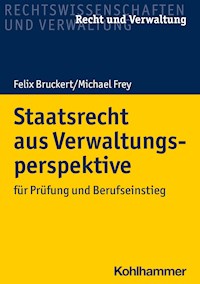Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Etablierung der Umweltverbandsklage und der Auswirkungen auf die Klagebefugnis im nationalen Umweltrecht unter Berücksichtigung des supranationalen Kontexts. Ziel soll es dabei sein, die Auswirkungen des europäischen Rechtes auf das deutsche Verbandsklagerecht zu untersuchen, Probleme zu identifizieren, Lösungen vorzuschlagen und Prognosen und Bewertungen zu erstellen. Insbesondere werden dabei die Auswirkungen auf den subjektiven Rechtsschutz und die Schutznormlehre untersucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Jeder entscheidet mit darüber, ob das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert nachhaltiger Entwicklung wird.“
Dr. Angela Merkel, 2010
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
1994-1998
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1.1 Einführung und Zielsetzung der Arbeit
1.2 Grundproblematik der Verbandsklage im nationalen Umweltrecht
SUPRANATIONALE GRUNDLAGEN DER UMWELTVERBANDSKLAGE
2.1 Völkerrechtliche Grundlagen der Umweltverbandsklage
2.1.1 Die drei Säulen der Aarhus-Konvention
2.1.2 Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten nach der Aarhus-Konvention
2.1.3 Aarhus-Konvention Arbeitsgruppen und Gremien
2.1.4 Verbindlichkeit von Völkerrecht und Umsetzung der Aarhus-Konvention in Unionsrecht
2.2 Die Umweltverbandsklage im Unionsrecht
2.2.1 Europäische Kompetenz und Rechtsetzung im Umweltrecht
2.2.2 Umsetzung der Aarhus-Konvention in Unionsrecht
DIE VERBANDSKLAGE IM NATIONALEN UMWELTRECHT
3.1 Arten von Verbandsklagen
3.1.1 Abgrenzung und Bedeutung egoistischer Verbandsklagen im nationalen Umweltrecht
3.1.2 Abgrenzung und Bedeutung der altruistischen Verbandsklage im nationalen Umweltrecht
3.2 Inhalt des nationalen Umweltrechts
3.2.1 Rechtsnormen des nationalen Umweltrechts
3.2.2 Umweltinformationsgesetz
3.2.3 Umweltschadensgesetz
3.3 Verbandsklage nach dem BNatSchG
3.4 Verbandsklage nach dem UmwRG
3.4.1 Geltungsbereich des UmwRG
3.4.2 Voraussetzungen für Rechtsbehelfe gemäß UmwRG
3.4.3 Weitere Besonderheiten und Einschränkungen des UmwRG
3.5 Bewertung und Fazit
3.5.1 Aktuelle Rechtslage
3.5.2 Auswirkungen europäischer Integration
ANALYSE DER RECHTSPRECHUNG ZUR UMWELTVERBANDSKLAGE
4.1 EuGH Rechtsprechung
4.1.1 Janecek-Urteil
4.1.2 Slowakischer Braunbär
4.1.3 Trianel-Urteil
4.1.4 Altrip-Urteil
4.1.5 Zusammenfassung und Tendenz der EuGH-Rechtsprechung bezüglich der (Umwelt)Verbandsklage im nationalen Recht
4.2 Rezeption der EuGH-Rechtsprechung durch das BVerwG
4.3 Bewertung und Tendenz von Auswirkungen der Rechtsprechung auf die nationale Umweltverbandsklage
FOLGEN UND PROBLEME DER ERWEITERTEN KLAGERECHTE
5.1 Sicht der Vorhabenträger
5.2 Sicht der betroffenen Öffentlichkeit/Umweltvereinigungen
5.3 Sicht der Exekutive
5.4 Sicht der Judikative
5.5 Sicht der Legislative
5.6 Zusammenfassung der Probleme
LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN, PROGNOSE UND HANDLUNGSSPIELRÄUME
6.1 Möglichkeiten der Gesetzgebung zur Realisierung der vollumfänglichen Umweltverbandsklage
6.2 Reformbedarf der Schutznormlehre unter unionsrechtlichem Anpassungsdruck?
6.2.1 Dogmatik des subjektiv-öffentlichen Rechts
6.2.2 Schutznormlehre als Voraussetzung für die Verletzung des subjektiv-öffentlichen Rechts
6.2.3 Bestimmung des Schutzbereichs umweltrechtlicher Normen
6.2.4 Die Beziehung zur Umwelt als maßgebendes Kriterium zur Bestimmung des Schutzbereichs einer Norm
6.3 Grenzen der Umweltverbandsklage und Vereinbarkeit mit dem System des subjektiven Rechtsschutzes
6.3.1 Substantiierter Vortrag
6.3.2 Anerkennung von Vereinigungen als Mittel quantitativer und qualitativer Regulierung von Rechtsbehelfen
6.3.3 Präklusion insb. zur präventiven Vermeidung von Rechtsbehelfen
6.3.4 Unbeachtlichkeit von Verfahrensfehlern gem. § 46 VwVfG zur Verhinderung unnötiger Verfahren
6.3.5 Sofortvollzug als präventive Maßnahme gegen zweckfremde Rechtsbehelfe
6.4 Zusammenfassung der Möglichkeiten und Grenzen der Umweltverbandsklage
FAZIT UND PROGNOSE
7.1 Fazit der Umweltverbandsklage nach aktuellem Recht und der vorgeschlagenen Ausweitung
7.2 Prognose der weiteren Entwicklung der Umweltverbandsklage unter dem Einfluss der Europäisierung
ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN
LITERATURVERZEICHNIS
VORWORT
Ein außergewöhnlicher Dank gebührt Prof. Dr. Michael Frey, Mag. rer publ. für die intensive Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit und weit darüber hinaus. Er war mir ständiger Mentor und Motivator, ohne den ich in vielerlei Hinsicht anders dastehen würde. Dafür herzlichen Dank!
Ebenfalls gebührt Prof. Dr. Heinz-Joachim Peters ein besonderer Dank dafür, dass er sich bereit erklärt hat, das Zweitgutachten zu erstellen.
Außerdem möchte ich meiner Familie und meinen Freunden für die Unterstützung und Motivation danken.
Kehl, September 2014
Felix Bruckert
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Im Übrigen wird auf Kirchner, Hildebert, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache; 7. Auflage, 2013; de Gruyter, Berlin verwiesen.
1 EINLEITUNG
1.1 Einführung und Zielsetzung der Arbeit
Das Umweltrecht ist ein schwer überschaubares Rechtsgebiet1 mit einer Vielzahl von Normen, die u. a. eine gesunde Umwelt sichern und dem Schutz der Umweltgüter dienen.2 Diese Schutzfunktion verläuft jedoch ins Leere, wenn die dazu erlassenen Normen nicht eingehalten werden. Es bedarf daher einer Kontrollmöglichkeit um die Einhaltung der umweltschützenden Normen zu garantieren und überprüfen zu können.3
In der Regel 4 setzen verwaltungsgerichtliche Überprüfungen eine (subjektive) Rechtsverletzung voraus.5 Die Umwelt als solche kann jedoch nicht Träger subjektiver Rechte sein.
Die Umwelt wird durch einen anthropozentrischen Umweltbegriff definiert und umfasst den Mensch, die Tiere, die Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die Landschaft und die abiotischen Kultur und sonstigen Sachgütern sowie deren Beziehung untereinander und zu den Menschen.6 Daher kommt nur der Mensch selbst als Teil der Umwelt in Betracht um die Einhaltung der umweltschützenden Normen durchzusetzen.
Im deutschen Rechtssystem wird der subjektive Rechtsschutz verfolgt7, die Durchsetzung der umweltschützenden Normen wird daher regelmäßig nur gelingen, wenn diese Normen ein subjektives Recht vermittelt. Oft ist es schwierig herauszufinden, ob eine Norm überhaupt ein subjektives Recht vermittelt. Hierfür bedient man sich der sog. Schutznormlehre, die ein subjektives Recht annimmt, wenn der Schutzbereich der Norm nicht nur die Allgemeinheit sondern auch den Einzelnen schützen soll. 8 Die Folge des subjektiven Rechtsschutzes ist es, dass nicht jeder Mensch die Durchsetzung des Umweltrechts fordern kann. Er muss vielmehr direkt durch das Verwaltungshandeln betroffen (sog. Adressatentheorie9) oder vom Schutzbereich der Norm umfasst sein. Mit dieser Einschränkung der Klagemöglichkeit soll vor allem die Popular- und Interessentenklage ausgeschlossen werden.10
In der jüngsten Zeit erlebt das deutsche Verwaltungsrecht jedoch durch Einfluss der Europäischen Union zumindest hinsichtlich des Verbandsklagerechtes eine grundlegende Änderung.11 Die von der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete Aarhus-Konvention 12 soll der „betroffenen Öffentlichkeit“ unter anderem einen breiten Zugang zu den Gerichten ermöglichen. 13 So vor allem auch den Umweltvereinigungen ermöglichen gegen Entscheidungen über den Zugang zu Informationen über die Umwelt gemäß Art. 4 Aarhus-Konvention und Entscheidungen, die eine Öffentlichkeitsbeteiligung i. S. d. Art. 6 Aarhus-Konvention vorschreiben gerichtlich vorzugehen. Auf nationaler Ebene soll Letzteres insb. durch das Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG)14 umgesetzt werden.15
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem sog. „Trianel-Urteil“ klargestellt, dass das UmwRG a. F. bezüglich der sog. Schutznormakzessorietät16 nicht mit der europäischen Umsetzung der Aarhus-Konvention17 in Einklang stand. Dieser fast revolutionäre Systembruch 18 des deutschen Rechtsschutzes sorgt seither für Aufruhr.
Bereits seit langem steht das deutsche Verwaltungsrecht unter zunehmendem Einfluss des europäischen Rechts.19 Dabei existieren verschiedene Theorien, die (bislang ohne 100 %-igen Erfolg) versuchen diesen Prozess zu beschreiben (sog. Integrationstheorien). 20 Durch die jüngste Rechtsprechung und Rechtsetzung wird auch die Umweltverbandsklage im nationalen Recht beeinflusst.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Etablierung der Umweltverbandsklage und der Auswirkungen auf die Klagebefugnis im nationalen Umweltrecht unter Berücksichtigung des supranationalen Kontexts. Ziel soll es dabei sein, die Auswirkungen des europäischen Rechtes auf das deutsche Verbandsklagerecht zu untersuchen, Probleme zu identifizieren, Lösungen vorzuschlagen und Prognosen und Bewertungen zu erstellen. Insbesondere werden dabei die Auswirkungen auf den subjektiven Rechtsschutz und die Schutznormlehre untersucht.
1.2 Grundproblematik der Verbandsklage im nationalen Umweltrecht
Ausgelöst wurde die aktuelle Debatte21 um das subjektive Recht hinsichtlich der Umweltverbandsklage auch durch die grundsätzlich als kritisch anzusehende Tendenz, Umweltschutzvorschriften lediglich als die Allgemeinheit schützende Normen zu klassifizieren. Das Umweltrecht, dessen primärer Sinn und Zweck es ist, den Schutz der Umwelt zu gewährleisten, dient aber letztlich auch zum Schutz der Gesundheit jedes einzelnen Menschen.22 Es erscheint insoweit bedenklich, dass viele der Normen des Umweltrechtes einen lediglich die Allgemeinheit schützenden Charakter besitzen (sollen). 23 Unter diesen Umständen sollte eigentlich der Schluss gefasst werden, dass gerade Normen des Umweltschutzes ein subjektiv-öffentliches Recht vermitteln, da sie nicht nur die Allgemeinheit sondern eben auch den Einzelnen schützen. Dies ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass der einzelne Mensch unmittelbar vom Schutz der Umwelt, bspw. der Reinhaltung der Luft, betroffen ist.
Solange das Verständnis des subjektiven Rechts aber noch eher restriktiv gehandhabt wird, können Verletzungen vieler umweltrechtlicher Normen nur im Rahmen einer Verbandsklage nach Maßgabe und im Anwendungsbereich von § 64 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 24 oder dem UmwRG gerügt werden.
Hinzu kommt außerdem, dass die vielfach im Umweltrecht eingeräumten Verfahrensrechte für Betroffene25 nur schwer durch Rechtsbehelfe durchsetzbar sind. § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)26 eröffnet Klagemöglichkeiten nur für materielle subjektive Rechte und auch § 46 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)27 (sowie § 4 UmwRG) stellt im behördlichen Verfahren eine gewisse – wenn auch überwindbare – Hürde dar. Eben diese Verfahrensrechte, die bspw. die Anhörung und Beteiligung betroffener Personen, Verbände und Behörden beinhalten müssen jedoch effektiv auch gerichtlich durchsetzbar sein. Dies gerade unter dem Kontext der Zielsetzung der Aarhus-Konvention, eine verstärkte Integration der Bürger in der Umweltpolitik zu erreichen.28
Bisweilen werden von der Rechtsprechung jedoch lediglich Verletzungen der sog. absoluten und relativen Verfahrensrechte als einklagbar anerkannt.29 Diese unmittelbar einklagbaren Fallgruppen beinhalten nur wenige Ausnahmen, 30 so wurde bspw. früher die Beteiligung anerkannter Naturschutzverbände bei Planfeststellungsverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 2002.31 als absolutes Recht anerkannt. Ein sog. relatives Verfahrensrecht, das sich auf die materielle Position des Verletzten beziehen muss, wurde bspw. in den inhaltlichen Vorschriften bei der Vorlage von Unterlagen gem. § 10 Abs. 2 S. 2 BImSchG gesehen. 32 Als Klagebefugnis erweiternd ist daher auch nicht § 4 Abs. 3 UmwRG anzusehen, da dieser lediglich als lex specialis zu § 46 VwVfG anzusehen ist und eine Klagebefugnis voraussetzt.33
Die geschilderte Situation führt entsprechend dazu, dass viele Normen, insb. Verfahrensnormen im Umweltrecht – die letztlich auch den Schutz der Rechte Einzelner garantieren sollen und insb. in der Aarhus-Konvention Ausdruck finden34 – kaum durch Rechtsbehelfe durchsetzbar sind. Hinzu kommt das enorme Vollzugsdefizit im Umweltrecht, das auch auf der aktuellen Rechtslage und mangelnden Klagemöglichkeit basiert.35
Diese Problematik ist schon wegen der praktischen Wirksamkeit, die der Grundsatz des effet utile 36 hinsichtlich der Umsetzung der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie37 verlangt, nicht in Einklang mit dem Unionsrecht, da der Rechtsschutz teilweise unmöglich gemacht wird. Darüber hinaus führt es zu einer unbefriedigenden Situation, die den Umweltschutz mindert.38
1Peters, Rn. 1.
2Schmidt/Kahl, § 1 Rn. 8; zu den einzelnen Umweltgütern bzw. Schutzgütern Peters, Rn. 2 ff.
3 Siehe dazu auch Wiesinger, S. 57.
4 § 42 Abs. 2 VwGO enthält eine Öffnungsklausel für abweichende Bestimmungen.
5 § 42 Abs. 2 VwGO; § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO.
6Kloepfer (a), Rn. 15 ff., übereinstimmend: Peters, Rn. 2.
7Epiney, NVwZ 2014, 465 (465).
8Sodan in: Sodan/Ziekow, § 42 Rn. 388.
9Sodan in: Sodan/Ziekow, § 42 Rn. 383.
10Sodan in: Sodan/Ziekow, § 42 Rn. 365.
11 Siehe zum grundsätzlichen Einfluss europäischer Integration auf das nationale Verwaltungsrecht etwa Wiesinger, S. 3; Maurer, § 2 Rn. 31 ff; zum Umweltrecht auch Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4 Rn. 5.
12 Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, unterzeichnet am 25. Juni 1998 in der dänischen Stadt Aarhus im Rahmen des UNECE-Prozesses „Environment for Europe“.
13 Art. 9 i. V. m. Art. 2 Nr. 5 Aarhus-Konvention
14 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 753), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 52 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154).
15 BT-Drs. 16/3312.
16 Rechtsbehelfe anerkannter Umweltvereinigungen waren gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwRG a. F. nur bezüglich dem Umweltschutz dienenden Normen, die ein subjektives Recht vermitteln zulässig. Eine eigene Rechtsverletzung war jedoch nicht erforderlich.
17 Siehe dazu unten 2.2.2.
18 So auch m. w. N. Kloepfer (a), § 8, Rn. 33.
19 Dazu etwa Wiesinger, S. 3; Maurer, § 2 Rn. 31 ff; zum Umweltrecht auch Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 4 Rn. 5.
20 Dazu etwa Bieber/Epiney/Haag, § 1 Rn. 39.
21 Die „Debatte“ erläutert etwa Schwerdtfeger, EuR 2012, 80 (80).
22 Normiert beispielsweise in § 1 Abs. 1 S. 1 BNatSchG, § 1 Abs. 1 BImSchG, § 1 Abs. 1 S. 1 WHG.
23 So auch Peters, Rn. 243; m. w. N. Bizer/Ormond/Riedel, S. 28; m. w. N. auch Gärditz, NVwZ 2014, 1 (1).
24 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Art. 4 Abs. 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist.
25 So bspw. die umfassenden Verfahrensvorschriften des § 10 BImSchG oder § 14 WHG.
26 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Art. 13 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (BGBl. I S. 890) geändert worden ist.
27 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.
28Wiesinger, S. 37.
29Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 5 Rn. 15 ff.
30Sparwasser/Engel/Voßkuhle, § 5 Rn. 15 f.; ebenso Gärditz, NVwZ 2014, 1 (2).
31 BVerwG, Urt. v. 12.11.1997 - 11 A 49.96, BVerwGE 105, 348.
32 BVerwG, Urt. v. 22.10.1982 - 7 C 50.78, NJW 1983, 1507.
33Gärditz, NVwZ 2014, 1 (2).
34 So die in der Aarhus-Konvention genannten Erwägungen.
35 Ausführlich dazu etwa Schmidt/Kahl, § 1 Rn. 85; Wiesinger, S. 57.
36 Ausführlich zur Bedeutung und Auslegung des effet utile Frenz, Rn. 419 ff., Bieber/Epiney/Haag, § 9 Rn. 25, Streinz, Rn. 486
37