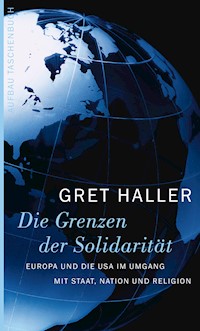Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit viel Erfahrung und analytischem Blick setzt sich Gret Haller mit einem politischen Gebilde auseinander, das heute 27 ganz unterschiedliche Mitgliedstaaten zählt und 448,4 Millionen Menschen zusammenführt: der Europäischen Union. Nach den Schrecken der beiden Weltkriege verzichteten sechs Staaten auf einen Teil der nationalen Souveränität und gründeten 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Deren wichtigstes Anliegen war Kriegsvermeidung. Damit war der Grundstein für ein bislang einmaliges transnationales Gemeinwesen gelegt. Hallers Augenmerk liegt auf dem institutionellen und menschlichen Geflecht dieser heterogenen Union. »Wenn es eine politische Kultur der Union gibt, so besteht sie eher in der Art und Weise, wie sich die verschiedenen politischen Kulturen der Mitgliedstaaten aufeinander beziehen, sich gegenseitig beeinflussen und dennoch ihre Unterschiedlichkeit beibehalten.« In der Wahrung und Akzeptanz der Andersartigkeit sieht sie die Chance für Verständigung. Angesichts erstarkender totalitärer Systeme, aber auch der EU-feindlichen Strömungen innerhalb Europas ist dieses Buch ein Beitrag zur Rückbesinnung auf die demokratischen und rechtsstaatlichen Grundwerte sowie auf die Friedensinitiative, die die Europäische Union begründete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gret Haller
Europas eigener Weg
Gret Haller
Europas eigener Weg
Politische Kultur in der Europäischen Union
Rotpunktverlag
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
© 2024 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagbild: marqs / photocase.de
Autorinnenfoto: Andreas Zimmermann
Lektorat: Christiane Schmidt
Korrektorat: Sarah Schroepf
eISBN 978-3-03973-034-6
1. Auflage 2024
Inhalt
Einleitung
1 Historische Entwicklung
Europäische Union und Staatlichkeit
Staat und Nation
Nationalstaaten und ihre imperiale Vergangenheit
Das Individuum im Nationalstaat
Das Individuum in der Europäischen Union
2 Anthropologische Aspekte
Die Einzelnen in der Gesellschaft
Politisches Vertrauen unter Fremden
Bürgersouveränität
Sich wandelnde Menschenbilder in Europa
Distanz als Voraussetzung politischer Verständigung I
3 Institutionelle Praxis
Vom Nationalstaat zum Mitgliedstaat
Die Achtung nationaler Identität
Recht und Politik, Berlin und Paris
Schlüsselbegriff Unionsbürgerschaft
Distanz als Voraussetzung politischer Verständigung II
4 Weiterentwicklung und Widerstände
Verbindung von drei politischen Regimen
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
Rechtspopulismus und die Bedeutung der Familie
Geopolitische Aspekte und das transatlantische Verhältnis
Distanz als Voraussetzung politischer Verständigung III
5 Politische Kultur
Die neue Rolle der Nation
Von der Nation zur Unionsbürgerschaft
Machtteilung und Konkordanz
Die Friedensperspektive
Ausblick
Dank
Anmerkungen
Literatur
Autorin
Einleitung
Was hält die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zusammen? Wie ist sie zu dem geworden, was sie heute ist? Und wie kann sie sich auf dieser Grundlage weiterentwickeln?
Diese Fragen können aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beantwortet werden. In der historischen Abfolge stand zu Beginn und noch viele Jahrzehnte der Wunsch im Vordergrund, aus der Kriegslogik auszubrechen, die diesen Kontinent bis 1945 dominiert hatte. Die 1951 erfolgte Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl stand ganz in diesem Zeichen.
Eine zweite klassische Antwort betrifft die Methode, mittels welcher die Vorgängerorganisationen der heutigen Union die europäische Integration ins Werk setzten: Grundlage der Europäischen Union sind Rechtsnormen, die entweder direkt im EU-Vertrag enthalten sind oder durch die Institutionen festgelegt werden, die dieser Vertrag geschaffen hat.
Eine dritte gängige Analyse stützt sich auf materielle Notwendigkeiten und geopolitische Zwänge. Zu Beginn und noch während des Kalten Krieges stand das Blockdenken im Vordergrund. Danach hofften einige auf zunehmende Deregulierung. Diese Phase wurde wiederum durch die Reaktion auf mannigfaltige Krisensituationen abgelöst, die nur durch verstärktes Zusammenstehen bewältigt werden konnten.
Hier wird nun vorgeschlagen, einer vierten Antwort nachzugehen, nämlich jener der politischen Kultur, die sich in unterschiedlicher Ausprägung einerseits auf europäischer Ebene und andererseits in den einzelnen Mitgliedstaaten findet. Dieser Ansatz steht zu den drei bereits genannten nicht im Widerspruch, bietet aber einen Schlüssel zum Verständnis der politischen Funktionsweisen Europas.
Unter politischer Kultur wird hier zweierlei verstanden. Zum einen geht es um die Institutionen, also darum, wie die Menschen das Politische institutionell einrichten. Zum anderen interessiert die Art und Weise, wie sich die Menschen zu diesen Institutionen verhalten oder nicht verhalten. Politische Kultur gehört zur Kultur im Allgemeinen, wenn sie nicht sogar als Voraussetzung für alles Kulturelle gesehen werden muss.
Die verschiedenen politischen Kulturen der Mitgliedstaaten vereinheitlichen sich nicht einfach in der Union. Wenn es eine politische Kultur der Union gibt, so besteht sie in der Art und Weise, wie sich die verschiedenen politischen Kulturen der Mitgliedstaaten aufeinander beziehen, sich gegenseitig beeinflussen und dennoch ihre Unterschiedlichkeit bewahren.
Politische Institutionen werden von Menschen ausgestaltet und durch sie belebt. Die Beschreibung politischer Kultur muss also von beidem ausgehen, von den Menschen und den politischen Institutionen. Im Folgenden befasst sich ein erstes Kapitel mit der Entwicklung der staatlichen und überstaatlichen Institutionen. In einem zweiten Kapitel wird nicht mehr von den Institutionen ausgegangen, sondern umgekehrt im anthropologischen Sinne vom Menschen. Diese beiden Aspekte werden im dritten Kapitel gemeinsam betrachtet, sie werden gegenseitig in Beziehung gesetzt, und es wird die sich daraus ergebende institutionelle Praxis der Europäischen Union beschrieben.
Die Weiterentwicklung der Europäischen Union ist Gegenstand des vierten Kapitels, immer mit Blick auf die politische Kultur. Widerstände spielen eine Rolle, insbesondere Angriffe auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie rechtspopulistische Bewegungen. Auch das transatlantische Verhältnis wird thematisiert. Im fünften Kapitel schließlich wird versucht, aus dem bisher Dargelegten die verschiedenen Aspekte politischer Kultur zusammenzufassen und einen Bezug zu einem allgemeinen Kulturbegriff herzustellen. Die Rolle der Machtteilung in der Union, die Bedeutung der Friedensperspektive und ein Ausblick schließen den Text ab.
Nach über siebzig Jahren Entwicklung seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl hat die Union eine weltweit einzigartige Funktionsweise entwickelt, welche die politische Kultur Europas ausmacht. Rückblickend zeigt sich in einigen Details eine Vergleichbarkeit oder sogar Weiterentwicklung der Errungenschaften der Französischen Revolution, aus der damals der Nationalstaat in seiner heutigen Form hervorgegangen ist. Die europäische Integration hat der Nation eine neue Rolle zugeschrieben, wobei die Unionsbürgerschaft das Erbe bestimmter Funktionen dieser Nation angetreten hat.
1 Historische Entwicklung
Mit dem Entstehen der Europäischen Union kam nach dem Zweiten Weltkrieg eine Bewegung in Gang, die weltweit einmalig ist. Sechs europäische Staaten gründeten 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und schufen für diese beiden kriegswichtigen Güter einen Binnenmarkt unter der Aufsicht einer supranationalen Behörde. Grundlage dazu war der am 9. Mai 1950 proklamierte Schuman-Plan des französischen Außenministers Robert Schuman. Der Plan war maßgeblich von Jean Monnet erarbeitet worden, damals Generalkommissar für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Frankreichs nach dem Krieg. Monnet wurde auch zum ersten Präsidenten der sogenannten Hohen Behörde der EGKS.1
Mit dieser Gründung kam ein transnationales Gemeinwesen erstmals in einem Modus zustande, der bislang unbekannt war. Das Neue war der freiwillige Verzicht auf Teile der nationalen Souveränität. Er ist nur angesichts des unermesslichen Leids zu verstehen, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch zwei Weltkriege und den Holocaust über Europa kam. Vor der Einsicht, dass dieses Geschehen auf ein uneingeschränktes Verständnis von nationaler Souveränität zurückzuführen war, konnte niemand die Augen verschließen. Kriegsvermeidung war das auch äußerlich sichtbar wichtigste Anliegen bei der Gründung der EGKS. Nur dieses rechtfertigte die Schaffung der neuen Behörde mit supranationalen Kompetenzen.
Supranationalität kennzeichnete auch die europäischen Organisationen, die 1957 neben die EGKS traten, die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Diese drei Organisationen wurden 1965 zur Europäischen Gemeinschaft (EG) zusammengeführt. 1992 erfolgte dann die Gründung der Europäischen Union, die der bisherigen wirtschaftlich ausgerichteten EWG/EG deutlich politische Elemente hinzufügte. Mit dem 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon wurden die verschiedenen Vorgängerorganisationen schließlich zur Europäischen Union (EU) mit eigener Rechtspersönlichkeit vereinigt. Vorangegangen waren nach den Römer Gründungsverträgen von 1957 die Einheitliche Europäische Akte von 1986 sowie die Verträge von Maastricht 1992, von Amsterdam 1997 und von Nizza 2001. Nachdem der Verfassungsvertrag aufgrund von Referenden in Frankreich und in den Niederlanden gescheitert war, fanden viele der dort vorgesehenen Neuerungen Eingang in den Vertrag von Lissabon.
In allen Entwicklungsschritten folgte die europäische Integration immer einer Kombination des supranationalen mit dem intergouvernementalen Ansatz. Während supranational bedeutet, dass die Hoheitsgewalt auf eine übernationale Ebene übertragen wird, belässt das intergouvernementale Vorgehen die Souveränität bei den Staaten, verbindet sie aber transnational, sodass sich die verschiedenen Regierungsvertreterinnen und -vertreter einigen müssen. Der Europäische Rat (ER), in dem die Staats- und Regierungschefs eine Art Präsidium wahrnehmen, folgt klar der intergouvernementalen Methode. Diese Kombination supranationaler und intergouvernementaler Elemente macht das europäische Gemeinwesen zu etwas Neuem, für das es bis anhin keine Vorbilder gibt.2
Europäische Union und Staatlichkeit
Bei der Gründung der EGKS war eine Art partieller Bundesstaat geplant, eingeschränkt auf die hoheitliche Verfügungsgewalt über die beiden kriegsnotwendigen Güter. Ob die EU zu einem Bundesstaat oder nur zu einem Staatenbund werden solle, wurde vor allem im deutschsprachigen Raum diskutiert. Daran wurde die Verengung der Sicht auf das deutsche Staats- und Verfassungsrecht kritisiert. Ins Spiel brachte man auch die Bezeichnung Bund. Gegen diese Wortwahl trat von zwei entgegengesetzten Seiten Widerspruch auf den Plan. Die einen sahen in ihr »zu viel Europa«, weil sie bereits in Richtung Bundesstaat führe. Die andern befürchteten einen Rückschritt der europäischen Integration, weil die Wortwahl an den Bund der Vaterländer erinnere, also an einen Staatenbund. Im französischen Sprachraum kam die Théorie de la Fédération auf. Schon Robert Schuman hatte das vorgeschlagene Integrationsprojekt in seinen ersten Entwürfen als »Fédération« bezeichnet, hatte dann aber auf diesen Begriff verzichtet, weil er Assoziationen an eine Staatsgründung hätte auslösen können. Im Anschluss an ein Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts wird heute im deutschsprachigen Raum für die Union oft der Begriff des »Verbundes« verwendet, auch weil damit verschiedene Wortkombinationen möglich werden, Staatenverbund, Verfassungsverbund oder Verwaltungsverbund, um nur einige zu nennen.3
Wenn die Frage nach der Staatlichkeit der Union immer wieder gestellt worden ist, so liegt das auch am Staatsbegriff an sich. In demokratischen Rechtsstaaten geht Recht aus Politik hervor, und politische Verfahren folgen klaren rechtlichen Regeln, sodass sich Recht und Politik gegenseitig bedingen. Dieser gegenseitige Bezug überschreitet in der Europäischen Union nun den nur staatlichen Rahmen. Das stellt neue Anforderungen an Recht und Politik jenseits einer traditionellen Staatlichkeit. In der Praxis wird die Entstehung von Recht damit transnational, und es ergibt sich eine neue Kategorie, die des Europarechts. Dieses unterscheidet sich vom traditionellen Völkerrecht, indem es über supranationale Qualität verfügt.
Inzwischen scheint sich die Ansicht mehrheitlich durchgesetzt zu haben, dass die EU nicht nur kein Staat ist, sondern auch nicht zu einem werden soll. Eine neuere französische Publikation wählt eine klare Zuordnung, indem sie im Rahmen der Union den Begriff État dem Staat vorbehält, der durch den Beitritt zur Europäischen Union vom souveränen Staat im traditionellen nationalstaatlichen Sinne zum EU-Mitgliedstaat wird. Das kleingeschriebene état bezeichnet demgegenüber den Zustand der Union im Sinne ihrer Verfasstheit. Die EU selbst wird als Fédération bezeichnet; darauf kommt das dritte Kapitel zurück.4
Die Kontroverse »mehr oder weniger Europa« kann längst nicht mehr auf die Frage Staatenbund oder Bundesstaat zurückgeführt werden, was eine Polarität nur zwischen den Mitgliedstaaten und der Union voraussetzt. In einer hier nur sinnbildlich verwendeten Darstellung, in der das Kräfteverhältnis zwischen der Union und den Mitgliedstaaten auf einer Achse liegt, ist diese Achse längst zu einer Seite eines Dreiecks geworden, deren gegenüberliegende Ecke vom Individuum bestimmt wird.
Zwar hatte Jean Monnet zur Erläuterung des Schuman-Planes 1952 präzisiert, es gehe darum, Menschen und nicht Staaten zusammenzuführen. Dennoch stand bei der Gründung der EGKS nicht das Individuum im Vordergrund, sondern nationale Interessen wirtschaftlicher und friedenspolitischer Natur. Die erste Aufwertung des Einzelnen begann durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) schon 1963 und wurde durch die Idee des Binnenmarkts verstärkt, die sich in den achtziger Jahren konkretisierte. Dadurch wurde das Individuum mit Befugnissen ausgestattet, die es zum eigentlichen Akteur der europäischen Integration werden ließen. Darauf wird im dritten Kapitel eingegangen. Über die wirtschaftlichen Grundfreiheiten hinaus fanden die Rechte des Individuums 1992 ihren Niederschlag formell in der Unionsbürgerschaft, die neben die Staatsbürgerschaft tritt, diese aber nicht ersetzt.5
Sogar die Formulierung »immer engere Verbindung der Völker« gemäß Präambel des EU-Vertrags kann heute dahingehend verstanden werden, dass sie sich nicht vor allem auf die institutionelle Entwicklung der Union bezieht, sondern auf eine Stärkung der europäischen politischen Identität des Individuums, die neben seine nationale politische Identität tritt. Interessant ist diesbezüglich die Veränderung in der Definition des Europäischen Parlaments (EP) durch Artikel 14 Absatz 2 des heute geltenden Vertrags von Lissabon. Während zuvor gemäß Artikel 189 des EG-Vertrags noch von einer Vertretung »der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten« die Rede war, gilt das Parlament nun als Vertretung »der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger«.6
Im Hinblick auf die politische Kultur in der Union ist es durchaus sinnvoll, vom Individuum auszugehen. In der einzelnen Person kommen die verschiedenen Aspekte zusammen, die sich aus der politischen Identität auf den verschiedenen Ebenen ableiten und die individuell unterschiedlich gewichtet werden. Darauf wird im zweiten Kapitel auch aus anthropologischer Sicht näher eingegangen. Zuvor stellt sich aber die Frage, welcher Form von Institutionen diese Identität überhaupt gilt.
Staat und Nation
Die Europäische Union ist ein Gemeinwesen ohne Vorbilder. Dennoch ist ein Rückblick in die Geschichte sinnvoll, was die Entwicklung verschiedener Formen von Gemeinschaften oder Staatlichkeit betrifft. Schon aus der Antike sind einige bekannt, von den griechischen Stadtstaaten bis zu den großen Reichen, deren letztes das römische Großreich. Monarchien als kleinere Gebietseinheiten oder als größere Reiche prägten das Mittelalter; sie standen in Auseinandersetzung mit der Kirche, die ebenfalls Gebietsansprüche geltend machte. Zunächst in der Renaissance und dann mit den Anfängen der Aufklärung rückte das Individuum in den Blick, wenn auch beschränkt auf Adlige und anderweitig privilegierte Personen. Die entscheidende und bis heute wirksame Entwicklung setzte mit dem gleichzeitig beginnenden Kolonialismus ein. Was die Staatenbildung anbelangt, hat dieser in letzter Konsequenz dazu geführt, dass heute die ganze Welt in Nationalstaaten eingeteilt ist.
Der Nationalstaat ist in Europa erfunden worden, und die europäischen Kolonialmächte haben dieses Phänomen flächendeckend exportiert. Die ersten Kolonien wurden als Territorien europäischer Monarchien begründet oder privater Handelskompanien, die dann später in den Besitz der entsprechenden Kolonialmacht übergingen. Die Bildung von Nationalstaaten hatte zunächst keinen Zusammenhang mit dem Kolonialismus, der schon Jahrhunderte vorher eingesetzt hatte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen sich die beiden Phänomene jedoch nicht mehr nur gegenseitig zu beeinflussen, sondern sie verschränkten sich.7
Nationalstaaten entstanden als eine Folge der Modernisierung. Diese brachte eine zunehmende Individualisierung, eine Loslösung der einzelnen Menschen von der Bindung an Herkunft, an Familie, Verwandtschaft, Dorfgemeinschaft oder Religion. Im Laufe des 18. Jahrhunderts hatte die Verbreitung von aufklärerischem Gedankengut zunehmend Autoritäten in Frage gestellt, Feudalherren, Priester, Zunftmeister und nicht zuletzt Familienoberhäupter. Längst nicht alle Menschen konnten es sich – ökonomisch und psychologisch – leisten, sich von der Abhängigkeit von solchen Autoritäten zu emanzipieren, Männer weitaus eher als Frauen, Knechte und Mägde ohnehin kaum. Wer sich aber die Hinwendung zum neuen Gedankengut leisten konnte, strebte danach, von religiösen, ständischen und sonstigen rechtlichen Einschränkungen befreit zu leben, was letztlich zu der Vorstellung freier und gleicher Individuen führte. Im Bereich der politischen Philosophie gilt die Nationalstaatenbildung geradezu als Muster der Modernität. Am deutlichsten manifestiert sich der Paradigmenwechsel in der Französischen Revolution und deren Folgen. Diese Revolution hat die Nation zu dem gemacht, was heute weltweit darunter verstanden wird.
Schon im späten Mittelalter kam dem Begriff der Nation für adlige Herrscher und in Bildungseliten politische Bedeutung zu. Wenn Herrscher Gebietsansprüche über die bisherigen Grenzen hinaus geltend machten, beriefen sie sich häufig auf nationalistische Zugehörigkeiten. Die damalige Verwendung des Begriffs bezog allerdings die Bevölkerung nicht mit ein. Erst mit der Revolution in Frankreich kam die Demokratie ins Spiel und schlug sich die Vorstellung des Volks aus freien und gleichen Individuen in den Begriffen Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit nieder, dem ideologischen Dreigestirn dieser Revolution. Schrittweise wurde die Monarchie abgeschafft, und die neue Losung hieß Volkssouveränität.
Allerdings führte die so bewirkte Umwandlung des Staates weg von der Monarchie zu einer Art Identifikationsvakuum. Die neuen Begriffe, welche die Revolution auf ihre Fahnen schrieb, waren zu abstrakt, als dass sie die Individuen affektiv hätten ansprechen können. Der Staat allein hätte diese Lücke nicht füllen können. Benötigt wurde deshalb ein Gefäß, das den Individuen Beheimatung bot. Dieses Gefäß bildete nun die Nation, der eine neue Bedeutung zukam. Der französische Staat und die neu definierte Nation gingen eine tragfähige Verbindung ein.8
Die Nation wurde zum Inbegriff von Freiheit und Gleichheit, und die Idee der Demokratie verknüpfte sich unauflöslich mit der Vorstellung des Nationalstaats. Demokratien entwickelten sich in den folgenden Jahrhunderten praktisch ausnahmslos im Rahmen von Nationalstaaten. Ausgehend von Europa, erschien die Bildung von Nationalstaaten einer immer breiter werdenden Bevölkerung geradezu als Versprechen von demokratischer Mitbestimmung; Revolutionen wurden dafür in Kauf genommen, obwohl sie immer auch mit Unsicherheit und Gewalttätigkeit verbunden sind.
Anders in den kolonisierten Gebieten, in denen Nationalstaaten durch die Kolonialmacht teils durch mit dem Lineal gezogenen Strichen auf Landkarten geschaffen wurden. Von Demokratie konnte hier keine Rede sein; Kolonien sind vielmehr geprägt von Unterdrückung und Ausbeutung. Der Nationalstaat ist keine Garantie für Demokratie. Vielfach wurden demokratische Ansätze in einzelnen Nationalstaaten wieder ausgelöscht, oder es wandelten sich Demokratien zu Diktaturen. Von antidemokratischen Ansätzen sogar in Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird im vierten Kapitel die Rede sein. All dies ändert nichts daran, dass der Nationalstaat durch die Französische Revolution im Zeichen der Demokratie aus der Taufe gehoben wurde.9
Wenn sich diese Entwicklung für das Individuum in der erwähnten Loslösung von Familie, Religion und im Verlassen der Dorfgemeinschaft manifestierte und oft auch in der Suche nach einer Existenz in einem mehr städtischen Umfeld, so darf nicht ausgeblendet werden, dass sich in den Städten Elendsquartiere bildeten und ausdehnten. Armut wurde nicht mehr durch den sozialen Rückhalt der Dorf- oder anderer Gemeinschaften aufgefangen, sodass dem neu erstandenen Nationalstaat auch die Aufgabe zukam, sich um das Wohlergehen der Bevölkerung zu kümmern. Konnte diese Aufgabe nicht wenigstens annähernd erfüllt werden, erhielten ursprünglich demokratisch motivierte Revolutionen auch eine soziale Komponente, was vor allem die Entwicklung der Französischen Revolution entscheidend beeinflusst hat.
Wie die Nation ist auch der souveräne Staat eine europäische Erfindung. Die Grenzziehung von Staaten nach außen kam im ausgehenden 15. Jahrhundert auf; die beschriebene Verbindung des Staates mit dem durch die Französische Revolution neu definierten volkssouveränen Gedanken der Nation begann erst dreihundert Jahre später. Als Hoffnungsträgerin für das Entstehen einer Demokratie gelten Nationen erst seit dem späten 18. Jahrhundert. Zuvor war der Begriff für ethnische Gruppierungen verwendet worden, nur vereinzelt auch für Staaten; so hat sich England schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts als nation bezeichnet. Heute wird Nation durchweg mit Nationalstaat gleichgesetzt, weshalb die 1945 geschaffene weltweite Staatenorganisation Vereinte Nationen heißt. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet national heute einzelstaatlich und ist der Gegenbegriff zu international, transnational, multinational oder supranational.
Nationalstaaten und ihre imperiale Vergangenheit
Ein Staat ist räumlich durch seine Außengrenzen definiert. Die Nation bestimmt sich demgegenüber durch kulturelle Einheitlichkeit. Die beiden Begrifflichkeiten sind nicht kongruent. Als sich Staat und Nation für die Nationalstaatenbildung verbanden, entstand der Druck, die beiden Bereiche in Übereinstimmung zu bringen. Deshalb führte die Nationalstaatenbildung fast durchgehend zu Gewalt gegen innen und gegen außen. Durch Kriege wurden Staatsgrenzen verschoben und sollten so mit Grenzen kulturell definierter Volksgruppen in Übereinstimmung gebracht werden. Umgekehrt wurden ethnische Gruppen, die man als nicht zugehörig zur nationalen Kultur definierte, über die Staatsgrenzen hinaus vertrieben oder ausgelöscht. Gewalt gegen innen zeigte sich vor allem in Staaten, die schon lange bestanden und in denen regionale Sprachen und Kulturen nun als fremd erklärt und unterdrückt wurden, um eine vermeintliche kulturelle Einheitlichkeit zu erreichen. Gemeinsam ist all diesen Vorgängen, dass die Differenzen zwischen dem »wir« und »den Anderen« vertieft werden, was zu klaren Feindbildern führt.10
Beschreibungen der Entstehungsgeschichte der Europäischen Union gehen in der Regel davon aus, dass die ihr angehörenden Staaten auf eine längere oder kürzere Existenzphase als Nationalstaat zurückblicken können. Diese sei dann durch die EU-Mitgliedschaft mit dem Übergang vom Nationalstaat zum EU-Mitgliedstaat abgelöst worden.
Schon in den achtziger Jahren hat Ernest Gellner darauf hingewiesen, dass im europäischen Ost-West-Verhältnis verschiedene Nationalismen unterschieden werden sollten. Dem Einigungsnationalismus für eine bestehende Hochkultur, wie die englische und die französische, später auch die italienische und die deutsche, stellt er die von ihm sogenannte Habsburgform des Nationalismus gegenüber, die sich auch in Ländern südlich und östlich der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie finde. In diesen Großreichen lebten viele unterschiedliche Völker zusammen, also ethnische Gruppierungen. Zwar habe es eine zentrale Hochkultur gegeben, aber der privilegierte Zugang zu ihr sei den Machthabenden vorbehalten gewesen. Demgegenüber hätten die ethnischen Gruppierungen zwar über eigene Volkskulturen verfügt, hätten aber kaum Zugang zu Bildung und Macht gehabt, die ausschließlich über die Hochkultur vermittelt worden sei. Aufgrund dieser Situation hätten solche ethnischen Gruppierungen Unabhängigkeit von der Hochkultur in einem eigenen Nationalstaat angestrebt, indem sie ihre Volkskulturen zu Nationalismen emporstilisiert hätten.11
Eine neuere Diskussion befasst sich auf eine ähnliche Weise mit dem Ost-West-Verhältnis innerhalb der Europäischen Union. Die bislang unbestrittene Sicht, dass alle europäischen Staaten vor ihrer Mitgliedschaft auf eine Geschichte als Nationalstaaten zurückblicken könnten, wird in Frage gestellt. Es wird auf die imperiale Vergangenheit einiger westeuropäischer Staaten verwiesen. Zugespitzt wird die These vertreten, viele der westeuropäischen Staaten seien nie eigentliche Nationalstaaten gewesen, sondern Imperien, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der europäischen Integration einen Ausweg gefunden hätten, um den Niedergang des Kolonialismus aufzufangen. Dieser Kritik geht es nicht um die Frage, ob und inwieweit die Außenbeziehungen der Europäischen Union heute imperialistische Aspekte aufweisen, sondern lediglich um die Einordnung der damaligen Motivation dieser Staaten, die europäische Integration voranzubringen. Es habe zwischen der Zeit als Imperium und der europäischen Integration keine Zwischenphase gegeben, in der diese Staaten als Nationalstaaten souverän gewesen seien und sich isoliert entwickelt hätten.12
Diese Sicht hat eine gewisse Plausibilität, auch in Hinblick auf die Überlegungen Gellners zum Habsburgnationalismus. Eine neuere Analyse des unterschiedlichen Nationenverständnisses in West- und Ostmitteleuropa ergibt, dass erst seit 2004 mit der EU-Osterweiterung Länder zu EU-Mitgliedstaaten werden oder den Status von Beitrittskandidaten erreichen, die früher in größere Verbände eingebunden waren wie das Habsburgische, das russische oder das osmanische Reich. Solche Länder würden noch heute von dem Selbstbild zehren, sich als früher Unterworfene großer Staatsideologien von diesen befreit zu haben. Den Staatsideologien, zu denen auch der Staatssozialismus zählt, haben diese Staaten ihren Selbstbehauptungswillen entgegengesetzt, mit anderen Worten ihre Eigenentwicklung, eine Erfahrung, welche die westeuropäischen Staaten mit imperialer Vergangenheit nie gemacht haben. Dass in einer solchen Befindlichkeit ostmitteleuropäischer Länder Brüssel unversehens als das neue Wien, Byzanz oder Moskau gesehen werden kann, liegt auf der Hand.13
Die Verschränkung von Kolonialismus und Nationalstaatenbildung begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der Expansion nach außen folgten die imperialen europäischen Mächte ihrem zivilisatorischen Missionsgedanken. Die Kolonisierung und Ausbeutung der außereuropäischen Gebiete war aber auch mit der Erwartung sozialer Reformen im Innern dieser Staaten verbunden. Vom Nationalstaat wurde Vorsorge und Wohlfahrtsstaatlichkeit erwartet, und die Gewinne der kolonialen Ausbeutung sollten genauso dazu dienen, die Wohlfahrt im Mutterland weiter auszubauen. Mit einer heute in Europa unvorstellbaren Selbstverständlichkeit ging man auf diesem Kontinent davon aus, dass es sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der kolonisierten Gebiete nicht um Menschen mit denselben Bedürfnissen und derselben Würde handelte.
Die Universalität, welche die Französische Revolution den Menschenrechten zugesprochen hatte, wurde lange Zeit blind verletzt. Erst mit der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einsetzenden Dekolonisierung gelangte diese Ungeheuerlichkeit schrittweise ins europäische Bewusstsein. Dieser Prozess ist noch längst nicht abgeschlossen und hat in der Klimakrise eine neue Aktualität erlangt. Dennoch hat dieselbe Revolution die Grundlage für die europäische Nationalstaatenbildung hervorgebracht und damit die Hoffnung auf Freiheit und Demokratie.14
Die Beschreibung der politischen Kultur in der Europäischen Union kann diesen Widersprüchen im Umgang mit den Errungenschaften der Französischen Revolution,