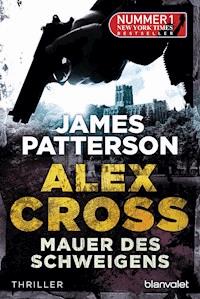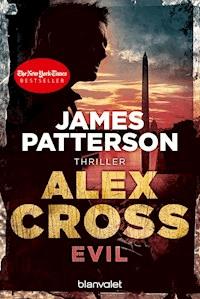
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Seine Familie ist sein ein und alles – doch es ist zu spät, um sie zu beschützen ...
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Nichts bedeutet Detective Alex Cross mehr als seine Kinder, seine Großmutter und seine Ehefrau Bree. Doch die Liebe für seine Familie wird ihm zum Verhängnis, als er ins Visier des skrupellosen Psychopathen Marcus Sunday gerät. Dessen Ziel ist es, ein für alle Mal zu beweisen, dass er das überragendste kriminelle Genie in der Geschichte des Verbrechens ist. Während Alex im Fall eines grausamen Massenmords in einem Massagesalon in Washington, D.C. ermittelt, beobachtet Sunday ihn unablässig. Und nicht nur ihn, sondern auch seine Familie – denn er hat einen Plan, wie er Alex Cross‘ größte Stärke als Waffe gegen ihn einsetzen kann.
Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Detective Alex Cross und sein Partner John Sampson ermitteln im Fall eines grausamen Massenmords in einem schäbigen Massagesalon in Washington, D. C., doch sie tappen im Dunkeln. Alle Spuren verlaufen im Sande – bis sie einen Hinweis von einem Unbekannten erhalten. Gleichzeitig hat Alex auch privat alle Hände voll zu tun, denn bei der Familie Cross findet eine Hausrenovierung statt. Und so bemerkt Alex Cross nicht, dass er genau beobachtet wird. Sein schlimmster Gegner lauert im Hinterhalt auf ihn, und dieser hat einen Plan, wie er ihn leiden lassen kann. Er wird Alex Cross seine Familie nehmen – die Menschen, die für den Ermittler die Welt bedeuten. Um seine Ehefrau Bree, seine Kinder und seine Großmutter zu beschützen, würde Alex alles tun. Doch sollte er auch nur versuchen, um sie zu kämpfen, müssen sie alle sterben. Was kann Alex Cross einem solch übermächtigen Feind entgegensetzen?
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
EVIL
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Cross My Heart« bei Little, Brown and Company, New York.
Copyright der Originalausgabe © 2013 by James Patterson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
AF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19048-4V002
www.blanvalet.de
PrologEs geschah in der Osternacht
Ziellos schleppte ich mich durch die dunklen, menschenleeren Straßen von Washington, verfolgt von Erinnerungen an meinen Sohn Ali. Er erklärte mir immer wieder, dass es nur eine Möglichkeit gibt, einen Zombie zu töten: Man muss sein Gehirn zerstören.
Es war drei Uhr nachts. Stürme peitschten die Stadt.
Ich war schon mehrere Stunden unterwegs, aber ich empfand weder Hunger noch Durst noch Müdigkeit. Blitze rissen den Himmel entzwei, während hoch über mir Donnerschläge dröhnten, aber ich reagierte kaum. Nicht einmal der prasselnde Regen konnte mich aufhalten oder den grausamen Schmerz stillen, der meinen gesamten Körper in Besitz genommen hatte. Bei jedem Schritt sah ich in Gedanken Ali, Bree, Damon, Jannie und Nana Mama vor mir. Bei jedem Schritt flammte das Entsetzen über das Schicksal, das sie erlitten hatten, erneut in mir auf, genau wie die Einsamkeit und die Trauer und die Wut.
Hatte Thierry Mulch genau das bezweckt? Diese Frage ließ mich nicht mehr los.
Thierry Mulch hatte alles zerstört, was mir wichtig war, alles, woran ich geglaubt hatte. Er hatte mich ausgeweidet und als lebloses, seelenloses Etwas zurückgelassen, verdammt zu endloser, sinnloser Bewegung.
Während ich weitertaumelte, bestand meine einzige Hoffnung darin, dass Mulch oder irgendein anderer, anonymer Großstadträuber sich an mich heranmachte, um mir mit einer Schrotflinte oder einer Axt den Schädel zu zerschmettern.
Das war mein sehnlichster Wunsch.
Erster TeilVor sechzehn Tagen …
1
1 Es war ein wunderschöner Morgen im April. Marcus Sunday saß in einem Lieferwagen am Straßenrand und beobachtete mit seinem hochauflösenden Leica-Fernglas das Haus von Alex Cross in der Fifth Street. Der Gedanke, dass er den berühmten Detective schon im Lauf der nächsten halben Stunde zu Gesicht bekommen würde, erfüllte ihn mit großer Aufregung.
Schließlich war es Donnerstagmorgen – halb acht, um genau zu sein –, und Cross musste arbeiten. Genau wie seine Frau. Und seine Kinder mussten zur Schule.
Kaum hatte Sunday diesen Gedanken zu Ende gedacht, kam Regina Hope, Cross’ einundneunzigjährige Großmutter, nach dem Besuch der Messe in der St. Anthony’s Catholic Church den Bürgersteig entlang. Die alte Dame war alles andere als gebrechlich und legte trotz des Gehstocks ein erstaunliches Tempo an den Tag. Sie ging direkt an seinem Lieferwagen vorbei und würdigte ihn kaum eines Blicks.
Wieso auch?
Sunday hatte ein paar magnetische Schilder mit der Aufschrift »Over the Moon Vacuum Cleaner Company« daran befestigt. Er selbst saß hinter getönten Fensterscheiben und trug eine Uniform mit genau derselben Aufschrift – ein echtes Schnäppchen von der Heilsarmee. Passte wie angegossen.
Die gebrauchten Staubsauger im Laderaum des Lieferwagens hatte er für sechzig Dollar das Stück in einem Secondhandladen draußen in Potomac gekauft. Die falschen Magnetschilder hatte er online bei Kinko’s bestellt, genau wie das Namensschild auf seiner linken Hemdtasche. Darauf stand: »Thierry Mulch.«
Als Cross’ Großmutter das Haus betrat, warf Sunday – ein schlanker, durchtrainierter Enddreißiger mit kurz geschnittenem, grau meliertem Haar und schiefergrauen Augen – einen Blick auf seine Armbanduhr. Dann griff er nach dem schwarzen Ordner, der zwischen dem Fahrersitz und der Mittelkonsole lag.
Er klappte ihn auf. Die ersten fünf Trennblätter waren beschriftet, alle mit einem anderen Namen: Bree Stone, Ali Cross, Jannie Cross, Damon Cross, Regina Hope alias »Nana Mama«.
Sunday schlug die Seiten von Regina Hope/Nana Mama auf und trug die genaue Zeit ein, zu der die alte Dame das Haus betreten hatte, und außerdem die Richtung, aus der sie gekommen war. Dann, während er darauf wartete, wer sich als Nächstes sehen ließ, blätterte er ganz nach hinten zu den vier kopierten Seiten, auf denen die Grundrisse sämtlicher Stockwerke des Hauses zu sehen waren. Sie waren praktischerweise im letzten Monat beim Bauamt der Stadt eingereicht worden, zusammen mit Cross’ Antrag auf einen Anbau am hinteren Teil des Hauses sowie die Genehmigung von Renovierungsarbeiten in der Küche und den Badezimmern.
Während Sunday abwechselnd die Grundrisse und das Haus selbst betrachtete, machte er sich Notizen, markierte Aus- und Eingänge, die Position der Fenster, die Gartenbeete, all solche Dinge eben. Und als Cross’ Ehefrau, Bree Stone, ebenfalls Detective beim Metropolitan Police Department von Washington, D. C., um 7.40 Uhr auf die Veranda trat und Vogelfutter in ein Vogelhäuschen füllte, notierte er diese Handlung ebenso wie die Tatsache, dass ihr Hinterteil in der knappen Jeans fantastisch zur Geltung kam.
Um 7.52 Uhr hielt ein Laster mit der Aufschrift »Dear Old House« vor Cross’ Haus, dicht gefolgt vom Wagen einer Entsorgungsfirma, die einen großen Schuttcontainer brachte. Und da war ja auch schon der große Detective höchstpersönlich, stellte sich auf die Veranda, begrüßte die Bauarbeiter und sah zu, wie der Container auf die Straße gestellt wurde. Begleitet wurde er von seiner Großmutter, seiner Frau und zweien seiner drei Kinder: der fünfzehn Jahre alten Jannie und dem sieben Jahre alten Ali.
Eine nette, glückliche Familie, dachte Sunday und betrachtete sie abwechselnd durch das Fernglas. Vor ihnen lag, so hatte es den Anschein, eine glänzende Zukunft. Vielversprechend. Oder etwa nicht?
Sunday gestattete sich ein Lächeln und dachte dabei, dass die Planungen, die Vorbereitungen, die freudige Erwartung, die zu jedem neuen Abenteuer gehörten, einen großen Teil des Vergnügens ausmachten. Vielleicht sogar mehr als fünfzig Prozent, dachte er, während sein stets schöpferisches Hirn diverse düstere Szenarien hervorbrachte, wie dieses Traumfamilien-Szenario, das sich da vor ihm aufgebaut hatte, zerstört werden konnte.
Dann marschierten Dr. Alex und seine Kinder los. Sie gingen auf der gegenüberliegenden Straßenseite an Sunday vorbei, doch der Detective hatte für seinen Lieferwagen kaum einen Blick übrig.
Aber noch einmal: Wieso auch?
Nachdem Cross und seine Kinder verschwunden waren, fühlte Sunday sich irgendwie leer. Wenn der Detective nicht da war, machte es einfach weniger Spaß, das Haus zu beobachten. Dann kam es ihm ein bisschen vor wie ein Labyrinth ohne Mäuse.
Sunday blickte auf seine Armbanduhr, klappte den Ordner zu und legte ihn beiseite. Er wurde von dem Gefühl ergriffen, ein freier, aufrechter Mann zu sein, der einen konkreten Plan hatte und sich nicht davon abbringen lassen würde, ganz egal, was für Folgen das haben mochte. Während er den Lieferwagen startete, dachte er, dass jedes Schwanken, jedes Zaudern fast eine Beleidigung für den Gegner war. Man muss den Gegner ebenso sehr vernichten wollen, wie dieser einen selbst vernichten will.
Sunday fuhr los, getragen von der festen Überzeugung, dass er seiner Aufgabe gewachsen war. Und genauso fest glaubte er auch, dass die Familie Cross die Gräuel verdient hatte, die auf sie warteten.
Jedes einzelne Familienmitglied.
Ganz besonders Dr. Alex.
2
2 In normalen Jahren erreicht die Zahl der Tötungsdelikte in Washington, D. C., erst während der stickigen Sommertage ihren Höhepunkt. Im Juli und August, wenn die Luft entlang des Potomac eine Temperatur und Konsistenz erreicht wie sonst nur im Maul eines tollwütigen Hundes, drehen die Leute offensichtlich reihenweise durch. Meine Kollegen und ich haben uns mittlerweile darauf eingestellt.
Doch beginnend mit einem Terroranschlag auf die Union Station an Neujahr, hatte der gesamte Winter uns in schöner Regelmäßigkeit einen Mord nach dem anderen beschert, und das hatte sich mit Anbruch des Frühlings nicht gebessert. Jetzt war es gerade erst Anfang April, und es deutete alles darauf hin, dass wir, was die Zahl der Morde anging, eines der schlimmsten Jahre erleben würden, die der District of Columbia in den vergangenen drei Dekaden gesehen hatte.
Dadurch lastete ein enormer Druck auf der Bürgermeisterin und dem Stadtrat und damit automatisch auch auf dem Leiter der Metropolitan Police. Vor allem die Einheiten der Mordkommission und des Dezernats für Gewaltverbrechen bekamen diesen Druck zu spüren. Und da ich mittlerweile abwechselnd für beide Abteilungen tätig war, bedeutete das, dass der größte Druck auf mir und meinem Partner und besten Freund, John Sampson, lag.
Seit nahezu zwei Monaten hatten wir keinen einzigen freien Tag mehr gehabt, und trotzdem schien die Arbeit mit jedem Tag noch zuzunehmen. Außerdem führte ich ständig irgendwelche Telefonate mit einem Bauunternehmer, der unsere Küche renovieren und unser Haus um einen Anbau ergänzen sollte. Darum war Captain Roelof Antonius Quintus, der Leiter der Mordkommission, der letzte Mensch, den ich an diesem Donnerstagmorgen so gegen halb zehn sehen wollte.
Er klopfte an meine Bürotür, als ich gerade mit meinem Frühstücksburrito und einer zweiten Tasse Kaffee fertig wurde. Gleichzeitig hatte ich in einem Katalog mit Küchenschränken geblättert, den meine Frau mir beim Gehen in die Hand gedrückt hatte. Sampson, eine Dampfwalze von Mann, saß auf dem Sofa und verdrückte die letzten Reste seines morgendlichen Mahls.
Er sah Quintus und stöhnte. »Nicht schon wieder einer, oder?«
Quintus schüttelte den Kopf. »Es geht lediglich um ein paar aktuelle Informationen für den Chef. Die Bürgermeisterin dreht bald durch und steht ihm permanent auf den Füßen.«
»Wir haben in dieser Woche schon drei Fälle aufgeklärt, aber Sie haben uns vier neue auf den Tisch gelegt«, sagte ich. »Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Fortschritte machen und gleichzeitig immer weiter in Rückstand geraten.«
»Genauso kommt es mir auch vor«, meinte Sampson. »Wie dieser König in der griechischen Mythologie, der immer einen Felsbrocken den Berg raufschiebt, bloß, dass er dann jedes Mal wieder zurückrollt.«
»Sisyphus«, sagte ich.
»Genau der«, sagte Sampson und richtete den Zeigefinger auf mich.
»Ach, kommen Sie schon, Cross«, sagte Quintus. »Wir zählen auf Sie. Bringen Sie ein paar von den aufsehenerregenden Fällen zu Ende, Rawlins und Kimmel zum Beispiel, damit uns die Post nicht mehr so im Nacken sitzt. Haben Sie diesen beschissenen Leitartikel gelesen?«
Hatte ich. Heute Morgen. Ein Artikel, der sich mit den Auswirkungen der zahlreichen Tötungsdelikte auf den Tourismus beschäftigte, den Polizeichef zum Rücktritt aufforderte und mit der Idee spielte, dass das FBI die gesamte Abteilung übernehmen könnte, bis die Mordrate wieder gesunken war.
»Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, Captain«, sagte ich. »Sagen Sie doch den Leuten einfach, Sie sollen aufhören, sich gegenseitig umzubringen. Dann haben wir auch mehr Zeit, um uns mit Fällen wie Rawlins oder Kimmel zu beschäftigen.«
»Sehr witzig.«
»Das war kein Witz.«
»Nein, ernsthaft, Sie sollten sich mal als Stand-up-Comedian versuchen, Cross.« Quintus wandte sich zum Gehen. »Könnte gut sein, dass Sie da Ihre wahre Berufung finden.«
3
3 Marcus Sunday trug jetzt eine schwarze Lederjacke, schwarze Jeans, ein schwarzes Polohemd und schwarze Schnürstiefel. Er eilte mit schnellen Schritten auf das New North Building mitten auf dem Gelände der Georgetown University zu. Nachdem er sich durch eine dichte Menge Studenten gezwängt hatte, gelangte er vor das hundertzwanzig Zuhörer fassende McNair-Auditorium und trat ein. Auf dem Schild am Eingang war zu lesen: »Der perfekte Verbrecher. Vorlesung, heute, 11.00 Uhr.«
Knisternde Spannung lag in der Luft. Während Sunday durch den Gang nach vorn ging, stellte er fest, dass abgesehen von dem Regiestuhl auf der Bühne alle Sitzplätze besetzt waren.
In der ersten Reihe angekommen, bemerkte Sunday auch die Studenten, die vor der Bühne auf dem Boden saßen. Lächelnd schob er sich zwischen ihnen hindurch und federte die Stufen empor, wo er dem konservativ gekleideten Graubart, der ihn bereits erwartete, die Hand schüttelte.
»Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, Herr Dr. Wolk«, sagte Sunday.
»Ich komme auch gerade erst aus der Vorlesung«, erwiderte der Mann. »Darf ich Sie vorstellen?«
»Ich bitte darum«, gab Sunday zurück und nickte ehrerbietig.
Dr. Wolk klopfte zweimal gegen das Mikrofon und sagte: »Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Dr. Wolk, Leiter der philosophischen Fakultät, und möchte Sie wieder einmal zu einer unserer Frühjahrs-Vorlesungen begrüßen, bei denen wir unterschiedliche Redner aus unterschiedlichen Forschungsfeldern zu Gast haben.« Er lächelte und fuhr fort: »Es heißt ja immer, dass das Philosophiestudium meilenweit von der Wirklichkeit entfernt sei, aber ein gut gefüllter Saal wie dieser hier straft dieses Vorurteil Lügen. Die erfinderisch-kreative Anwendung philosophischer Methoden kann zu durchschlagenden, manchmal sogar revolutionären Lösungen für die Probleme der Moderne führen. Und unser heutiger Gast ist genau für solche aufsehenerregenden, innovativen und umstrittenen Arbeiten bekannt. Sein erstes Buch, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde, trägt den Titel Der perfekte Verbrecher und beschert uns einen faszinierenden Blick auf zwei ungelöste Kriminalfälle der jüngeren Vergangenheit, beides Massenmorde. Das Buch nimmt die Perspektive eines wahrhaft unabhängigen Geistes ein und richtet den Blick in die tiefsten Tiefen einer durch und durch kriminellen Seele. Bitte begrüßen Sie Professor Marcus Sunday von der Harvard University, der während seines Sabbatjahrs den Weg hierher zu uns gefunden hat.«
Sunday grinste, stand auf und nahm Dr. Wolk das Mikrofon aus der Hand. Er ließ den Blick über die applaudierende Zuhörerschaft schweifen und blieb nur kurz bei einer außergewöhnlich attraktiven Frau in der zweiten Reihe hängen. Sie wirkte, als sei sie in Gedanken versunken. Dunkelblonde Locken ringelten sich über ihre Schultern und das prall gefüllte Tanktop. Eine farbenfrohe Tätowierung schlängelte sich um ihren linken Arm. Sie zeigte einen schwarzen Panther, der auf einem blühenden Zweig im Dschungel lag. Sein Schwanz reichte bis über den Unterarm der Frau und ringelte sich um ihr Handgelenk. Die Raubkatze besaß faszinierende Augen, leuchtend grün wie frischer, feuchter Klee. Genau wie die Frau.
»Vor fünf Jahren habe ich mit meiner Suche nach dem perfekten Verbrecher begonnen«, fing Sunday an und riss sich gewaltsam von ihrem Anblick los. »Soweit ich weiß, hat man ihn bis jetzt noch nie erforscht, noch nie gefunden. Was ja durchaus einleuchtet, denn wenn er perfekt ist, wie soll man ihn dann gefangen nehmen, nicht wahr?«
Er erntete nervöses Lachen und zustimmendes Nicken.
»Wo also fängt man mit der Suche nach einem perfekten Verbrecher an?«, fragte Sunday und ließ den Blick durch den Saal schweifen. Und da er nirgendwo einem Gesicht begegnete, das eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlte, konzentrierte er sich auf die junge Frau mit den rubinroten Lippen und den faszinierenden, kleegrünen Augen.
Sie zuckte mit den Schultern und erwiderte mit einem leichten Cajun-Akzent: »Man untersucht ungelöste Verbrechen?«
»Sehr gut«, sagte Sunday und neigte den Kopf nach links. »Genau das habe ich getan.«
Dann schilderte er zwei ungelöste Massenmorde, die im Mittelpunkt seines Buches standen. Vor sieben Jahren, zwei Tage vor Weihnachten, um genau zu sein, war die fünfköpfige Familie Daley aus einem Vorort von Omaha tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Der Mann und die Kinder hatten in ihren Betten gelegen. Jemand hatte ihnen mit einem Skalpell oder Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten. Die Frau war zwar auf ganz ähnliche Weise gestorben, lag aber nackt im Badezimmer. Die Haustüren waren entweder nicht abgeschlossen gewesen, oder der Täter hatte einen Schlüssel gehabt. Es hatte in der Nacht geschneit, sodass alle Spuren unter einer Schneedecke verschwunden waren.
Vierzehn Monate später hatte man nach einem heftigen Sturm die Monahans aus einem Vorort von Fort Worth entdeckt. Sie waren ähnlich zugerichtet worden: Der Vater und die vier Kinder, keines älter als zwölf, hatten mit aufgeschlitzten Kehlen in ihren Betten gelegen, die Frau nackt und tot auf dem Boden des Badezimmers. Die Türen waren entweder nicht abgeschlossen worden, oder der Täter besaß einen Schlüssel. Und wieder hatte die Polizei aufgrund des Regens, des Sturms und des sorgfältigen Vorgehens des Täters keinerlei verwertbare Spuren finden können, weder DNA noch sonst irgendetwas.
»Diese Leere, dieses völlig Fehlen von Indizien aller Art, das hat mich interessiert«, teilte Professor Sunday seiner gebannten Zuhörerschaft mit. »Ich bin mehrfach nach Oklahoma und Texas gereist, habe die Tatorte besichtigt, die Akten gelesen und mit allen an der Ermittlung beteiligten Behörden gesprochen – dem FBI, der Oklahoma State Police, den Texas Rangern. Anschließend wusste ich, dass die Ermittler komplett im Dunkeln tappten, dass bis auf die Leichen nicht der geringste Hinweis auf den Täter existierte.« Sunday fuhr fort, dass dieser Mangel an Indizien ihn dazu veranlasst hatte, sich Gedanken über die Weltanschauung eines perfekten Mörders zu machen. »Ich kam zu dem Schluss, dass es sich um einen moralisch außergewöhnlich zerrütteten Existenzialisten handeln muss«, sagte er. »Jemanden, der weder an Gott noch an irgendeine Art von Moral oder Ethik glaubt, der jenseits seines eigenen Tuns keinen Sinn in dieser Welt erkennt.« Sunday merkte, dass einige seiner Zuhörer ihm bereits nicht mehr folgen konnten, und schlug einen anderen Kurs ein. »Was ich damit sagen möchte, ist, dass der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski beinahe recht hat. In seinem Meisterwerk Schuld und Sühne verübt der Protagonist, Rodion Raskolnikow, um ein Haar das perfekte Verbrechen. Raskolnikow ist der Meinung, dass das Leben keinen tieferen Sinn besitzt, und ermordet zwei Menschen, die er nicht kennt und zu denen er in keinerlei Beziehung steht. – Zunächst geht es ihm gut damit«, fuhr Sunday fort und tippte sich an den Kopf. »Aber irgendwann werden ihm seine Gedanken, insbesondere seine Fantasie, zum Verhängnis. Irgendwie glaubt Raskolnikow doch an ein moralisches Universum, in dem das Leben tatsächlich einen übergeordneten Sinn hat, und darum zerbricht er an seiner Tat. Im Gegensatz zu unserem perfekten Verbrecher.« Der Professor hielt kurz inne und vergewisserte sich, dass er die Aufmerksamkeit seines Publikums wieder ganz für sich hatte. Dann sprach er weiter. »Für den perfekten Mörder ist es meines Erachtens selbstverständlich, dass das Leben sinnlos ist, eine Absurdität ohne absoluten Wert. Solange der Täter aus dieser Perspektive handelt, kann sein eigener Geist ihn nicht in die Falle locken, und auch die Polizei kann ihm nicht gefährlich werden.«
Sunday sprach noch eine ganze Weile weiter und berichtete, wie die Indizien an den Schauplätzen der Morde seine Theorien gestützt und dann zu weiteren Theorien geführt hatten.
Zum Schluss stellte er sich den Fragen der Zuhörer. Nach mehreren Korinthenkackern, die sich auf irgendwelche Belanglosigkeiten in seinem Buch gestürzt hatten, klimperte die sexy Frau in der zweiten Reihe mit den Wimpern und hob träge, fast gelangweilt, den Arm mit der Panther-Tätowierung, als wollte sie einen Kellner auf sich aufmerksam machen.
Der Professor nickte ihr zu.
»Sie haben ja viele positive Kritiken für das Buch geerntet«, sagte sie mit ihrer sonoren Südstaatenstimme. »Eine Ausnahme war der Artikel, den Detective Alex Cross in der Washington Post veröffentlicht hat. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, Herr Professor, wenn ich sage, dass er Ihr Buch verrissen und praktisch jeder Ihrer Aussagen widersprochen hat. Er hat sogar behauptet, dass Sie, nachdem Sie ihn interviewt hatten, seine Worte so verdreht haben, dass sie keinen Widerspruch zu Ihrer These mehr bilden.«
Sunday biss kurz die Zähne zusammen, bevor er antwortete. »Quellen, die behaupten, etwas nicht gesagt zu haben, sind nichts Ungewöhnliches, das wird Ihnen jeder Journalist bestätigen. Zwischen Detective Cross und mir gibt es lediglich eine grundlegende Meinungsverschiedenheit, mehr nicht.«
Nach einer langen, peinlichen Stille räusperte sich Dr. Wolk und sagte: »Ich habe auch eine Frage, Dr. Sunday. Wie bereits angedeutet, fand ich Ihr Buch sehr spannend, aber auch ich habe Probleme mit einer Ihrer Schlussfolgerungen.«
Sunday zwang sich zu einem Lächeln. »Mit welcher denn, wenn ich fragen darf?«
»Sie beschreiben an einer Stelle die Antithese zu dem perfekten Verbrecher als Kriminalbeamten, der an ein ethisch-moralisches Universum und damit auch an ein sinnvolles Leben glaubt und dieses gewissermaßen verkörpert.«
Sunday nickte.
»Aber dann folgern Sie, dass dieser perfekte Kriminalbeamte, wenn man ihn dazu bringen würde, das Leben als sinnlos und wertlos zu betrachten …«
»… selbst zum perfekten Verbrecher würde?«, vollendete Sunday den Satz. »Ja. Das habe ich geschrieben. Ich halte das für eine vollkommen logische Schlussfolgerung, Herr Doktor. Sie nicht?«
4
4 Es war fast fünf Uhr nachmittags, als Sunday endlich seine im Washingtoner Wohnviertel Kalorama gelegene Wohnung betrat. Nach dem Vortrag hatte er einige wenige Bücher signiert, darauf folgte das unvermeidliche Mittagessen mit Dr. Wolk, der zu viel trank und philosophische Argumente oft auf Beispielsätze reduzierte, die nicht mehr Wert besaßen als eine x-beliebige Ratgeberkolumne.
Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, hatte Dr. Wolk Sunday immer wieder gefragt, welche Forschungsprojekte er während seines Sabbatjahrs eigentlich verfolge. Schließlich hatte Sunday dem Leiter der philosophischen Fakultät der Georgetown University die ungeschminkte, wenn auch ausgesprochen vage Wahrheit offenbart: »Ich führe ein Experiment durch, das die Dimensionen einer existenzialistischen Welt und die Rolle des menschlichen Wesens in dieser Welt ergründen soll.«
Dr. Wolk hatte sehr interessiert reagiert und wollte sofort mehr wissen, doch Sunday hatte sich standhaft geweigert und seinem Kollegen lediglich beschieden, dass er eines Tages, sobald seine Forschungen abgeschlossen seien, alles schwarz auf weiß lesen könne. Er hatte Wolk sogar versprochen, dass er der Erste sein würde, der es lesen durfte.
Schon vor der Wohnungstür nahm er die Zydeco-Klänge und den Knoblauchduft wahr. Er schloss auf und betrat ein Zimmer mit weißen Wänden, einer weißen Decke und einem blassgrauen Teppich. Etliche Stühle aus Chrom und schwarzem Leder standen vor einem Flachbildfernseher, auf dem ein Musiksender eingestellt war.
Im Zimmer bewegte sich eine Frau zur Musik. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, während sie die Hüften schwang und die Taille kreisen ließ. Die wilde, dunkelblonde Mähne hatte sie hochgebunden. Sie war barfuß, trug eine locker sitzende, olivgrüne Hose und ein enges, weißes Tanktop, das den Blick auf verschwitzte Haut und kräftige Schultermuskeln freigab, während sie die Arme in die Luft reckte, sodass die farbenprächtige Tätowierung mit dem liegenden Panther, die fast ihren ganzen Arm bedeckte, gut zu erkennen war.
Lächelnd ließ Sunday die Tür ins Schloss fallen. Die Frau unterbrach ihren Tanz und blickte ihn mit ihren kleegrünen Augen über die Schulter hinweg an. Sie grinste, klatschte in die Hände und drehte sich ganz zu ihm um. Dann rannte sie auf ihn zu, küsste ihn gierig auf den Mund und sagte mit ihrem leichten Cajun-Akzent: »Hab schon gedacht, du würdest dich nie mehr blicken lassen, Marcus.«
»Hatte keine andere Wahl«, erwiderte Sunday. »Musste den Schein wahren.«
Sie sprang in seine Arme und schloss ihre kräftigen Oberschenkel um seine Hüften. Dann küsste sie ihn noch einmal. »Ich muss dir was zeigen, mein Süßer.«
»Hast du schon wieder Fifty Shades of Grey gelesen, Acadia?« Seine Stimme klang belustigt, während er in ihre unfassbaren Augen starrte.
»Besser«, meinte Acadia, löste die Umklammerung ihrer Beine und glitt zu Boden. »Kommst du, mein Süßer?«
Der Professor folgte ihr den Flur entlang, sah ihr wiegendes Hinterteil und dachte sofort an eine große Palette fleischlicher Gelüste. Doch anstatt ins Schlafzimmer führte sie ihn nach rechts in einen Raum, der eigentlich immer als Rumpelkammer gedient hatte.
Jetzt hingen vier Zweiundsiebzig-Zoll-Bildschirme an der hinteren Wand und schufen so eine riesige Videowand, die vom Boden bis zur Decke reichte, lediglich unterbrochen von einer Xbox-Kinect-Sensorleiste. Die Monitore schimmerten dunkelblau.
Ein schmuddeliger junger Kerl in Jeansjacke saß davor. Er hatte ihnen den Rücken zugewandt und starrte die Bildschirme an. Ein Bose-Kopfhörer pumpte ihm dröhnenden Hardrock in die Ohren. Auf dem Tisch lag eine Art Helm, und neben dem Tisch standen ein Server, der etwa die Größe eines großen Koffers besaß, sowie eine Xbox. Sie waren über Kabel mit mehreren Laptops verbunden.
»Ta-daa!«, sagte Acadia. »Was hältst du davon?«
Sunday packte sie wütend an ihrem Panther-Tattoo und zerrte sie über den Flur in ein anderes Zimmer. Erbittert herrschte er sie an: »Davon war nie die Rede. Wer ist der Kerl überhaupt?«
Genauso wütend zischte Acadia zurück: »Preston Elliot. Computer-Genie. Wer einen erstklassigen Durchblick haben will, der braucht erstklassiges Denken und eine erstklassige Ausrüstung. Hast du selbst gesagt!« Und bevor er ihr antworten konnte, fügte sie in sanfterem Tonfall hinzu: »Und außerdem, mein Süßer, hat Preston das meiste bei Costco besorgt. Die haben eine Rücknahmegarantie auf alle Elektronikartikel, für ein ganzes Jahr.«
Sunday blieb skeptisch. »Und was ist mit ihm? Was verlangt er?«
Sie blähte die Nüstern und blickte ihn an, als würde sie ihn am liebsten auf der Stelle mit Haut und Haaren verschlingen. »Der eifrige junge Mann erwartet zwei Stunden ultrageilen Sex mit mir. Er wird ein Kondom benutzen. Hast du nicht gesagt, dass du genau das im Moment gebrauchen könntest?«
Sunday neigte den Kopf und blickte sie erneut abschätzend an. »Tatsächlich? Ich habe gar nicht so genau hingesehen. Hat er …?«
»Ungefähr deine Größe und Statur, ja.«
Der Professor war fasziniert. Schlagartig erkannte er die gesamte Palette der Möglichkeiten. »Und das bedeutet?«
»Was meinst du?«, antwortete Acadia mit einer Gegenfrage. Ihr Atem ging ruhig. »Es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal gesündigt haben, mein Süßer.«
Sunday blickte ihr in die Augen und spürte, wie wilde Vorfreude in ihm aufstieg. »Wann?«, wollte er wissen.
Sie zuckte mit den Schultern. »Er muss jetzt nur noch die Software knacken. Morgen um diese Zeit will er damit fertig sein.«
»Wer weiß, dass er hier ist?«
»Niemand«, gab sie zurück. »Das ist Teil der Abmachung. Ein Geheimnis.«
»Und du glaubst, dass er sich daran hält?«
»Was glaubst du?« Sie drückte sich einen kurzen Augenblick lang an ihn und entfachte damit ein wahnsinniges Verlangen in ihm. Beim Blick in Acadias grüne Augen sah Sunday sich selbst im Alter von achtzehn Jahren, als er zum ersten Mal diesen raubtierhaften Rausch gespürt hatte, als er mit einem Spaten in der Hand einer Gestalt über einen dunklen Hof gefolgt war. Eine Sekunde lang kam es ihm so wirklich vor, dass er hätte schwören können, dass da irgendwo Schweine quiekten.
»Nun, mein Süßer?«, flüsterte Acadia.
»Ich gehe«, sagte er und spürte erneut dieses unglaubliche Zittern am ganzen Körper. »Es ist besser, wenn er mich heute gar nicht erst zu sehen bekommt.«
Sie sah ihn verführerisch an, drückte sich noch einmal an ihn und flüsterte ihm ins Ohr: »Acadia Le Duc kennt keine Grenzen. Keine Beschränkungen. Gar keine. Das weißt du doch, oder etwa nicht, mein Süßer?«
»Oh ja, Baby, das weiß ich«, stieß Sunday hervor. Er konnte kaum mehr atmen. »Das ist einer der Gründe, wieso ich so süchtig nach dir bin.«
5
5 Sehr viel später an diesem Tag entdeckte Kevin Olmstead, ein Mann Ende zwanzig mit weichen Gesichtszügen, das Neonschild mit der Aufschrift »Superior Spa«. Es handelte sich um einen Massagesalon in der Connecticut Avenue, der bekannt war für seine »Verwöhnmassagen mit Happy End«.
Happy End, dachte Olmstead und strich mit den Fingern sanft über seine zarte Haut. Trotz all des Durcheinanders in seinem Kopf wusste er immer noch, wie gut sich ein Happy End anfühlte und wie lange man etwas davon hatte. Und er hatte doch genügend Geld dabei, oder? Er hatte doch irgendwann im Lauf des Tages vor einem Geldautomaten gestanden und welches abgehoben.
Stimmt das denn? Habe ich das Geld noch?
Olmstead blieb stehen, blinzelte, versuchte, seine Gedanken wieder einigermaßen auf Kurs zu bringen, was ihm in letzter Zeit des Öfteren Probleme bereitete. Dann steckte er die Hand in seine rechte Jeanstasche und zog ein Bündel Geldscheine hervor. Lächelte erneut. Zumindest wenn es um Sex oder Geld ging, war er immer noch voll da.
Aufgeregt steuerte er den Eingang des Massagesalons an.
Ein Mann im Anzug, aber ohne Krawatte, kam hastig zur Tür heraus, bedachte Olmstead mit einem flüchtigen Blick und huschte an ihm vorbei. Irgendetwas an seinem Verhalten erweckte Erinnerungen an einen anderen Massagesalon, an einen anderen Abend.
Der Duft nach Zitronenreiniger, an den konnte Olmstead sich noch sehr lebhaft erinnern. Und ziemlich vage an fünf Leichen: drei Frauen in Bademänteln, einen Kubaner mit einem gestreiften Bowlinghemd und einem flachen Hütchen auf dem Kopf und einen Weißen mit einem billigen Anzug ohne Krawatte. Alle aus nächster Nähe erschossen, alle mit blutenden Kopfwunden.
Schmerzen durchzuckten Olmsteads Schädel, so stark, dass er beinahe auf dem Bürgersteig zusammengebrochen wäre. War das echt? War das wirklich passiert? Fünf Tote in einem Massagesalon in … wo? Florida?
Oder war das alles eine Halluzination? Eine Nebenwirkung seiner Medikamente?
Olmsteads Geist war bereits zur nächsten Erinnerung weitergewandert: eine Hand, die eine Pistole, eine Glock 21, in einen Rucksack steckte. War das der Rucksack, den er auf dem Rücken trug? Seine Hand?
Er blickte seine Hände an und stellte verblüfft fest, dass er fleischfarbene Latexhandschuhe trug. Als er gerade einen Blick in den Rucksack werfen wollte, ging die Tür des Superior Spa auf.
Eine junge Asiatin blickte ihn an und lächelte verführerisch. Sie trug rote Hotpants, Stilettos und ein T-Shirt, auf dem in Glitzerschrift »Göttin« zu lesen war. »Alles gut«, sagte sie ein wenig stockend. »Wia nich beiß’. Du will reinkomm’?«
Happy End, dachte Olmstead und ging auf sie zu. Er empfand eine überwältigende Dankbarkeit, weil sie ihn eingeladen hatte.
Jedes Detail des Superior Spa rief in Olmstead große Bewunderung hervor, sogar die stampfende Hip-Hop-Musik. Doch was ihn am allermeisten in den Bann zog, das war der Geruch nach Zitronenreiniger. Er sog den Duft lange und tief in die Nase, so wie andere es vielleicht mit einem frisch gebackenen Kuchen getan hätten, während vor seinem geistigen Auge die Bilder der Leichen in Florida aufzuckten. Waren sie echt? War das hier echt?
Er blickte das niedliche Ding mit den roten Hotpants an und sagte: »Arbeiten heute Abend auch noch andere Mädchen?«
Sie machte einen Schmollmund und pikste ihn in die Rippen. »Was, du mich nich’ mag?«
»Oh doch, ich mag dich sogar sehr, du niedliches Ding. Wollte nur wissen, was es sonst noch so gibt.«
Jetzt kam ein breitschultriger, humorlos wirkender Mann mit einem schwarzen T-Shirt hinter dem weinroten Vorhang hervor, gefolgt von einer zweiten Asiatin. Sie war noch zierlicher als das niedliche Ding und starrte Olmstead aus rosafarbenen, wässerigen, leeren Augen an.
»Na, Bruder? Welche gefällt dir am besten?«, wollte der Breitschultrige wissen.
»Die gefallen mir alle beide«, erwiderte Olmstead.
»Was glaubst du denn? Dass du hier in Bangkok bist, oder was? Du musst dich schon entscheiden.«
»Wie viel?«
»Dusche, saubere Liege, Massage, das macht fünfundsiebzig für mich«, gab der Türsteher zurück. »Alles andere besprichst du mit dem Mädchen. Und bezahlst es auch bei dem Mädchen.«
Olmstead nickte und zeigte auf das niedliche Ding, das ihn hocherfreut ansah.
Der Türsteher sagte: »Fünfundsiebzig, und dein Rucksack bleibt hier bei mir, Bruder.«
Olmstead ließ die Augenlider ein wenig sinken und nickte. »Ich hol bloß meinen Geldbeutel raus.«
Er nahm den Rucksack ab, stellte ihn auf einen Plastikstuhl und klickte den Verschluss auf. Dann zog er den Riemen auf, der das größte Fach verschlossen hielt. Ganz unten lag sein Portemonnaie. Und daneben eine wunderschöne Glock 21.
War das ein Schalldämpfer da auf dem Lauf? War die Pistole tatsächlich echt? War das alles hier echt?
Olmstead hoffte es jedenfalls, während er die Pistole aus dem Rucksack zog. Stichwort Happy End: Ein feuchter Traum war nur selten genauso befriedigend wie das Original.
6
6 Am selben Abend um kurz nach acht machte ich mich startklar. Ich wollte nach Hause fahren, meine Frau und meine Kinder begrüßen und mir die zweite Halbzeit des Spiels ansehen. Genau wie John Sampson. Wir hatten einen harten, kräftezehrenden Tag hinter uns, der kaum Fortschritte gebracht hatte. Als dann Captain Quintus in unserer Tür stand und den Ausgang versperrte, stöhnten wir beide laut auf.
»Schon wieder einer?«, fragte ich.
»Sie wollen uns verarschen«, meinte Sampson.
»Keineswegs«, gab Quintus grimmig zurück. »Mindestens drei Tote in einem Massagesalon in der Connecticut. Die Streifenbeamten, die zuerst am Tatort waren, sprechen von einem Blutbad. Und die haben bis jetzt nur den Eingangsbereich gesehen. Sie warten draußen, bis Sie und Sampson auch die übrigen Räume in Augenschein genommen haben. Die Kriminaltechnik ist völlig überlastet. Sie kommen, so schnell sie können.«
Seufzend warf ich die Akte Kimmel auf meinen Schreibtisch und griff nach meiner blauen Windjacke mit der Aufschrift »Mordkommission«. Sampson machte es mir nach, und dann brachte er uns in einem Zivilfahrzeug hinüber zur Connecticut Avenue, ein kleines Stück südlich des DuPont Circle. Die Metro Police hatte die Umgebung des Massagesalons bereits großräumig abgesperrt. Die ersten Übertragungswagen trafen auch schon ein. Wir zogen uns schnell hinter das gelbe Absperrband zurück, bevor sie uns entdeckten.
Officer K. D. Carney, ein junger Streifenbeamter, war als Erster am Tatort gewesen und brachte uns auf den neuesten Stand. Um 19.55 Uhr war in der Funkzentrale ein Notruf von einem anonymen männlichen Anrufer eingegangen: »Im Superior Spa in der Connecticut Avenue muss irgendjemand durchgeknallt sein.«
»Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und ganz in der Nähe, darum war ich als Erster vor Ort«, sagte Carney, in dessen Babygesicht weder Augenbrauen noch Wimpern zu sehen waren. Da er auch keinen Bartwuchs und keine Armbehaarung hatte, nahm ich an, dass er an Alopecia universalis litt, einer Krankheit, die zum vollständigen Verlust der Körperbehaarung führt.
»Ist der Tatort kontaminiert?«, wollte ich wissen.
»Von mir nicht, Sir«, erwiderte der junge Polizist. »Ich habe nur einen Blick reingeworfen, die drei Leichen gesehen, dann bin ich wieder raus und habe die Türen versiegelt. Es gibt noch einen Hinterausgang, der auf eine schmale Gasse führt.«
»Die sollten wir vorerst mal absperren«, sagte ich.
»Soll ich sie absuchen?«
»Warten Sie, bis die Kriminaltechniker da sind.«
Die Enttäuschung war Carney deutlich anzumerken. So reagiert nur jemand, dessen größter Wunsch es ist, Detective zu werden. Aber es musste sein. Je weniger Personen Zugang zum Tatort hatten, desto besser.
»Sie wissen, was dieser Laden für eine Geschichte hat, oder?«, fragte Carney, während Sampson und ich in blaue Plastiküberzieher und Latexhandschuhe schlüpften.
»Nicht mehr genau«, meinte Sampson.
»Früher hieß er mal Cherry Blossom Spa«, sagte Carney. »Aber das ist vor ein paar Jahren geschlossen worden, weil die Besitzer hier Sexsklaven gehalten haben.«
Jetzt fiel es mir wieder ein. Das war während meiner Zeit in Quantico gewesen, als ich noch für das FBI gearbeitet hatte. Aber ich hatte gehört, dass minderjährige Mädchen mit dem Versprechen einer problemlosen Einreise in die USA angelockt und dann von asiatischen Gangstersyndikaten versklavt worden waren.
»Wie um alles in der Welt haben die es geschafft, den Laden überhaupt wieder aufzumachen?«
Carney zuckte mit den Achseln. »Neue Besitzer, nehme ich an.«
»Danke, Officer«, sagte ich und ging auf die Eingangstür zu. »Gute Arbeit.«
Ich machte die Tür auf. Drei Schritte später standen wir mitten in einem Hitchcock-Film.
Es stank durchdringend nach Zitronenreiniger. Lautsprecherboxen brummten. Eine Asiatin in roten Hotpants, hochhackigen Pumps und weißem T-Shirt lag in ihrem eigenen Blut der Länge nach auf dem Fußboden. Eine Kugel hatte ihr die Halsschlagader zerfetzt.
Das zweite Opfer war ebenfalls Asiatin. Sie trug einen fadenscheinigen Bademantel und lag vor einem weinroten Vorhang, fast in Embryonalstellung. Das rechte Auge war weit aufgerissen, und ihre Finger waren gespreizt. Aus ihrer linken Augenhöhle war Blut über ihr Gesicht getrieft und hatte ihre Haare durchtränkt.
Das dritte Opfer war der Manager des Ladens. Er lag vor einer mit Blutspritzern übersäten Wand hinter dem Tresen, mit verblüfftem Gesichtsausdruck und einem Einschussloch mitten in der Stirn.
Ich zählte insgesamt vier Neun-Millimeter-Hülsen. Und anscheinend hatte der Täter überall reichlich Desinfektionsmittel versprüht. Auf den Leichen, den Möbeln und dem Fußboden, überall waren Spuren davon zu erkennen. Neben der Leiche des Managers stand ein leerer Fünfundzwanzig-Liter-Kanister Citrus II, ein antibakterielles Reinigungskonzentrat speziell für Krankenhäuser. Und hinter dem weinroten Vorhang, in einem L-förmigen Flur mit nackten, schmierigen Gipskartonwänden und einer unglaublich deprimierenden Atmosphäre, entdeckten wir noch einen zweiten, identischen Kanister. Er war ebenfalls leer.
Im rechten der beiden Hinterzimmer lag die vierte Leiche.
Ich bin ziemlich groß, und Sampson misst knapp an die zwei Meter, doch das Kraftpaket, das da mit dem Gesicht nach unten auf der Matratze lag, gehörte in eine ganz andere Liga. Ich schätzte ihn auf deutlich über zwei Meter und an die hundertdreißig Kilogramm. Das meiste davon waren Muskeln. Die halblangen braunen Haare hingen ihm über das blutüberströmte Gesicht.
Ich zückte mein Handy und machte ein paar Fotos, ging in die Hocke und schob seine Haare zurück, um freie Sicht auf die Wunde zu bekommen. Dabei sah ich sein Gesicht und erstarrte.
»Himmel, Arsch und Zwirn«, sagte Sampson, der direkt hinter mir stand. »Ist das …?«
»Pete Francones«, sagte ich und nickte ungläubig. »Der Bekloppte persönlich.«
7
7 Pete »Der Bekloppte« Francones hatte vierzehn Jahre lang die Verteidigung der Washington Redskins angeführt. Als Defensivspieler, gesegnet mit herausragender Schnelligkeit und Wendigkeit, richtete er unter den Sturmreihen der National Football League verheerende Schäden an und erarbeitete sich einen Ruf als nimmermüder Kämpfer, der in jedem Spiel eine fast irrwitzige Leidenschaft an den Tag legte.
Schon auf dem College war er durch sein theatralisches Verhalten an der Seitenlinie aufgefallen. Aus dieser Zeit stammte auch sein Spitzname, und er hatte das ganze Theater um sein Image weidlich genutzt, um jede Menge Werbeverträge abzuschließen und so ein stattliches Vermögen anzuhäufen. Es schadete auch nicht, dass Francones gut aussah, nicht dumm war, reden konnte und eine gewisse Respektlosigkeit besaß – alles Eigenschaften, die ihm in der vergangenen Saison einen Platz auf einem der heiß begehrten Kommentatorsessel bei Monday Night Football beschert hatten.
Und jetzt war Francones das vierte Opfer einer Mordserie an einem der schmierigsten Orte von ganz Washington? Ausgerechnet er?
»War der nicht mit, keine Ahnung, Miss Universum oder irgend so einer zusammen?« Sampson klang verblüfft.
»Mit einer Bewerberin. Miss Venezuela.«
»Also, was wollte er in so einem Höllenloch?«
Ich konnte mir mehr als einen Grund denken, aber ich verstand, was er meinte. Francones war eigentlich nicht der Typ, der für Sex bezahlen musste. Wenn man der Klatschpresse glauben wollte, dann warfen die Frauen sich ihm auch so reihenweise an den Hals und sonst wohin …
Und noch etwas war seltsam. »Wo ist seine Masseuse abgeblieben?«
Wir sahen unter dem Bett nach. Wir hoben Francones sogar hoch, falls sie unter ihm lag. Aber da war sie auch nicht.
»Schalldämpfer«, sagte Sampson und riss mich aus meinen Gedanken.
»Wie bitte?«
»Der Täter muss einen Schalldämpfer benutzt haben. Sonst hätte Francones die Schüsse gehört, wäre aufgestanden und hätte zur Tür geschaut.«
Jetzt wurde mir klar, was er sagen wollte. »Die drei im Foyer sterben also zuerst. Dann kommt der Killer in den Flur, sieht Opfer Nummer vier, macht es mit einem Schuss kampfunfähig und tötet es mit dem nächsten.«
»Hört sich nach Profi an.«
Ich nickte und betrachtete noch einmal die Verletzungen des Bekloppten, versuchte, die Schussbahn zu rekonstruieren. »Den ersten Schuss fängt er sich im Knien ein. Dann kippt er nach vorn. Also noch mal: Wo ist die Masseuse?«
»Und was soll das mit dem Desinfektionsmittel?«
»Vielleicht kann der Täter den Geruch des Todes nicht ertragen?«
»Oder der Zitronenduft macht ihn geil.«
»Jedenfalls war es eindeutig kein Raubmord«, meinte Sampson und deutete auf die Breitling an Francones’ Handgelenk.
Ich hob die Hose der hochdekorierten Football-Koryphäe vom Boden auf, durchsuchte die Taschen und brachte eine goldene Geldscheinklammer mit tausend Dollar in Fünfzigern zum Vorschein. Und dann noch etwas, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Das Röhrchen enthielt ein weißes Pulver, mindestens drei Gramm. Es war nur zur Hälfte gefüllt. Ich probierte vorsichtig davon. Der bittere Geschmack des hochreinen Kokains ließ meine Zungenspitze und meine Lippen taub werden.
Ich gab Sampson das Röhrchen und sagte: »Ich kann mich nicht erinnern, dass der Bekloppte je etwas mit Drogen zu tun gehabt hat.«
»Vielleicht war er von Natur aus ja gar nicht so irre und durchgeknallt, wie er immer getan hat.«
Wir steckten das Kokain in einen Indizienbeutel.
»Siehst du irgendwo ein Handy?«, fragte Sampson dann.
»Nein. Auch keine Autoschlüssel. Und schon gar keine dritte Frau.«
Wir sahen uns auch im Rest des Superior Spa gründlich um. Das Büro war oberflächlich durchsucht worden. Aber seltsamerweise hatte der Täter die unverschlossene Geldkassette, die fast viertausend Dollar enthielt, nicht angetastet. Genauso wenig wie den Geldbeutel mit sechshundert Dollar und Ausweispapieren, die dem neunundzwanzig Jahre alten Manager gehörten, einem gewissen Donald Blunt aus College Park, Student an der University of Maryland. Das Einzige, was sicher fehlte, war die Festplatte mit den Aufnahmen der Überwachungskameras im Foyer.
Im Umkleidezimmer der Frauen entdeckten wir Kleidung, Bargeld, drei Handys und Ausweispapiere, mit deren Hilfe wir die beiden getöteten Frauen identifizieren konnten. Die mit den roten Hotpants war Kim Ho, zwanzig Jahre alt, Koreanerin. Sie war vor drei Monaten mit einer befristeten Arbeitserlaubnis in die USA gekommen. Die andere, die wir in Embryonalstellung vorgefunden hatten, hieß An Lu, war ebenfalls Koreanerin, neunzehn Jahre alt und auch mit einem befristeten Arbeitsvisum ausgestattet.
»Das dritte Handy«, sagte Sampson.
»Die dritte Masseuse«, sagte ich und nickte. Ich musste noch einmal an die Wunde im unteren Rücken des Bekloppten denken. Er musste gerade gekniet haben, als …
»Detective Cross?«, sagte Officer Carney.
Sampson und ich wirbelten herum. Der Streifenbeamte stand in der Tür. Er hatte Plastiküberzieher über die Schuhe gestreift.
»Officer, ich hatte Sie doch eindeutig gebeten, draußen zu bleiben und das Gelände abzusperren.«
Carney zog den Kopf ein Stück zurück. »Tut mir leid, Sir, aber ich dachte, es interessiert Sie vielleicht, dass draußen eine hysterische junge Frau steht, die behauptet, dass sie mindestens eine der Personen gekannt hat, die heute Abend hier gearbeitet haben.«
8
8 »Mein Name ist Alex Cross«, sagte ich zu der jungen Frau, die Officer Carney zu mir gebracht hatte. »Dürfte ich bitte einmal Ihren Ausweis sehen, Miss?«
Die junge Asiatin in Jeans, Turnschuhen und einer Windjacke mit dem Schriftzug der George Washington University schien mich zuerst gar nicht zu hören. Sie starrte stumm auf die Tür des Superior Spa. Ihre Mimik, ihre Gestik, ihre Haltung, alles drückte tiefste Qual aus.
»Miss?«, sagte ich leise.
Mit zitternder Stimme erwiderte sie: »Sind alle tot?«
»Ich fürchte, da drin ist niemand mehr am Leben, ja«, sagte ich. »Woher …«
Im selben Augenblick schien sämtliche Energie in ihr zu verpuffen. Sie brach auf dem Bürgersteig zusammen, noch bevor ich sie auffangen konnte. Sie keuchte, würgte und übergab sich mehrmals. Dann hob sie den Blick, sah mich an und fing an zu schluchzen. »Ich habe gewusst, dass das hier … Ich, ich habe sie gewarnt. Aber sie hat immer gesagt, dass …«
Sie begann zu hyperventilieren und schluckte trocken. Ich kauerte mich neben sie, legte ihr die Hand auf den Rücken und versuchte, sie zu trösten. Aber sie reagierte, als hätte ich ihr ein heißes Bügeleisen auf die Haut gedrückt.
Sie zuckte zusammen, rückte von mir ab, drückte sich gegen das Schaufenster eines Farbengeschäfts, warf die Hände in die Luft und kreischte: »Nein! Nein! Fassen Sie mich nicht an!«
»Miss«, sagte ich. »Ich habe nicht die Absicht …«
Und dann begriff ich.
Ich erhob mich, trat mehrere Schritte zurück und ging erneut in die Hocke. Wie gesagt, ich bin ziemlich groß und versuchte jetzt, ein bisschen weniger bedrohlich zu wirken. Sampson hatte zugehört, und ich bat ihn mit einer Kopfbewegung, es mir nachzumachen.
»Miss?«, sagte ich dann. »Arbeiten Sie hier?«
Ihre Augen hatten wieder diesen abwesenden Ausdruck angenommen, aber sie schüttelte heftig den Kopf.
»Haben Sie früher einmal hier gearbeitet?«, wollte Sampson wissen.
Ihr Blick huschte zur Eingangstür, und dann liefen ihr die Tränen über die Wangen. »Meine Eltern«, schluchzte sie. »Sie werden es erfahren, nicht wahr?«
Im Lauf der nun folgenden Viertelstunde erfuhren wir in groben Zügen ihre Geschichte. Ihr Name war Blossom Mai, und sie stammte aus San Diego. Sie war neunzehn Jahre alt und studierte im zweiten Jahr Medizin an der George Washington University. Ihre Eltern waren vietnamesische Einwanderer, die achtzig Stunden in der Woche schufteten, um ihr das Studium zu ermöglichen. Sie trugen die Kosten für eine einfache Unterkunft und Verpflegung, die nicht durch Stipendien abgedeckt waren, mehr aber nicht.
Blossom hatte auch einen Job an der Universität, aber der brachte nicht genug zum Leben ein, zumindest nicht für ein Leben, das sich mit dem ihrer reichen Kommilitoninnen vergleichen ließ. Im vergangenen Herbst hatte Blossom Freundschaft mit einer jungen Frau namens Cam Nguyen geschlossen. Sie war ein Jahr älter und studierte Wirtschaftswissenschaften, stammte aus Orange County in Kalifornien und war, genau wie Blossom, das Kind vietnamesischer Einwanderer, die für ihre Ausbildung jeden verfügbaren Cent zusammengekratzt hatten.
Aber Cam trug immer topmoderne Kleidung, und samstagabends besuchte sie teure Lokale in Georgetown. Cam schien alles zu haben, was Blossom auch gerne gehabt hätte.
»Und da haben Sie sie gefragt, wie sie das macht?«, hakte Sampson nach.
Blossom nickte. »Sie hat gesagt, dass es als Escortdame gefährlicher ist, als wenn man hier arbeitet, weil der Geschäftsführer bewaffnet ist.«
Es war eine einfache Sache. Jedes Mädchen bezahlte pro Schicht fünfhundert an den Geschäftsführer. Und jeder Kunde bezahlte fünfundsiebzig. Alles, was darüber hinausging, bekamen die Mädchen. Cam machte oft tausend, manchmal sogar tausendfünfhundert pro Abend. Aber Blossom hatte nur einen einzigen Abend im Superior Spa gearbeitet.
»Es war wie in einem ekligen Albtraum«, erzählte sie und brach erneut in Tränen aus. »Ich … ich habe es einfach nicht noch einmal über mich gebracht. Ich konnte das Geld nicht einmal ausgeben. Das habe ich einer Obdachlosenunterkunft gespendet. Aber Cam, sie konnte die unangenehmen Dinge einfach ausknipsen, verstehen Sie?«
»Warum glauben Sie, dass Cam da drin ist?«
»Ich weiß, dass Sie da drin ist«, erwiderte Blossom. »Wir wohnen direkt nebeneinander, nur ein paar Querstraßen von hier entfernt. Ich habe sie vor zwei, nein, vor drei Stunden auf dem Flur getroffen. Sie hat gesagt, dass sie gerade auf dem Weg hierher ist, und wollte, dass ich mitkomme.«
»Gut, dass Sie das nicht gemacht haben«, sagte ich leise.
Es dauerte einen Augenblick, dann sagte Blossom mit schwacher Stimme: »Ist sie tot? Cam?«
»Wissen wir nicht«, erwiderte Sampson. »Da drin ist sie jedenfalls nicht.«
»Wirklich?« Plötzlich blitzte Hoffnung in Blossoms weit aufgerissenen Augen auf. »Vielleicht war sie ja doch nicht hier.«
»Haben Sie ihre Handynummer?«
Sie nickte und gab sie mir.
Ich sagte zu Sampson: »Geh mal rein, vielleicht hörst du ja was.«
Sampson verstand und ging los. Ich wartete noch eine Minute und wählte. Es klingelte. Mein Partner meldete sich. »Das ist es«, sagte er. »Das blaue iPhone.«
»Okay.« Ich legte auf und sah Blossom an. »Ihr Handy ist da, aber sonst nichts.«
»Unmöglich.« Blossom schüttelte den Kopf. »Ihr Handy würde sie niemals irgendwo liegen lassen. »Sie ist praktisch süchtig.«
»Und wenn sie gerade vier Menschen erschossen hätte?«, fragte ich sie. »Würde sie es dann vielleicht liegen lassen?«
»Cam?« Sie hielt inne. »Also … das weiß ich nicht.« Sie verzog das Gesicht zu einer gequälten Grimasse. »Wie soll ich das alles meinen Eltern erklären?«
Ich wusste zuerst nicht, was sie meinte, doch dann wurde es mir klar. »Blossom, solange Sie mit uns kooperieren, sehe ich keinen Grund, weshalb Ihre Eltern etwas davon erfahren sollten.«
»Wirklich nicht?«
»Wirklich nicht.«
Und dann brach Blossom Mai ein zweites Mal zusammen.
9
9 Am nächsten Morgen gegen Viertel vor acht schlenderte Marcus Sunday mit selbstbewussten Schritten durch das Foyer des Four Seasons Georgetown. Er wusste genau, dass kein Mensch ihn in dieser haarsträubenden Aufmachung erkennen würde.
Manch anderen hätte man in diesem Outfit – violette, knöchelhohe Turnschuhe, orangefarbenes Hemd und Hose, eisblaue Kontaktlinsen, zwei Nasenringe und dazu der flammend rote Abraham-Lincoln-Bart und die farblich abgestimmte Perücke mit den Zehn-Zentimeter-Stoppeln – für einen Clown gehalten. Doch Sunday wusste, dass diese Verkleidung eine gewisse, nun ja, charismatische Bedrohung verströmte, ganz besonders an einem Ort wie diesem. Als wäre er so eine Art durchgeknallte Riesenkarotte oder etwas noch Schlimmeres.
Und tatsächlich machte der Oberkellner einen einigermaßen alarmierten Eindruck, als Sunday sich eine Washington Post von einem Stapel schnappte, der auf einem Tisch zum Mitnehmen bereitlag. Der Aufmacher handelte vom Tod des bekloppten Francones und dreier weiterer Personen in einem Massagesalon. Sunday näherte sich dem Pult des Oberkellners und sagte in nasalem, weinerlichem Tonfall: »Tisch für eine Person.«
Der Oberkellner blickte Sunday von oben herab an und erwiderte: »Sie haben reserviert, Sir?«
»Hotelgast«, sagte Sunday. »Nummer 1450.«
Nummer 1450 war eine Suite, die tausend Dollar pro Tag kostete. Die Haltung des Oberkellners veränderte sich sichtlich, obwohl er die Aufmachung des Professors immer noch misstrauisch beäugte. »Mr. …?«
»Mulch«, erwiderte Sunday. »Thierry Mulch. Wie Kompost.«
»Oh«, machte der Oberkellner, als hätte er plötzlich einen unangenehmen Geschmack im Mund, und griff nach einer Speisekarte. »Bitte folgen Sie mir, Mr. Mulch.«
Im Speisesaal schien der Luftdruck schlagartig zu sinken, als hätte ein umfassendes Tief den Raum erfasst. Außerdem war hier jenseits des beklagenswerten Speck-, Würstchen- und Kaffeearomas ein Geruch festzustellen, den Sunday als die Fäulnis der Macht identifizierte.
Korpulente Hemdträger mit Fünfhundert-Dollar-Haarschnitten starrten dem Professor entgegen. Eine messingblonde, alternde Schönheit in einem ziegelroten Chanel-Anzug hob den Blick, als er an ihr vorüberging. Sunday zwinkerte ihr zu und leckte sich lüstern die Oberlippe. Ihre Wangen begannen zu glühen, und er musste beinahe lachen.
Er ging weiter und dachte an Acadia Le Duc und die unbeschreiblichen Freuden und Sehnsüchte, die sie miteinander teilen würden, sobald …
»Mr. Mulch?«, unterbrach der Oberkellner seine Gedanken und deutete mit steifer Geste auf ein Tischchen, das eingezwängt in einer Ecke neben der Küchentür stand.
»Warum stecken Sie mich nicht gleich ins Klo?«, fragte er mit dieser nasalen, weinerlichen Stimme und zeigte dann zu den Fenstern hinüber. »Da will ich sitzen.«
Der Oberkellner versteinerte, doch dann nickte er und brachte den Professor an einen Tisch, wo ihn fast jeder sehen konnte.
»Danke«, sagte Sunday vernehmlich. »Das ist schon deutlich besser.«
Er sah sich um und musterte die verschiedenen Würdenträger, Politiker, Lobbyisten und was sonst noch so herumsaß und ihn mehr oder weniger offen anstarrte. Der Professor streckte etlichen davon den nach oben gereckten Daumen entgegen. Sie sahen ihn an, als sei ihnen gerade eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen.
Fantastische Unterhaltung, dachte er und machte sich daran, seine Gegenspieler zu analysieren.
Es waren die üblichen lächerlichen Gestalten, die an Anstand, Takt und gute Manieren glaubten. Sunday hatte festgestellt, dass man nur kräftig genug an diesen Anstandsregeln rütteln musste, um eine ganze Menge Aufregung zu erzeugen. Und Aufregung war, zumindest aus seiner Sicht, etwas Gutes, etwas sehr Gutes sogar. Ja, es war das, wofür er lebte.
Aber als ein Kellner an seinen Tisch trat, um Kaffee einzuschenken und seine Bestellung entgegenzunehmen, riss Sunday sich zusammen. Er hatte Hunger und außerdem einen anstrengenden Tag vor sich.
»Die Frittata, die Zitronen-Ricotta-Pancakes und ein großes Glas frisch gepressten Orangensaft«, sagte er.
»Gebratenen Speck?«, erkundigte sich der Kellner.
Sunday verzog das Gesicht. »Nein. Nie wieder.«
Nachdem der Kellner gegangen war, las der Professor den Artikel über den Mord an Francones. Sehr interessant, besonders die Tatsache, dass Alex Cross die Ermittlungen übernommen hatte. Na ja, wer auch sonst?
Doch anstatt jetzt richtig schlechte Laune zu bekommen, konzentrierte Sunday sich wieder auf die vor ihm liegende Aufgabe. Mach eine Szene, dachte er.
Er blickte sich noch einmal um und sah, dass am Tisch links neben ihm ein Langweiler in einem Brooks-Brothers-Anzug, mit dem er sich eindeutig als Bürokratenspießer zu erkennen gab, Platz genommen hatte. Er beschäftigte sich intensiv mit seinem iPhone. Sunday erkannte ihn. Es war einer dieser gut vernetzten Politikexperten, die regelmäßig in den Morgenmagazinen der verschiedenen Fernsehsender auftraten, ein Kerl mit teigiger Fratze und Fliege, der nie ein einsilbiges Wort verwendete, wenn man mit einem sechssilbigen das Gleiche sagen konnte.